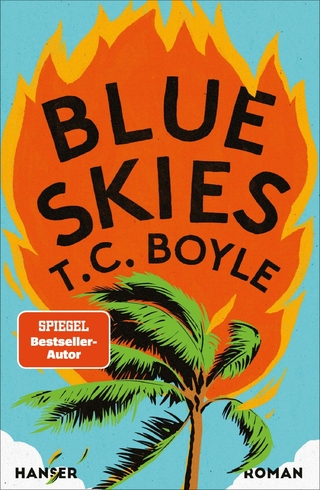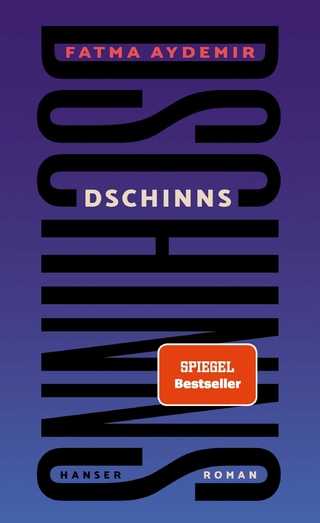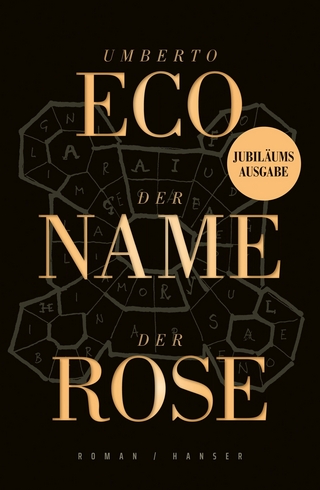Dies ist kein Liebeslied (eBook)
288 Seiten
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH
978-3-462-31595-0 (ISBN)
Karen Duve, 1961 in Hamburg geboren, lebt in der Märkischen Schweiz. Sie wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Ihre Romane Regenroman (1999), Dies ist kein Liebeslied (2002), Die entführte Prinzessin (2005) und Taxi (2008) waren Bestseller und sind in 14 Sprachen übersetzt. 2011 erschien ihr Selbstversuch Anständig essen, 2014 ihre Streitschrift Warum die Sache schiefgeht. Die Verfilmung ihres Romans Taxi kam 2015 in die Kinos. 2016 sorgte sie mit ihrem Roman Macht für Aufruhr und wurde mit dem Kasseler Literaturpreis für grotesken Humor (2017) ausgezeichnet. Für ihren Roman Fräulein Nettes kurzer Sommer (2018) wurde Karen Duve mit dem Carl-Amery-Preis, dem Düsseldorfer Literaturpreis und dem Solothurner Literaturpreis ausgezeichnet.
Karen Duve, 1961 in Hamburg geboren, lebt in der Märkischen Schweiz. Sie wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Ihre Romane Regenroman (1999), Dies ist kein Liebeslied (2002), Die entführte Prinzessin (2005) und Taxi (2008) waren Bestseller und sind in 14 Sprachen übersetzt. 2011 erschien ihr Selbstversuch Anständig essen, 2014 ihre Streitschrift Warum die Sache schiefgeht. Die Verfilmung ihres Romans Taxi kam 2015 in die Kinos. 2016 sorgte sie mit ihrem Roman Macht für Aufruhr und wurde mit dem Kasseler Literaturpreis für grotesken Humor (2017) ausgezeichnet. Für ihren Roman Fräulein Nettes kurzer Sommer (2018) wurde Karen Duve mit dem Carl-Amery-Preis, dem Düsseldorfer Literaturpreis und dem Solothurner Literaturpreis ausgezeichnet.
Mein erster Freund hieß Axel Vollauf. Axel war blond und dünn und hatte große, runde, stets weit aufgerissene Augen, so als hätte er einmal ein Massaker oder einen Meteoriteneinschlag mit ansehen müssen, und seitdem diesen Gesichtsausdruck beibehalten. Unsere Liebe war heiter und unspektakulär. Wir besuchten dieselbe Klasse und gingen morgens Hand in Hand zur Schule. Axel in seinem braunen Anorak und von der Verkehrswacht mit einer gelben Pudelmütze ausgerüstet, ich in einer dunkelblauen Clubjacke mit einem gestickten Wappen auf der Brusttasche. In das Wappen war der erste Buchstabe meines Namens integriert: ein verschnörkeltes A – für Anne. Das Kopftuch der Verkehrswacht hatte ich bereits einen Tag nach der Einschulung verloren. Wir trafen und trennten uns jedes Mal an derselben Straßenkreuzung, und verabredeten uns dort für den Nachmittag, den wir unter einem Rhododendronstrauch im Garten meiner Eltern verbrachten. Auf diesem vermoosten und von Sonne und Schatten gefleckten Stück Erde hatte ich ein Krankenhaus für Tiere eingerichtet. Anfangs hatte ich es allein geführt, war Ärztin und Pflegepersonal zugleich gewesen. Axel hatte bloß zugesehen. Dann wollte er auch Arzt sein, und als er Arzt war, verlangte er, dass ich einen meiner Berufe aufgeben müsste.
»Du kannst nicht Krankenschwester und Arzt sein«, sagte Axel und fixierte mich mit seinen großen Augen. Ich entschied, den Arztberuf hinzuwerfen, damit ich weiter die Schwesternhaube tragen konnte. An der Aufgabenverteilung änderte das nichts. Ich operierte, weil Axel sich davor ekelte, und Axel assistierte mir wie zuvor und pflegte den Moosteppich im Krankensaal. Die Betten bastelten wir aus orangen Zigarettenpackungen. Sie mussten immer wieder ersetzt werden, weil sie durch den nächtlichen Tau und die Feuchtigkeit der Patienten schnell aufweichten. Es waren Froschbetten. In Barnstedt gab es ungewöhnlich viele Frösche. Sie kamen von den nassen noch unbebauten Wiesen hinter den Gärten herauf und stürzten sich geradewegs in die nagelneuen Motormäher, mit denen unsere Nachbarn über ihre frisch angelegten Rasenflächen knatterten. Kein Haus in dieser Straße war älter als fünf Jahre. Die Leute bauten wie verrückt, schufen dauerhafte Sachwerte, legten Fundamente für ein glückliches Familienleben und hielten das Gras kurz. Sie verschuldeten sich und vertrauten darauf, dass es ihnen und der Wirtschaft auch weiterhin immer besser und besser gehen würde. Manchmal erzählte meine Mutter meinen Geschwistern und mir, wie die Nachbarn von gegenüber zwei Jahre lang mittags immer bloß eine Wurst gegessen hatten, um das Geld für ihren Hausbau zu sparen. Zwei Drittel der Wurst hatte Herr Lange gegessen und ein Drittel seine Frau. Wenn meine Mutter erst einmal von der geteilten Wurst angefangen hatte, kam sie unweigerlich auch noch darauf, wie unser Vater unser Haus gemauert hatte.
»Euer Vater hat jeden Stein von diesem Haus in seinen Händen gehabt – jeden einzelnen Stein«, sagte sie.
Wir waren das tüchtigste Volk der Welt. Deswegen hassten und beneideten uns die anderen Völker. Die Häuser, die wir bauten, hatten alle einen Jägerzaun, ein Quadrat aus Glasbausteinen neben der Haustür und auf der Rückseite ein Panoramafenster, an dem sich kleine Vögel das Genick brachen.
In meinem Spital gab es auch ein Bett für Vögel, eine Zigarrenkiste, die ich mit einem Taschentuch und einer Matratze aus einer Pralinenschachtel ausgepolstert hatte. Die Frösche schliefen auf Gras.
Die meisten Nachmittage verbrachten Axel und ich damit zu warten. Währenddessen horchten wir uns gegenseitig die Lungen ab, klopften uns mit dem Gummihammer auf die Knie und bereiteten die nächste Operation vor. Wir legten Plastikskalpell, Spielzeugspritze und Wattestäbchen auf eine Apfelsinenkiste, aber die einzigen Dinge, die wir tatsächlich brauchten – eine echte Schere und eine Rolle Tesafilm –, hielt ich bis zu ihrem Einsatz im Arztkoffer versteckt. Ich hatte sie meiner Mutter aus der Küchenschublade stehlen müssen, weil ich noch nicht allein mit einer spitzen Schere umgehen durfte und Tesafilm so teuer war. Auf der Terrasse lag mein Vater auf einer Gartenliege und schlief. Er hatte einen geheimnisvollen Beruf, dessen Zweck ich nicht verstand und für den es keinen richtigen Namen gab. In der Schule hatten wir erzählen sollen, was unsere Väter von Beruf waren, und ich hatte es nicht gewusst. Jedenfalls brauchte meiner immer nur bis zum frühen Nachmittag zu arbeiten. Wenn es das Wetter irgend zuließ, schnappte er sich dann seine Klappliege, packte sich hinter sein selbst gebautes Haus, rauchte Ernte 23, las das ›Hamburger Abendblatt‹ und schlief dabei ein, während die Sonne ihn immer brauner brannte. Er fing damit schon im März an, schlüpfte in Shorts, wenn andere Leute noch Handschuhe trugen, und er tat das an allen freundlichen Nachmittagen und Wochenenden, das ganze Frühjahr und den Sommer hindurch bis in den Herbst hinein. Er hatte einen leichten, unruhigen Schlaf. Mein Vater wartete wie wir auf das Geräusch eines Motormähers. Er hasste Rasenmäher mit Motor. Er hasste ihren Lärm. Als Erstes hörte man einen vergeblichen Startversuch, das kurze Knurren eines gleich wieder absaufenden Motors, oft noch einen zweiten und dritten Versuch, dann dröhnte es gleichmäßig herüber, und mein Vater sprang auf, tigerte seinen Jägerzaun entlang und witterte über Hecken, Koniferen und Rhododendren, wer ihm das jetzt wieder antat.
»Weigoni«, schnaubte er und verschränkte die Arme vor der Brust. »Das kommt von Weigonis. Es ist gar nicht erlaubt, während der Mittagsruhe zu mähen.«
Dann setzte ich meine Krankenschwesterhaube auf und schnappte den Arztkoffer. Axel nahm ein Strohkörbchen und folgte mir. Die meisten Gärten besaßen zu den unbebauten Wiesen hin keinen Zaun, und wir konnten ohne Schwierigkeiten zu den Nachbarn überwechseln. Herr Weigoni wusste schon, was wir wollten. Er nickte uns über seinen dröhnenden und rauchenden Mäher hinweg zu und machte eine einladende Handbewegung, die bedeutete, dass wir die gemähten Rasenstücke gern nach verletzten Fröschen absuchen konnten. Vor dem Rasenmäher hergehen und die Frösche retten, durften wir nicht. Herr Weigoni hatte Angst, dass wir mit den Füßen in die Messer geraten könnten. Axel hielt den Korb, und ich legte die Frösche hinein, Frösche ohne Arme und Beine und große dicke Biester, aus deren Bäuchen gräuliche Därme quollen und Arme und Beine ohne Frösche. Wir behandelten grundsätzlich alle Opfer, selbst die hoffnungslosen Fälle: geköpfte Frösche und Frösche, die in der Mitte durchtrennt waren. Wenn wir in den Garten meiner Eltern zurückkamen, war unser Korb bis oben hin voll, und Herr Weigoni mähte immer noch. Der Geruch von geschnittenem Gras und Benzin erfüllte die Luft. Mein Vater war inzwischen ins Haus geflüchtet, kam aber alle zehn Minuten heraus, um zu überprüfen, ob es endlich wieder still geworden war. Axel schüttete die Patienten auf die Apfelsinenkiste und zählte nach, wie viel Gliedmaßen wir gefunden hatten. Ich nahm zuerst die Bauchverletzungen. Sie bewegten sich nicht mehr und waren deswegen am einfachsten zu behandeln. Ich stopfte die Eingeweide zurück in die Bauchhöhle.
»Das könnte ich nie«, sagte Axel jedes Mal so angeekelt wie bewundernd, zog ein Stück Tesafilm von der Rolle ab und hielt es mir hin, damit ich es abschnitt. Ich klebte die Wunde zu und legte den Patienten in eines der orangen Betten. Die Stelle platzte sofort wieder auf und eine durchsichtige Flüssigkeit sickerte heraus. Auf der nassen Froschhaut hielt Tesafilm nicht gut. Ich drückte einen neuen Klebestreifen darüber, dann griff ich mir den nächsten Frosch. Die Arm- und Beinamputierten zappelten wie verrückt. Es gelang mir selten, die Gliedmaßen anzukleben, also legte ich die Patienten einfach so ins Bett. Sie wälzten sich sofort wieder heraus und humpelten mit ihren verbliebenen Beinen unter den Rhododendron. Wir verfolgten sie nicht weiter, legten ihnen bloß ihre abgehackten Beine, Hände und Füße unter den Busch, falls die Frösche sie sich später noch holen wollten. Das war der frustrierende Aspekt an unserem Spital: Bis zum nächsten Morgen hatten sich alle Patienten entweder aus dem Staub gemacht, oder sie waren tot. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir jemals auch nur einen einzigen geheilt hätten.
Es war nicht nur mein Vater mit seinen Rasenmähern – jeder in meiner Familie konnte irgendetwas nicht ertragen. Meine Mutter hasste hohe Frauenstimmen. Genau genommen hasste sie wohl die Stimme meiner Großmutter, die im halb ausgebauten Dachgeschoss unseres Hauses wohnte. Aber das sagte sie nie so direkt. Sie sagte immer nur:
»Diese kreischenden Stimmen, ich kann diese kreischenden Frauenstimmen nicht ertragen. Wie soll man dabei arbeiten?«
Meine Oma konnte das Geräusch nicht ertragen, das die Männer machten, die nachts in ihr Dachstübchen eindrangen. Sie behauptete, dass jede Nacht Männer zu ihr heraufkämen. Diese Männer rissen ihr heimlich Haare aus und nahmen die Deckel von den Töpfen, um damit über die Wandkacheln ihrer Küche zu scheppern. Das Erstaunlichste an der ganzen Sache war vielleicht, dass meine Oma weder Töpfe noch Küche besaß. Sie kochte gar nicht selbst, sondern aß mit bei uns unten.
Meine ältere Schwester hasste Vogelgezwitscher. Wenn sie über ihren Hausaufgaben saß, die Flüsse und Hügelketten einer Landkarte verschiedenfarbig bemalte, oder was man sonst so als Viertklässler aufbekam, schleuderte sie plötzlich die Wachsstifte zu Boden und rief: »Die Vögel, die verdammten Vögel! Wie soll man da arbeiten? Sie schreien die...
| Erscheint lt. Verlag | 14.12.2015 |
|---|---|
| Verlagsort | Köln |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Literatur ► Romane / Erzählungen |
| Schlagworte | Erinnerung • Erwachsenwerden • Familie • Frauen • Fräulein Nettes kurzer Sommer • Jugend-Liebe • Karen Duve • London • Macht • Probleme • Regenroman • Übergewicht • Vergangenheit |
| ISBN-10 | 3-462-31595-1 / 3462315951 |
| ISBN-13 | 978-3-462-31595-0 / 9783462315950 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 2,2 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich