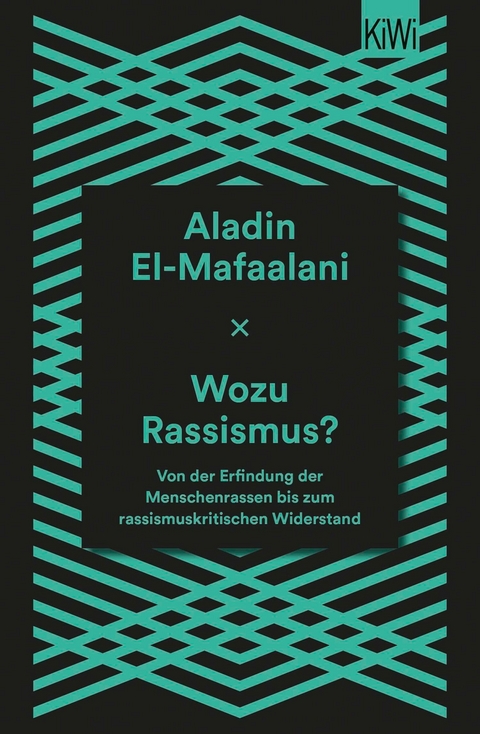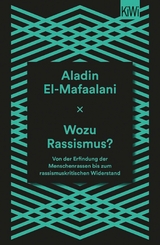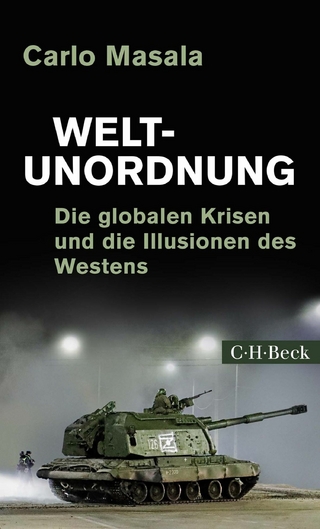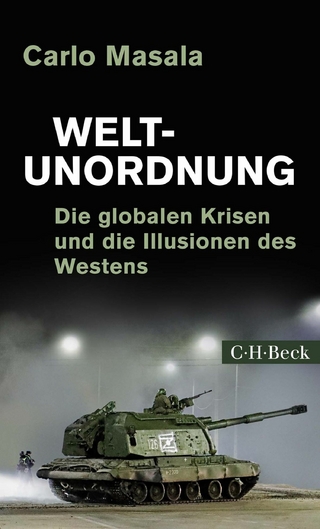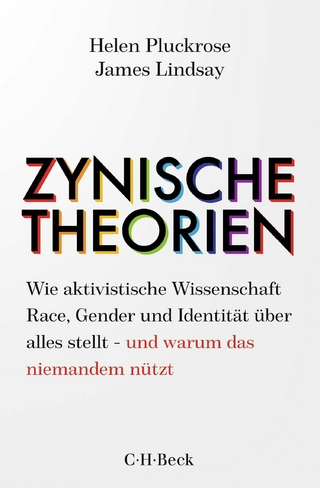Wozu Rassismus? (eBook)
192 Seiten
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH
978-3-462-30389-6 (ISBN)
Aladin El-Mafaalani, 1978 im Ruhrgebiet geboren, ist Professor für Migrations- und Bildungssoziologie an der TU Dormund. Nach dem Studium war er Lehrer am Berufskolleg Ahlen, dann Professor für Politikwissenschaft an der Fachhochschule Münster und später Abteilungsleiter im nordrhein-westfälischen Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration in Düsseldorf. Er studierte an der Ruhr-Universität Bochum Politikwissenschaft, Wirtschaftswissenschaft, Pädagogik und Arbeitswissenschaft und wurde dort in Soziologie promoviert. Er erhielt zahlreiche Auszeichnungen, zuletzt 2020 den Preis der Deutschen Gesellschaft für Soziologie für herausragende Leistungen auf dem Gebiet der öffentlichen Wirksamkeit der Soziologie.
Aladin El-Mafaalani, 1978 im Ruhrgebiet geboren, ist Professor für Erziehung und Bildung in der Migrationsgesellschaft am Institut für Migrationsforschung und interkulturelle Studien an der Universität Osnabrück. Nach dem Studium war er Lehrer am Berufskolleg Ahlen, dann Professor für Politikwissenschaft an der Fachhochschule Münster und später Abteilungsleiter im nordrhein-westfälischen Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration in Düsseldorf. Er studierte an der Ruhr-Universität Bochum Politikwissenschaft, Wirtschaftswissenschaft, Pädagogik und Arbeitswissenschaft und wurde dort in Soziologie promoviert. Er erhielt zahlreiche Auszeichnungen, zuletzt 2020 den Preis der Deutschen Gesellschaft für Soziologie für herausragende Leistungen auf dem Gebiet der öffentlichen Wirksamkeit der Soziologie.
2. Rassismus als Ideologie: Geschichte des Kolonialismus und Erfindung der Rassen(lehre) 25
Sich mit der Geschichte des Rassismus zu beschäftigen, ist wichtig, um die Entstehungskontexte, die Ursprünge, die Entwicklungen und schließlich die Kontinuitäten zu verstehen, aber auch die Brüche und Veränderungen. Diese sollen insbesondere mit Blick auf Europa und Deutschland skizziert werden.[10] Dabei bleiben die Analysen notwendigerweise grob und holzschnittartig. Es handelt sich bestenfalls um einen ersten Einstieg in das Themenfeld und soll dem Verständnis dienen, dass Rassismus eine Herrschaftsideologie ist, die zu den größten Exzessen der Menschheitsgeschichte geführt hat, aber auch als Erklärung seiner enorm weiten Verbreitung, seiner Wirkmächtigkeit und seiner Hartnäckigkeit. Die Welt, so wie sie sich heute darstellt, lässt sich nicht verstehen, ohne diese Geschichte zu kennen. Oder genauer: Die Welt lässt sich am besten rassistisch erklären, wenn man die Geschichte ignoriert.
Die ersten Züge einer Herrschaftsideologie, die die soziale Hierarchie zwischen ethnischen Gruppen als »natürlich« erscheinen ließ, finden sich bereits im antiken Griechenland. 26 Vor weit mehr als 2.300 Jahren versuchte Aristoteles, mit der Klimatheorie und der Theorie der Sklaverei zu begründen, weshalb es die Griechen sind, die herrschen, und warum alle anderen Völker Barbaren und zum Dienen bestimmt sind. Hierbei sollte es um eine natürliche Ordnung gehen, bei der körperliche, kognitive und moralische Eigenschaften gleichermaßen eine Rolle spielen, die wiederum mit geografischen und klimatischen Aspekten zusammenhängen. Unterschiedliche Hautfarben wurden bereits in der Antike erkannt, allerdings gab es noch keine systematische Hierarchie, was sich unter anderem daran ablesen lässt, dass die Slawen von den Griechen mit am stärksten versklavt wurden – das Wort Sklave stammt vom griechischen Wort für Slawe. Im europäischen Mittelalter waren religiöse und kulturelle Differenzen bereits schwarz-weiß codiert: Das Christentum wurde als weiß und europäisch imaginiert, der Islam als schwarz und nicht-europäisch.[11]
Die »rassistische Zeitrechnung« beginnt dann Ende des 15. Jahrhunderts im heutigen Spanien – nicht, weil Rassismus dort entsteht, sondern weil von dort aus eine rassistische Herrschaftsideologie an Wirkmacht gewinnt, dominant wird und damit die gesamte Welt prägt.[12] 1492 ist das Jahr der »Entdeckung« Amerikas und der Startschuss für Eroberung und Kolonialisierung, und es ist auch das Jahr der Reconquista, des Siegs der spanischen Krone über die Mauren, die jahrhundertelang die Iberische Halbinsel beherrschten, sowie der Vertreibung von Juden und Muslimen. Ende des 15. Jahrhunderts kommen also im Wesentlichen zwei Entwicklungen zusammen, die gleichermaßen für das Verständnis von 27 Rassismus zentral sind: die nationale Einheit Spaniens und der spanische Kolonialismus.
Nationale Einheit. Die Herausbildung des spanischen Staates ging einher mit einer zunehmenden Homogenisierung der Bevölkerung in mehrfacher Hinsicht: Spanisch ist, wer auf spanischem Boden Spanisch spricht und christlich ist. Territorium, Sprache und Religion spielen hier zusammen. Anschließend kam ein weiteres Kriterium dazu: die »Reinheit des Blutes« (limpieza de sangre). Wie kam das Blut ins Spiel? Viele auf spanischem Territorium lebende Juden, deren Muttersprache Spanisch war, konvertierten zum Christentum, weil es die einzige Möglichkeit war, der Vertreibung und dem christlichen Judenhass zu entkommen. Auf sie richtete sich später jedoch erneut der Hass, denn die Konvertierten überflügelten ökonomisch, aber auch im Hinblick auf ihre Bildung die »echten«, das heißt christlichen Spanier und wurden sogar vom Adel als Gefahr wahrgenommen. Der kulturelle und wirtschaftliche Erfolg sowie die damit einhergehenden Verteilungskonflikte erzeugten Neid und Erklärungsnot: Worin lag die Besonderheit, was war ihr Geheimnis? Die Antwort war so einfach wie zu der Zeit nicht widerlegbar: Es läge an ihrem jüdischen Blut, das sie gierig und zu einer Gefahr für diejenigen mit reinem Blut mache. Rein ist, wer weiß und christlich ist. Erstmals entstand eine biologisch-rassistische Argumentationsfigur, der man weder durch individuelle Erkenntnis oder Leistung noch durch Konversion entkam. Und zugleich wird deutlich, dass die Entstehung des modernen Antisemitismus, der nämlich nicht mehr religiös – wie der christliche Judenhass im Zuge der Reconquista –, sondern durch nicht veränderbare 28 (biologische) Unterschiede begründet wird, mit der Entstehung des Rassismus Hand in Hand geht. Von Beginn an spielen Biologie und Kultur zusammen – und hier insbesondere die drei abrahamitischen Religionen: Judentum, Christentum und Islam. Die rassistischen Erklärungen folgten einem Agglomerat von Ausgangsproblemen: auf der einen Seite aus politischen Problemstellungen, vor allem Fragen der nationalen Zugehörigkeit und Identität, auf der anderen Seite aus ökonomischen und sozialen Verteilungskonflikten. Weißsein wird ein Synonym für christliche Reinheit.[13]
Kolonialismus. Als 1492 Kolumbus bei dem Versuch, einen neuen Seeweg nach Indien zu finden, Amerika »entdeckte«, beginnt die Kolonialisierung Amerikas und die Versklavung und Vernichtung der indigenen Bevölkerung. Bereits Kolumbus zeigte überhaupt kein Interesse an den Menschen oder der Kultur, es fand kein Dialog zwischen ihnen und den Kolonialisten statt. Vielmehr wurden die Menschen unmittelbar zum Eigentum der spanischen Krone erklärt. Es folgten Zwangschristianisierungen und Versklavung. Über siebzig Prozent der indigenen Bevölkerung kamen ums Leben – überwiegend durch Krankheitserreger, denen die Menschen in Amerika schutzlos ausgeliefert waren, aber auch durch gezielten Völkermord. Da dadurch zu wenige versklavte Arbeitskräfte zur Verfügung standen, fanden bereits 1510 die ersten Deportationen von Sklaven aus Afrika nach Südamerika statt. Seither haben Millionen von ihnen die Überfahrt nicht überlebt. Im Zuge der Eroberung Lateinamerikas wurden enorme Reichtümer gestohlen, Kulturen vernichtet, Menschen getötet oder versklavt – all das erschien damals hochgradig legitim.[14]
29 Während die nationale Einheit zu einer Homogenisierung der spanischen Gesellschaft führte, wurde durch den Kolonialismus eine Gesellschaftsform etabliert, bei der die Hautfarbe die alles entscheidende Rolle spielte. Diese Entwicklungen fanden bereits vor der Aufklärung und vor der Entstehung des Kapitalismus statt. Allerdings haben Aufklärung und Kapitalismus den Rassismus und den Kolonialismus weiter stabilisiert und verstärkt.
Die Aufklärung spielt eine zentrale Rolle für das Verständnis von Rassismus und Kolonialismus. Religiöse, politische und ökonomische Gedanken, die bereits im 15. und 16. Jahrhundert entstanden waren, wurden nun rationalisiert, also wissenschaftlich fundiert. Schon im 16. und 17. Jahrhundert wurde das Rassekonzept vom Tier- und Pflanzenreich auf den Menschen übertragen. Auch die Vorstellung von der blutreinen Adelsrasse stammt aus dieser Zeit.[15] Im 18. Jahrhundert, dem Jahrhundert der Aufklärung, etabliert sich der Rassebegriff, und »Rassentheorien« werden entwickelt. In der Aufklärung fand die Suche nach »Rassenmerkmalen« ihren Höhepunkt. Die Besessenheit der Aufklärer, zu ordnen, zu klassifizieren und zu objektifizieren, führte dazu, dass Menschen nach Hautton geordnet, aber auch Schädel, Skelett, Augenform und Haarstruktur, die Geschlechtsorgane und die Körperbehaarung analysiert und in der Regel auch im Hinblick auf Charaktereigenschaften und Kompetenzen hierarchisiert wurden.[16] Immer stand die »Race der Weißen« (Kant) an der Spitze, und die anderen – mal waren es drei, mal über ein Dutzend anderer – Rassen wurden ihr untergeordnet. 1775 wurde die »Rassentheorie« von Immanuel Kant im 30 deutschen akademischen Sprachraum etabliert. Diese hatte er weitgehend selbst entwickelt, man muss also sagen, dass Kant nicht wie die allermeisten Aufklärer deshalb rassistisch war, weil er Kind seiner Zeit war, sondern er hat im Hinblick auf die Entwicklung der Rassenlehre seine Zeit geprägt.[17] Auf der untersten Stufe der Hierarchie standen für Kant die indigenen Völker Amerikas. Sie wurden kaum mehr als Menschen angesehen. Zumindest indirekt wurden so – aus dem Elfenbeinturm der Königsberger Universität – ihre Vernichtung, Enteignung und Versklavung legitimiert. Eine Stelle weiter oben standen die Bewohner Afrikas, und an zweiter Stelle die Inder, die aussähen wie Philosophen, aber nur die Künste beherrschten, nicht aber die Wissenschaft. Vollkommen ist laut Kant ausschließlich die »Race der Weißen«.[18]
Für Hegel war Afrika ein geschichtsloser Kontinent, ohne Kultur und Bedeutung. Er wusste um die großen antiken Hochkulturen in Karthago (dem heutigen Tunesien) und in Ägypten – zählte diese aber kurzerhand nicht zu Afrika. Dass Sklaverei unrecht sei, sagt er deutlich, allerdings müsse das Leben in Freiheit erst erlernt werden.[19] Zumindest indirekt ließ sich so die Haltung begründen, man nehme den Schwarzen nichts, sondern gebe ihnen mit der Kolonialisierung Kultur und die Fähigkeit zur Freiheit. Im...
| Erscheint lt. Verlag | 9.9.2021 |
|---|---|
| Verlagsort | Köln |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Geschichte / Politik ► Politik / Gesellschaft |
| Sozialwissenschaften ► Politik / Verwaltung | |
| Schlagworte | Anti-Rassismus-Training • Bestseller-Autor • Das Integrationsparadox • Gesellschaft • Herrschaftsdenken • Mythos Bildung • Populismus • Rassismus • Rassismuskritik • Soziologie |
| ISBN-10 | 3-462-30389-9 / 3462303899 |
| ISBN-13 | 978-3-462-30389-6 / 9783462303896 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 1,8 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich