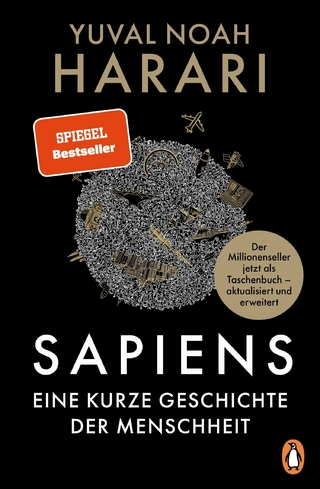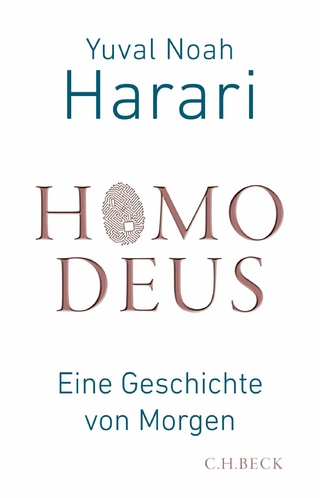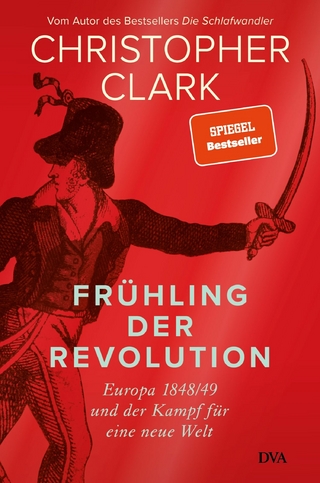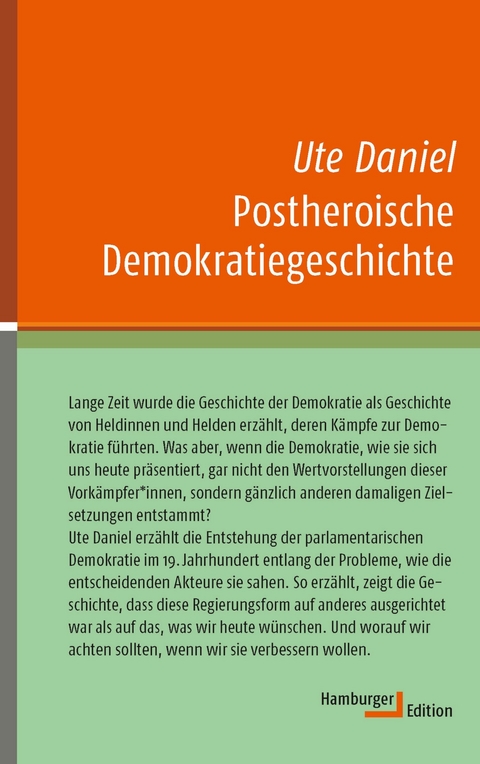
Postheroische Demokratiegeschichte (eBook)
168 Seiten
Hamburger Edition HIS (Verlag)
978-3-86854-977-5 (ISBN)
Die heroische Version zur Geschichte der parlamentarischen Demokratie hält sich hartnäckig: Diese Regierungsform habe sich durchgesetzt, weil unsere Vorfahren für ihre Rechte gekämpft haben. Unter dem Druck von Wahlrechts- und Protestbewegungen sei den Herrschenden abgezwungen worden, der breiten Bevölkerung Mitspracherechte einzuräumen.
Tatsächlich gab es diese mutigen Männer und Frauen, diese Protestbewegungen und Wahlrechtskämpfe; ihnen allen jedoch ist gemein, dass ihr Einfluss auf die real existierende Politik des 19. Jahrhunderts marginal war. Die parlamentarische Regierungsform ging aus gänzlich anders gelagerten Gründen hervor. Ihnen geht die Historikerin in ihrer postheroischen Politikgeschichte nach.
Ute Daniel ist Professorin für Neuere Geschichte an der TU Braunschweig, sie forscht zur Mediengeschichte, Geschlechtergeschichte, Sozial- und Kulturgeschichte der Kriege, Geschichte der Höfe und Hoftheater sowie zu Theorie und Methodologie der Geschichtswissenschaft.
Vorbemerkung:
Doch, man kann aus der Geschichte lernen …
Die Kipppunkte: 1866/67
Deutschland
Pinnwand: Thesen und anderes mehr
Großbritannien
Pinnwand: Thesen und anderes mehr
Davor
Großbritannien
Pinnwand: Thesen und anderes mehr
Deutschland
Pinnwand: Thesen und anderes mehr
Danach
Deutschland
Pinnwand: Thesen und anderes mehr
Großbritannien
Pinnwand: Thesen und anderes mehr
Nachbemerkung
Literatur
Dank
Zur Autorin
| Erscheint lt. Verlag | 6.4.2020 |
|---|---|
| Reihe/Serie | kleine reihe - kurze Interventionen zu aktuellen Themen |
| Verlagsort | Hamburg |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Geschichte / Politik |
| Sozialwissenschaften ► Politik / Verwaltung | |
| Schlagworte | Mitsprache • Parlamentarische Demokratie • Parlamentarismus • Parteien • Partizipation • Protestbewegung • Regierungsform • wahlrechtsreformen |
| ISBN-10 | 3-86854-977-3 / 3868549773 |
| ISBN-13 | 978-3-86854-977-5 / 9783868549775 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 688 KB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich