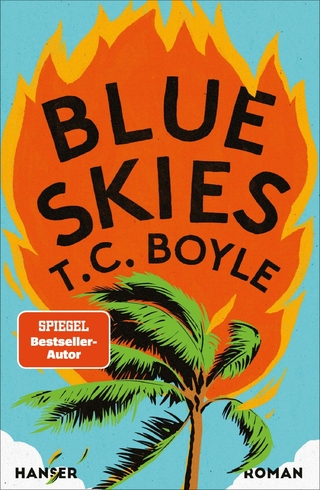Wir, die Überlebenden (eBook)
416 Seiten
Luchterhand Literaturverlag
978-3-641-25163-5 (ISBN)
Tash Aw wurde als Kind malaysischer Eltern 1971 in Taiwan geboren und wuchs in Kuala Lumpur auf. Er studierte Jura in Großbritannien, veröffentlichte mehrere Romane und wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, u. a. dem Commonwealth Writers' Prize und dem Whitbread First Novel Award, und zweimal für den Man Booker Prize nominiert. Sein Werk ist in 23 Sprachen übersetzt. Tash Aw lebt vorwiegend in der Provence und kommentiert u. a. für die »New York Times« und die BBC Kultur und Politik im südostasiatischen Raum.
2. Oktober
Sie möchten, dass ich über das Leben spreche, aber bis jetzt habe ich nur über das Scheitern gesprochen, als wäre beides dasselbe oder zumindest so eng miteinander verflochten, dass ich es nicht auseinanderhalten kann, wie die Bäume in den halb zerfallenen Gebäuden von Old Town. Ihre Wurzeln klammern sich an die Außenwände und halten Backsteine, Gemäuer und was immer von der Farbe übrig ist zusammen, ihre Zweige fressen sich durch die Löcher in den Dächern. Manchmal ist vom Dach, wenn man es überhaupt als solches bezeichnen kann, kaum noch etwas übrig, nur Splitter von Tonziegeln oder rostiges Blech, das vom Blätterdach gestützt wird. Ein paar Meilen vor der Stadt, auf der anderen, dem Meer zugewandten Seite von Kapar, gibt es ein Shophouse, um dessen Eingangssäulen sich die Wurzeln eines Feigenbaums winden. Der Baum hat den gesamten Gebäudekomplex verschluckt, so dass der Eingangsbereich jetzt bloß ein dunkler Raum ist, durch den man ins Herz eines gewaltigen Blättergeflechts gelangt. Wo fängt das eine an und hört das andere auf? Welches ist lebendig und welches tot? Immerhin wird es im Erdgeschoss noch Geschäfte geben, Läden oder kleine Betriebe, wo ein alter Mann einem für zwanzig Ringgit die Reifen flickt. Eine Druckerei, die billige Flugblätter herstellt, auf denen der Räumungsverkauf eines Geschäfts im örtlichen Einkaufszentrum angezeigt wird. Oder eine Konditorei mit nur zwei Stücken kuih lapis in der Kühlvitrine, die da schon seit drei Wochen ausliegen. Die Keksschachteln in den Regalen sind von einer Staubschicht aus den nahegelegenen Baustellen bedeckt, wo die neue Trasse oder das neue Einkaufszentrum oder weiß Gott was gebaut wird. Seit zwanzig Jahren haben diese Leute kein ordentliches Einkommen. Sie sind jetzt fünfundsiebzig oder achtzig Jahre alt. Noch leben sie, aber ihre Geschäfte werden von einem Baum übernommen. Stellen Sie sich das vor.
In der Nacht nach dem Mord – oder der fahrlässigen Tötung, die nicht mit Mord gleichzusetzen ist, wie Sie es höflicherweise ausdrücken – lief ich stundenlang durch die Dunkelheit. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie lange. Ich versuchte, irgendein Gefühl für die Zeit zu bekommen und suchte am Himmel immer wieder nach Vorboten der Morgendämmerung, ging sogar schneller, damit sich jeder Schritt wie eine volle Sekunde anfühlte, wie das Ticken der Uhr dort an der Wand, das in diesem Moment so schnell zu sein scheint. Ticktack, ticktack. Aber in jener Nacht dehnte sich jede Sekunde zu einer vollen Minute aus, jede Minute kam mir vor wie ein ganzes Leben, und ich konnte nichts tun, um die Dinge zu beschleunigen.
Mein Hemd war nass, nicht einfach feucht, sondern klitschnass, und klebte an meinem Rücken wie eine zweite Haut. Nur gehörte diese Haut nicht zu mir, sondern zu einem anderen lebenden Organismus; kalt und schwer drückte sie mich nieder. Während ich mich immer weiter von dem entfernte, was ich inzwischen als Schauplatz des Verbrechens betrachte (anders als damals, da war es nur ein dunkler Fleck am Flussufer, nicht zu unterscheiden von jedem anderen), horchte ich auf die Sirenen der Polizeiwagen, ich meinte, ich müsste sie jede Sekunde hören. Sie kommen mich holen, dachte ich immer wieder, das ist das Ende, die mata wird mich finden und für immer ins Gefängnis stecken. Es ist aus, du bist erledigt, sagte ich laut. Es beruhigte mich, meine eigene Stimme zu hören. Nichts hatte sich jemals so absolut und sicher angefühlt. Die Polizei würde kommen, sie würde mich einsperren, und von da an wären alle meine Tage gleich. Die Vorstellung, bis an mein Lebensende in einer leeren kleinen Zelle zu sein, wo ich mir um nichts Gedanken machen musste, war tröstlich. Jeden Morgen würde ich beim Aufwachen dieselben Wände sehen, die am Abend vor dem Einschlafen auch schon da waren. Nichts würde sich jemals ändern. Was ich anzog, wie lange ich nachts schlief, wie oft ich essen, mich waschen oder aufs Klo gehen konnte – alle Entscheidungen würden mir abgenommen, ich wäre genauso wie alle anderen auch. Jemand würde die Kontrolle über mein Leben übernehmen, und so würde meine Geschichte enden. Irgendwas in mir wünscht sich noch immer, es wäre so gekommen.
Ich lief durch das hohe Gras, das faserig war und scharf und mir bis zu den Knien in die Beine schnitt. Es war heiß, ich trug kurze Hosen, meine Haut brannte. Zwei- oder dreimal überquerte ich eine Brücke und ging auf der anderen Uferseite weiter. Zuerst suchte ich mein Auto, dann wurde mir bewusst, dass ich mich nur so weit wie möglich vom Schauplatz des Verbrechens entfernen wollte. Das einzige Problem war, dass ich mich nicht erinnern konnte, wo es passiert war. Irgendwann spürte ich Schlamm zwischen den Zehen und merkte, dass ich eine Sandale verloren hatte, sie musste im sumpfigen Boden stecken geblieben sein, daher schüttelte ich auch die andere ab und ging barfuß weiter. Es war spät, aber nicht so spät, dass es keinen Verkehr auf den Schnellstraßen weiter weg oder den Brücken über mir gab. Gelegentlich streiften die Scheinwerfer die Wipfel der Bäume, und ich sah kleine Details, Dinge, die mir bei Tag gar nicht aufgefallen wären; Drachen mit ewig lächelnden Vogelgesichtern, die sich in den Ästen verfangen hatten, und Unmengen von Plastiktüten, die wie geschwollene, gespenstische Früchte in den Zweigen hingen.
Manchmal sah ich seltsame Gebilde, die in der Mitte des Flusses trieben. Baumstämme und Büsche, die von den Stürmen flussaufwärts entwurzelt worden waren, hatten sich zu riesigen Flößen verheddert und sahen aus wie mythische Wesen aus Die Reise nach Westen, dieser Unsinn, den Erwachsene Kindern erzählen, um ihnen Angst zu machen, damit sie gehorchen, den aber kein Mensch ernst nimmt, nicht mal Kinder – welches Kind glaubt schon an Käfer mit neun Köpfen? –, bis man eines Nachts allein an einem Flussufer entlanggeht und diese schrecklichen Ungeheuer zur Realität werden. Andere Male sah ich direkt neben mir, im Schilf hängend, ein totes Wesen, einen Körper, der so aufgedunsen war, dass ich nicht mal hätte sagen können, was es war, eine Katze vielleicht oder ein Affe. Wenn ein Körper lange genug im Wasser liegt, geben seine Konturen nach, die Ränder lösen sich auf, bis es unmöglich wird, ein Tier vom anderen zu unterscheiden.
Mein Arm schmerzte, ich ging irgendwie komisch, eine Seite meines Körpers war weniger beweglich als die andere. Dann merkte ich, dass ich noch immer das Stück Holz in der Hand hielt, das mir kurz zuvor so leicht erschienen war, jetzt aber einen Zentner zu wiegen schien. Während der Verhandlung, als die Leute im Gerichtssaal auf die Tatwaffe, die niemals gefunden wurde, zu sprechen kamen, dachte ich an den knapp siebzig Zentimeter langen, feuchten Stock, den ich in jener Nacht bei mir hatte. Es war nur ein abgebrochener Ast. Als ich vor ein paar Stunden damit auf den Mann eingeschlagen hatte, war er mir so harmlos vorgekommen, dass ich es nicht für möglich hielt, damit jemanden verletzen zu können. Ich hatte erwartet, dass er zerbrach und der Mann mich wegen der lächerlichen Wahl meiner Waffe auslachte. Jetzt hatte ich das Gefühl, als schleppte ich einen ganzen Baum mit, als hinge die Last der Welt an seinen Wurzeln. Ich hob den Arm, um ihn in die Mitte des Flusses zu schleudern, musste aber feststellen, dass ich plötzlich keine Kraft mehr im Körper hatte. Er glitt mir aus der Hand und fiel höchstens einen Meter neben mir auf den Boden.
Nach einer Weile wurde mir klar, dass die Polizei nicht kommen würde. Niemand würde kommen, um mich zu holen. Nicht in jener Nacht, nicht am folgenden Tag und vielleicht auch nach Wochen nicht. Am Ende brauchten sie mehr als zwei Monate, um mich zu verhaften, aber das wissen Sie ja. Und auch, warum es so lange dauerte. Wenn das Opfer so einer ist, kümmert sich die Polizei nicht wirklich darum. Ja, so einer. Ein Ausländer. Ein Illegaler. Jemand mit dunkler Hautfarbe.
Aus Bangladesch, Myanmar oder Nepal. Für die Polizei sind sie alle gleich. Selbst Afrikaner. Als kämen alle von demselben großen namenlosen Kontinent. Als ich noch in Puchong lebte, sah ich einmal eine Gruppe von Afrikanern, die sich am Straßenrand versammelt hatte, etwa ein Dutzend Männer. Manche saßen auf dem Pflaster, andere standen daneben, lachten, scherzten, tranken Bier und Schnaps. Ein oder zwei tanzten; sie hatten einen großen Ghettoblaster dabei, und ihre Musik war so laut, dass ich meine eigene kaum hören konnte. Ich hörte Jacky Cheung auf dem Handy; damals hatten wir nur diese kleinen Dinger von Sony Ericsson, auf denen die Songs schepperten, als kämen sie über einen Radiosender aus einem weit entfernten Land. Vielleicht sind Sie zu jung, um sich an diese Handys zu erinnern. Ich stand mit Keong auf der anderen Straßenseite, vor dem 7-Eleven, und aß einen Ramly-Burger. Das ist siebzehn, achtzehn, vielleicht auch schon zwanzig Jahre her. Damals gab es hier noch nicht so viele Afrikaner. Die Leute wussten nichts über sie – aus welchen Ländern sie kamen, wieso sie hier waren. Wenn man damals jemand fragte, woran er bei dem Wort Afrika dachte, antwortete er: Löwen.
Keong starrte auf sein Handy, tat so, als ginge ihn das alles nichts an, als wäre er mit Schwarzen aufgewachsen. Trotzdem konnte er sich seine Kommentare nicht verkneifen. Wahlau, Muhammad Ali hat all seine Freunde mitgebracht! Ich weiß noch, wie ich lachte, obwohl ich es überhaupt nicht lustig fand. Wahrscheinlich machte auch ich irgendwelche Bemerkungen. Es ist lange her, ich weiß es nicht mehr. In jener Nacht ging eine leichte Brise, daran erinnere ich mich. Neben uns schloss gerade ein alter Inder seinen Stand. Das Geschäft lief nicht...
| Erscheint lt. Verlag | 26.4.2022 |
|---|---|
| Übersetzer | Pociao, Roberto Hollanda |
| Sprache | deutsch |
| Original-Titel | We, the Survivors |
| Themenwelt | Literatur ► Romane / Erzählungen |
| Schlagworte | 2022 • Armut • eBooks • Edouard Louis • einfacher Fischer • Gewalt • Interview • Kuala Lumpur • Lebensbeichte • Mörder • Neuerscheinung • Preisgekrönter Autor • Roman • Romane • Schicksal • Stendhal • Südostasien |
| ISBN-10 | 3-641-25163-X / 364125163X |
| ISBN-13 | 978-3-641-25163-5 / 9783641251635 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 1,2 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich