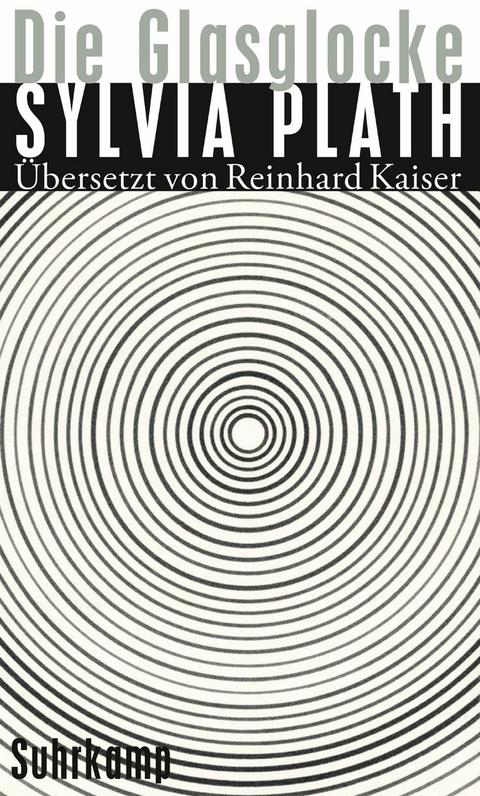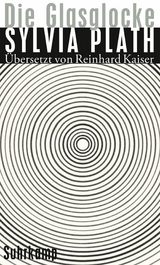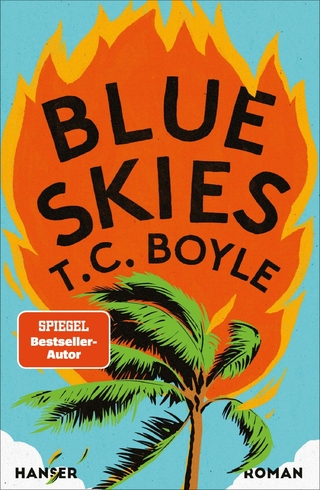Die Glasglocke (eBook)
262 Seiten
Suhrkamp (Verlag)
978-3-518-73144-4 (ISBN)
<p>Die Dichterin Sylvia Plath, geboren 1932 in Boston, verheiratet mit dem Dichter Ted Hughes, wurde nach ihrem Selbstmord 1963 in London mit dem Roman <em>Die Glasglocke</em> und dem Gedichtband <em>Ariel</em> zu einer internationalen Ikone der Frauenbewegung.</p>
Sechs
Ich hatte Buddy immer wieder gebeten, mir in seinem Krankenhaus mal ein paar wirklich interessante Sachen zu zeigen, also schwänzte ich eines Freitags meinen Unterricht und fuhr für ein langes Wochenende hinüber, und er gab sich Mühe, mir etwas zu bieten.
Es fing damit an, daß ich mir einen weißen Kittel überzog und auf einem hohen Hocker in einem Raum mit vier Leichen saß, während Buddy und seine Freunde sie aufschnitten. Diese Leichen sahen so wenig wie Menschen aus, daß sie mir überhaupt nichts ausmachten. Sie hatten eine ledrig steife, purpurschwarze Haut und rochen wie alte Gläser mit eingelegten Gurken.
Nachher führte mich Buddy einen Gang entlang, wo einige große Glasflaschen mit Babys, die vor der Geburt gestorben waren, standen. Das Baby in der ersten Flasche hatte einen großen weißen Kopf, der sich über einen kleinen, eingerollten Körper von der Größe eines Frosches beugte. Das Baby in der nächsten Flasche war größer, das Baby in der übernächsten Flasche war noch größer, und das Baby in der letzten Flasche war so groß wie ein normales Baby und schien mich mit einem Schweinchenlächeln anzusehen.
Ich war ziemlich stolz, wie ruhig und gelassen ich all die grauslichen Dinge betrachtete. Nur einmal zuckte ich, als ich mich nämlich mit dem Ellbogen auf den Bauch von Buddys Leiche gestützt hatte, um besser sehen zu können, wie er die Lunge sezierte. Gleich darauf spürte ich dieses Brennen an meinem Ellbogen, und plötzlich kam es mir vor, als wäre die Leiche womöglich noch halb lebendig, da sie doch offenbar noch warm war. Ich stieß einen kleinen Schrei aus und rutschte von meinem Hocker herunter. Doch Buddy erklärte mir, das Brennen komme von der Konservierungsflüssigkeit, und ich nahm meinen Platz wieder ein.
Vor der Mittagszeit nahm mich Buddy noch mit in eine Vorlesung über Sichelzellenanämie und andere deprimierende Krankheiten, bei der sie kranke Leute in Rollstühlen auf das Podium schoben, ihnen Fragen stellten, sie wieder wegschoben und Farbdias zeigten.
Ich erinnere mich an ein Dia von einem hübschen, lachenden Mädchen mit einem schwarzen Muttermal auf der Wange. »Zwanzig Tage nach dem Erscheinen dieses Muttermals war das Mädchen tot«, sagte der Doktor, und alle wurden einen Moment lang still. Dann klingelte es, so daß ich nie erfahren habe, was es mit dem Muttermal auf sich hatte und warum das Mädchen gestorben war.
Nachmittags sahen wir uns an, wie ein Baby geboren wird.
Zuerst öffneten wir im Flur des Krankenhauses einen Wäscheschrank, aus dem Buddy eine weiße Maske für mich und etwas Gaze nahm.
Ein großer, dicker Medizinstudent, ein Klotz wie Sidney Greenstreet, trieb sich in der Nähe herum und sah zu, wie Buddy mir die Gaze um den Kopf wickelte, bis mein Haar ganz darunter verschwunden war und nur noch meine Augen über der weißen Maske hervorlugten.
Der Medizinstudent gab ein unfreundliches Kichern von sich. »Hauptsache, deine Mutter liebt dich«, sagte er.
Ich war ganz erfüllt von dem Gedanken, wie dick er war und wie traurig eine solche Beleibtheit für einen Mann, vor allem für einen jungen Mann, sein müsse, denn welcher Frau würde es schon gefallen, sich beim Küssen über diesen gewaltigen Bauch zu lehnen, und bekam deshalb nicht gleich mit, daß das, was der Student zu mir gesagt hatte, eine Beleidigung sein sollte. Als ich endlich begriffen hatte, daß er sich offenbar ziemlich toll vorkam, und mir eine bissige Bemerkung darüber, daß gerade dicke Männer wohl nur von ihren Müttern geliebt würden, zurechtgelegt hatte, war er schon wieder verschwunden.
Buddy studierte eine merkwürdige Holztafel an der Wand, die mit einer Reihe von Löchern versehen war, angefangen bei einem Loch in der Größe eines Silberdollars bis zu einem Loch in der Größe eines Tellers.
»Gut, gut«, sagte er zu mir. »Da bekommt jetzt bald jemand ein Baby.«
An der Tür des Kreißsaals stand ein schmaler Medizinstudent mit hängenden Schultern, den Buddy kannte.
»Hallo, Will«, sagte Buddy. »Wer hat Dienst?«
»Ich«, sagte Will mit düsterer Miene, und ich bemerkte kleine, glänzende Schweißperlen auf seiner hohen, bleichen Stirn. »Ich – und es ist mein erstes.«
Buddy erzählte mir, Will studiere im dritten Jahr und müsse acht Babys entbinden, bevor er seinen Abschluß machen könne.
Wir bemerkten eine Unruhe am anderen Ende des Flurs, und in einer hastigen Prozession schoben mehrere Männer in lindgrünen Kitteln mit Kappen auf dem Kopf und ein paar Schwestern ein Bett mit einer unförmigen weißen Masse auf uns zu.
»Sie sollten sich das nicht ansehen«, murmelte Will mir ins Ohr. »Sonst werden Sie nie ein Baby haben wollen. Man sollte Frauen nicht dabei zusehen lassen. Es wäre das Ende der Menschheit.«
Buddy und ich lachten, Buddy schüttelte Will die Hand, und wir betraten den Saal.
Beim Anblick des Tisches, auf den sie die Frau hoben, verschlug es mir die Sprache. Er sah aus wie eine scheußliche Folterbank, an einem Ende diese schräg in die Höhe stehenden Metallbügel, am anderen Ende ein Gewirr von allen möglichen Apparaten, Drähten und Schläuchen.
Buddy und ich standen ein paar Meter von der Frau entfernt am Fenster, von wo wir eine ausgezeichnete Sicht hatten.
Der Bauch der Frau wölbte sich so hoch, daß ich ihr Gesicht und ihren Oberkörper überhaupt nicht sehen konnte. Sie schien nur aus einem gewaltigen, spinnenfetten Bauch und zwei häßlichen spindeldürren Beinchen zu bestehen, die in die hohen Bügel gespannt wurden, und während das Baby geboren wurde, gab sie immerzu dieses unmenschlich klingende Stöhnen von sich.
Später sagte mir Buddy, die Frau habe unter Medikamenten gestanden, die sie den Schmerz nicht hatten spüren lassen, und als sie geflucht und gestöhnt habe, da sei sie in einer Art Halbschlaf gewesen und habe nicht wirklich mitbekommen, was eigentlich los war.
In meinen Ohren klang das genau nach jener Art von Medikament, die nur ein Mann erfinden konnte. Da lag eine Frau mit fürchterlichen Schmerzen und spürte diese Schmerzen offenbar genau, sonst hätte sie nicht so gestöhnt, aber später ging sie nach Hause und fing gleich mit dem nächsten Kind an, weil das Medikament sie den schrecklichen Schmerz vergessen ließ, während doch die ganze Zeit irgendwo im verborgenen in ihr dieser lange Schmerzensgang ohne Türen und Fenster nur darauf wartete, sich wieder zu öffnen und sie von neuem einzuschließen.
Der Chefarzt, der Will überwachte, sagte immer wieder zu der Frau: »Sie müssen pressen, Mrs. Tomolillo, pressen, ja, braves Mädchen, pressen«, und schließlich sah ich an der gespaltenen, rasierten, durch das Desinfektionsmittel grell leuchtenden Stelle zwischen den Beinen etwas dunkles Wuscheliges auftauchen.
»Der Kopf des Babys«, flüsterte mir Buddy unter dem Stöhnen der Frau zu.
Aber der Babykopf blieb aus irgendeinem Grund stecken, und der Arzt sagte zu Will, er müsse einen Schnitt machen. Ich hörte, wie sich die Schere in der Haut der Frau vorarbeitete, und dann begann Blut zu fließen – ein leuchtendes, helles Rot. Und plötzlich schien das Baby hervorzuplumpsen, direkt in Wills Hände, pflaumenblau, mit einem weißen Zeug überzogen, blutig, und Will stammelte immer wieder erschrocken: »Ich laß es fallen. Ich laß es fallen. Ich laß es fallen.«
»Nein, wieso denn?« sagte der Arzt, nahm Will das Baby aus den Händen und begann es zu massieren. Die blaue Färbung verschwand, mit einer verloren klingenden, krächzenden Stimme begann das Baby zu schreien, und ich konnte sehen, daß es ein Junge war.
Als erstes pinkelte es dem Arzt ins Gesicht. Später sagte ich zu Buddy, ich könnte nicht verstehen, wie das möglich sei, aber er erklärte mir, es sei durchaus möglich, wenn es auch nicht sehr oft vorkomme.
Sobald das Baby da war, teilten sich die Leute im Raum in zwei Gruppen, die Schwestern banden ihm eine blecherne Hundemarke um das Handgelenk und wischten ihm mit einem Wattebausch am Ende eines Stäbchens die Augen aus, wickelten es in Tücher und legten es in ein mit Leinen gefüttertes Bettchen, während sich der Arzt und Will daran machten, den Schnitt in der Frau mit einer Nadel und einem langen Faden zu vernähen.
Ich glaube, jemand sagte: »Es ist ein Junge, Mrs. Tomolillo«, aber die Frau antwortete nicht und hob auch nicht den Kopf.
»Na, wie war's?« fragte mich Buddy mit zufriedener Miene, als wir über den grünen Innenhof zu seinem Zimmer gingen.
»Herrlich«, sagte ich. »So was könnte ich mir jeden Tag ansehen.«
Ich getraute mich nicht, ihn zu fragen, ob man Babys auch auf andere Weise bekommen könnte. Aus irgendeinem Grund schien es mir das wichtigste zu sein, wirklich zu sehen, wie das Baby aus einem herauskam, um sicherzugehen, daß es das eigene war. Ich dachte, wenn man ohnehin all die Schmerzen aushalten muß, kann man ebensogut wach bleiben.
Ich hatte mir immer vorgestellt, ich würde mich auf dem Entbindungstisch mit den Ellbogen langsam aufrichten, wenn es vorüber war – totenbleich natürlich und ohne Make-up nach dieser Quälerei, aber lächelnd und strahlend, das Haar hinge mir bis zur Taille herab, und dann würde ich die Hände nach meinem ersten sich windenden kleinen Kind ausstrecken und seinen Namen sagen, wie immer er lauten mochte.
»Warum war es ganz mit Mehl überzogen?« fragte ich schließlich, um das Gespräch in Gang zu halten, und Buddy erzählte mir von der talgartigen Substanz, die die Haut von Babys schützt.
Als wir in Buddys Zimmer waren, das mich mit seinen kahlen Wänden, dem kahlen Bett, dem kahlen Fußboden und dem mit Grays...
| Erscheint lt. Verlag | 21.1.2013 |
|---|---|
| Übersetzer | Reinhard Kaiser |
| Verlagsort | Berlin |
| Sprache | deutsch |
| Original-Titel | The Bell Jar |
| Themenwelt | Literatur ► Romane / Erzählungen |
| Schlagworte | 1953 • 20. Jahrhundert • Depression • Frauen • Gesellschaft • Glasglocke • Kult • Lyrikerin • Magazin • Mode • New York • Party • Roman • Sommer • Studentin • Sylvia Plath • The Bell Jar deutsch • USA • Vereinigte Staaten von Amerika USA • Zerrissenheit |
| ISBN-10 | 3-518-73144-0 / 3518731440 |
| ISBN-13 | 978-3-518-73144-4 / 9783518731444 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 2,7 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich