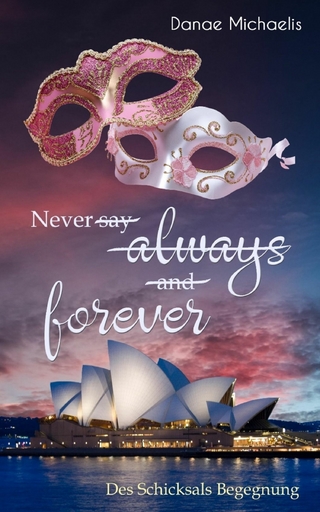2
Bis vor kurzem wohnte ich im Süden des Landes in einem
Tal. Es ist eng, und der Fluss an seinem Grund ist fast immer trocken. Das Meer ist nicht weit. Ich konnte es von der Haustür aus sehen. Wie eine graue, dreieckige Mauer verschließt es den Einschnitt der bergigen Landschaft an seinem Ende. Manchmal, bei Wind, ging ich die Straße hinunter bis zu ihrem Fuß und lauschte den Wellen. Ich hatte das Gefühl, dass sie lauter geworden waren in letzter Zeit, dass die eine oder andere Woge bereits dabei war, mit ihrem großen, feuchten Rachen das Land zu verschlingen. Dann fiel es mir schwer, meine Angst zu bekämpfen. Ich wich zurück und ging mit schnellen Schritten wieder in diese kleine Wohnung, die ich mein Zuhause nannte, weil mir kein besseres Wort einfiel für den Platz, an dem ich meine häufig schlaflosen Nächte verbrachte.
Seitlich am Ende des Tals liegt die Stadt. Sie erinnert aus der Entfernung an ein abstraktes Gemälde, das ein Künstler mit großem Geschick auf die Leinwand des Himmels gemalt hat. Weiße und hellbraune Rechtecke verschiedener Größe überlappen sich. Trapeze und kleine schwarze Quadrate lockern, über das Bild verstreut, den malerischen Eindruck auf. Doch dieser Anblick täuscht. Nähert man sich, verwandelt sich die scheinbar so raffiniert gestaltete Fläche in ein räumliches Objekt. Man gewahrt plötzlich Häuser mit Türen und Fenstern, scheinbar wahllos aufeinander getürmt und ineinander verschachtelt. Treppen und schmale Gassen bilden zusammen mit den Wohn-, Arbeits- und Vorratsräumen ein verwinkeltes Labyrinth, in dem Menschen wie Mollusken umherkriechen, als hätten sie kein anderes Ziel wie das, sich in einer schützenden Schale zu verbergen.
Die Stadt liegt auf einem Felsen, der wie eine mächtige, geballte Faust ins Meer hinausragt. Sie ist uralt und von der Schönheit eines zu Stein gewordenen Traums. Ich habe mir anfangs, als ich sie zum ersten Mal vor mir liegen sah, gewünscht, dort für immer zu bleiben, über eine dieser schmalen Wendeltreppen mein eigenes Zimmer zu erreichen, einen kahlen Raum mit meterdicken Mauern, von Fensterhöhlen durchbrochen, durch die man aufs gleißende Meer hinausblickt. Aber es ist zu gefährlich, in einem Traum zu leben. Man verlernt dabei das Erwachen. Man existiert schließlich nur noch halb, wie ein Somnambuler auf dem schmalen Grat zwischen Tod und Leben.
Außerdem bemerkte ich bald, dass die Einheimischen wenig übrig haben für Fremde. Sie empfinden sie als Eindringlinge, gar als Usurpatoren. Die Leute sind zwar nicht unfreundlich. Bereitwillig helfen sie, wenn man sich nach dem Weg erkundigt, nachdem man mehrfach in die Irre gegangen ist. Aber sie tun dies vermutlich nur, weil sie möchten, dass man aus ihrer Stadt hinausfindet, um endlich ganz zu verschwinden.
Ich begreife diese Einstellung nur zu gut. Allzu viele Erholungssuchende kommen im Sommer und mieten sich ein in diesem weiß schimmernden Termitenbau. Manche kaufen auch Wohnungen, obwohl sie fast unerschwinglich teuer sind. Und so besteht die Gefahr, dass die ganze Stadt eines Tages zu einer Kulisse für ein fremdes Theaterstück wird, in dem die Hauptfiguren einzig und allein dem Egoismus ihrer Lustgefühle huldigen. Ein langweiliges Stück, das die wenigen alteingesessenen Fischer und Bauern zu Statisten macht.
Ich hatte mir aus all diesen Gründen eine Wohnung vor der Stadt gesucht, jedoch nicht zuletzt auch deshalb, weil ich mir so die Möglichkeit erhalten wollte, ihre allabendliche Rückverwandlung in ein Traumbild zu erleben. Zweck meines Aufenthaltes war, Muße zu finden für die Arbeit an einem Buch, das zu schreiben mir wichtig schien, hatte es doch indirekt mit dem Beruf meines Vaters zu tun, der Seemann gewesen war. Mein Verleger hatte mir einen ungewöhnlich hohen Vorschuss zukommen lassen, ein Indiz dafür, welchen kommerziellen Erfolg er sich von dem Projekt versprach. Es sollte um das Leben eines berühmten Piraten gehen. Ich versprach mir von meinem derzeitigen Wohnort Inspiration, war er doch einst immer wieder von Seeräubern überfallen worden. Statt jedoch zügig an die Arbeit zu gehen, verfiel ich mehr und mehr in einen für mich ungewöhnlichen Zustand empfindlichen Nichtstuns. Ich begann, viel spazieren zu gehen oder in den Bars zu stehen, als wartete ich auf etwas, das mir im Grunde gleichgültig war.
Es gibt einen kleinen Hafen unterhalb der Stadt. Nur noch wenige Fischerboote liegen dort. Den meisten Platz besetzen im Sommer die Motorboote der Fremden, die die Stadt als Sommerresidenz benutzen. Im Winter jedoch ist der Hafen immer noch ein geheimnisvoller Ort, an dem ich mich damals besonders gerne aufhielt. Hier schien mir mein zu einer leeren Hülse erstarrtes Warten sinnvoller zu sein als anderswo.
Das Weiß der Häuser dieser Stadt, vor der ich damals lebte, lässt sie im Sonnenschein leuchten wie eine unwirkliche Erscheinung. Vogelfelsen haben oft diese Farbe, weil sie der kalkhaltige Kot ihrer Bewohner bedeckt. Es ist keine Farbe der Unschuld, keine Beschwörung der graphischen Wirkung von Licht und Schatten, kein Versuch, der Sommerhitze den Zutritt zu erschweren. Es ist vielmehr die Farbe der Trauer, wie sie nach dem Verlust eines geliebten Menschen in Ländern getragen wird, denen christliche Missionare nicht die Schwarzmalerei ihrer Religion aufzuzwingen vermocht hatten. Die Einwohner streichen jedes Jahr im Frühling ihre Häuser mit Kalkfarbe, weil wieder ein Jahr verloren ist, davongeflogen, ohne mehr zu hinterlassen als die brüchigen Schalen eines Eis, aus dem der Vogel geschlüpft ist. Schicht um Schicht bedeckt dieses Weiß das uralte Mauerwerk, um daran zu erinnern, dass die Vergänglichkeit eine gefräßige Riesenkrake ist, die zuweilen aus dem Meer auftaucht und die Menschen mit ihren langen Polypenarmen aus ihren Kammern und Betten reißt, um sie in ihrem schnabelförmigen Maul zu zerquetschen. Vielleicht haben die Bewohner der weißen Stadt Angst vor diesem Untier. Vielleicht sitzen sie deshalb des Abends nach Sonnenuntergang oft auf den kleinen Steinbänken der nach Westen gelegenen schmalen Plätze und starren schweigend auf die See hinaus, auf ihren von der Abendbrise blind gewordenen Spiegel.
Manchmal setzte ich mich zu ihnen auf die Bank, wobei ich sorgfältig darauf achtete, ein wenig Abstand zu halten, denn ich spürte ihr Misstrauen wohl. Auch ich starrte dann aufs Meer und fühlte die gleiche brüderliche Angst in mir aufsteigen. Bei klarer Luft tauchten am Horizont Inseln auf wie die Rücken einer kleinen Schule von Tümmlern. Während die untergehende Sonne das Meer blutrot färbte, hörte ich das Tuscheln der Frauen, die die Köpfe zusammensteckten, sah ich das furchtsame Deuten der Männer mit dem Finger zum Horizont. Erst wenn der Nachthimmel endlich seine dunkelblaue Markise über den Bergen im Osten entrollte, stand ich auf und ging nach Hause in meine kleine Wohnung.
Vom ersten Tag meines Aufenthaltes in der weißen Stadt an hatte ich geahnt, dass ich etwas tun musste gegen diese Angst vor der Vergänglichkeit. Doch hielt ich schon damals die Erinnerung für genauso gefährlich wie das Vergessen. Beide sind zusammengehörige Ungeheuer wie Skylla und Charybdis, beide bedrohen das kleine Lebensschiff, das zwischen ihnen seinen Weg sucht. Skylla ist ein Doppelwesen, halb Hund und halb Fisch. Es haust in einer Höhle und droht, alle zu töten, die ihm zu nahe kommen. So ist die Erinnerung. Charybdis aber ist das Vergessen, ein gewaltiger alles verschlingender Strudel.
Ich habe vergeblich versucht, es mit beiden aufzunehmen. Meine Versuche zu vergessen waren dilettantisch. Immer wieder quälten mich unwesentliche Erinnerungen. Was wesentlich war, entglitt mir, schien jedenfalls nicht deutlich genug und vor allem nicht wahrheitsgemäß. Alles, was ich zusammentrug, glich bunten Abziehbildern, die man ins Poesiealbum des Lebens klebt. Sich absichtlich erinnern ist schwer. Ein mühseliges Unterfangen, ähnlich müßig wie der Versuch, Quecksilberperlen mit den Fingern aufzulesen. Sie zerteilen sich bei der geringsten Berührung und rinnen blitzschnell davon, um in allen möglichen Ritzen zu verschwinden.
Ich schlief schlecht in jenen Tagen. Da half auch der Rotwein nicht, den ich in großen Mengen trank. So versuchte ich, die Stunde der Wahrheit hinauszuzögern, die Unruhe zu betäuben, die den Archäologen befällt, wenn er sich auf einem Terrain zu befinden glaubt, unter dem die Schätze einer versunkenen Zivilisation liegen. Dabei war ich, ohne es zu wissen, längst dabei, mich meinen Erinnerungen zu stellen und ihre Bruchstücke auszugraben: All diese noch nicht von Grabräubern geplünderten Phantasien, all diese Vasen voller berauschender oder auch vergifteter Augenblicke! Wenn man die frühesten Momente im Leben, an die man sich erinnert, wie die Bruchstücke eines Gefäßes miteinander verkittet, entsteht, wenn man Glück hat, eine unregelmäßige, im Zickzack verlaufende Linie. Sie ähnelt einer geheimnisvollen Schrift und bedeutet, dass die Scherben wenigstens teilweise zusammenpassen. Natürlich klaffen auch große Löcher zwischen ihnen, die signalisieren, dass Teile der Vergangenheit unwiederbringlich verloren gegangen sind. Um die Form der Vase zu erhalten, muss man sie mit grauem Ton ausfüllen. Beim nachträglichen Brennen nimmt er eine rötliche Farbe an, auf der man die verloren gegangenen Muster, so gut es geht, rekonstruieren kann.
Ich lag oft, erschöpft vom Nichtstun, auf meinem Bett. Die Vorhänge hatte ich zugezogen. Die Schatten der Nacht kamen und gingen. Sie erinnerten an einfache Frauen in schwarzen Kleidern. Sie trugen ihre Träume auf dem Haupt wie durchsichtige Amphoren. Ich vertraute ihnen mehr als...