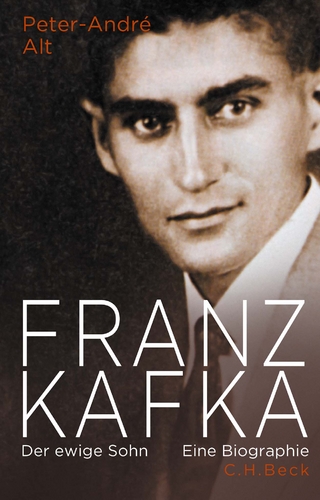Wo man Wurzeln schlägt
Weltbuch Verlag
978-3-906212-21-0 (ISBN)
Günter Mager erlebte seine Kindheit in einem von den Nazis verfolgten und sozialdemokratisch orientierten Elternhaus, das ihn weltanschaulich prägte und ihn zum Gegner faschistischen Handeln und Denkens macht. Er studierte Geschichte und promovierte an der Martin-Luther-Universität Halle. Er lehrte u.a. als Dozent an einer Fachschule.
Jeder Mensch wird in eine Zeit hineingeboren, die er sich selbst nicht ausgesucht hat. Er lebt im Heute und vielleicht macht er sich bewusst, dass die Umstände seiner Existenz auf vorherigem Geschehen fußen, an dem er keine Schuld trägt und auch keine Verdienste hat. Er muss sich seiner Zeit stellen, ob er will oder nicht. Nachdem die deutschen Eliten in einem Jahrhundert zweimal die Völker der Welt in barbarische Kriege mit fast einhundert Millionen getöteter Menschen gestürzt hatten, lag es nahe, ihnen die Macht für weitere Untaten endgültig zu nehmen. Einen Versuch war es wert. Sie widerstanden diesem Versuch und verübelten es denen, die das wagten. Sie verunglimpften diesen Versuch mit Schlagworten wie Mauerbau, Mauertote, Schießbefehl, Todesschüsse und Todesstreifen, Torgau und Bautzen, IM, Ministerium für Staatssicherheit und Unrechtsstaat. Von einem objektiven Geschichtsbild ist das weit entfernt. Dass die alten Eliten, denen für ein paar Jahrzehnte die Macht über einen Teil des Volkes genommen worden war, die Waghalsigen mit Häme und Spott und Verfolgung, wo auch immer es möglich war, überschütten, macht ihre Taten nicht besser, sondern bestätigt nur, dass das in der deutschen Geschichte schon immer so war. Die Helden dieses Romans – die Herrmanns, Wesers und ihre Freunde und Bekannten – nahmen in unterschiedlicher Weise an diesem „sozialistisch“ genannten Versuch teil. Sie erlebten in dieser Zeit ihre Kindheit und Jugend und erlebten im Erwachsenenalter sein Scheitern. Sie passten sich an, nahmen als selbstverständlich hin, was die Zeit ihnen als Ergebnis politischen Wollens bot oder gestalteten es selbst mit. Alles, was im Einzelnen erzählt wird, wurde tatsächlich auch erlebt. Nichts ist erfunden, aber den handelnden Personen frei zugeordnet. Es ist dies die Geschichte ihrer Familien. Vieles liegt inzwischen zwei Generationen zurück und kann noch so oder so nachvollzogen werden von denen, die mit ihnen millionenfach in ihrer Weise ihr Leben lebten. Es wird nichts übertrieben und nichts beschönigt. Es ist dies das Leben von Millionen jenseits des Kapitalismus – mit kostenlosem Gesundheitswesen, hochentwickeltem Bildungssystem, Recht auf Arbeit und gleichem Lohn für gleiche Arbeit, neuem Familien-, Zivil- und Strafrecht u. v. a. – mit einem Steinbruch neuer Ideen.* Neben der Mehrheit existierte eine kleine Minderheit, die den alten Eliten und ihren Nachkommen Treue geschworen hatten und erleben mussten, dass sie keinen Platz finden konnten in diesem „sozialistisch“ genannten Versuch, wenn sie sich aktiv gegen ihn aufbäumten. Sie kommen in diesem Roman nur andeutungsweise vor und sind anderswo hinreichend beschrieben. Anregungen erhielt der Autor aus den Gedanken und Schriften Siegfried Wenzels, Claudia Wagnerins, Günter Herlts, Herbert Grafs, Helmut Altrichters, Erich Kubys, den Herausgebern von „Leben in der DDR“, der „Geschichte des FDGB‘“, der Sammlung des Schweizer Atlasverlags „Das war die DDR“ und vielen anderen. Ihnen schulde ich Dank, wie auch meiner Frau Doris, den Freunden und Bekannten Cornelia H., Karin W., Hannelore R., Siegfried A. und anderen. Sie begleiteten kritisch und anregend die inzwischen für heutige Jugendliche unwirklich dünkenden und dennoch wahr gewesenen Erlebnisse der Herrmanns und Wesers in den Jahren der Existenz der DDR. * In „Neues Deutschland“, 14./15. Mai 2011.
Im Dresdner Ortsteil Pieschen lebten vor dem britisch-amerikanischen Bombenangriff vor allem Arbeiter mit ihren Familien, die in den großen Fabriken auf dem Industriegelände, in den Randgebieten der Großstadt und im nahen Schlachthof jenseits der Elbe ihren Lohn verdienten. Die Folgen der Bombennacht vom 13. Februar 1945 ließen auch ein paar Leute aus den angeseheneren Stadtteilen – Striesen, Johannstadt oder Südvorstadt – nach Pieschen kommen. Sprach man jedoch davon, wo man in Dresden gern wohnen würde, so meinte man die Ortsteile Weißer Hirsch oder Blasewitz, die im Wesentlichen von den Bomben verschont geblieben waren und welche nach dem Dresdner Zwinger, der Gemäldegalerie, der Frauenkirche und anderer historischer Denkmale das Aushängeschild der Stadt waren. Bettinas Eltern wohnten mit ihren drei Töchtern Carmen, Gudrun und Bettina in Pieschen in der Eisenberger Straße im dritten Stock. Das Haus klemmte in einer Reihe von Häusern zwischen zwei gleich hohen Gebäuden. Als sie gebaut wurden, polterten noch schwer beladene Pferdewagen über die Kopfsteinpflaster der Straße, die von breiten Bürgersteigen gesäumt war. Die älteren Leute nannten diese selbst in den fünfziger Jahren noch immer „Trottoir“. Auch auf der anderen Straßenseite drängten die Häuser aneinander. Da war kein Platz für einen zierenden Baum, keiner für einen Garten vor dem Haus. Nur Unkräuter lugten zwischen den breiten Gehwegplatten hier und da hervor; niemand nahm von ihnen Notiz. In der Nacht, in der große Teile Dresdens in Trümmern versanken, waren in Pieschen nur wenige Bomben gefallen – nur ein paar bald gelöschte verirrte Brennstäbe und hier und da eine kleine Sprengbombe. Die Eisenberger Straße sah noch lange nach dem Krieg so aus, wie sie vor ihm auch schon war: grau, proletarisch, hässlich, vernachlässigt, aber sauber. Sauber die Straße, sauber die Straßenrinne, sauber die Gehwegplatten. Dafür sorgten die Hausgemeinschaften, denen dafür ein kleiner Obolus in die Hausgemeinschaftskasse floss. Hausgemeinschaften – das war eine Erfindung der neuen Herren, der Kommunisten. Zum Promenieren war die Eisenberger Straße so wenig gebaut worden wie die benachbarten Straßenzüge. Hier wohnte man. Die meisten Pieschener empfanden diese hundert Jahre alten Miethäuser als ihr Zuhause. Auch Bettinas Eltern, Klaus und Helga Herrmann – Herrmann mit zwei „r“, selbstverständlich, wie Klaus hervorhob – waren zufrieden mit ihrer Wohnsituation. Andere hatte es viel schlimmer getroffen. Sie wohnten zur Untermiete, hausten in irgendeinem Zimmer, geduldet von den sogenannten Hauptmietern, gemocht von ihnen nur sehr selten. Behaglich war die Herrmann‘sche Wohnung nicht. Aber die Familie hatte eine, wenn sie ihr auch auf eine merkwürdige Weise zugesprochen worden war. Das familiäre Leben fand in der Wohnküche statt. Hier thronte der Herd mit seinem Feuerloch und der Röhre, in der das Wasser fast immer lauwarm war. Neben dem Ofen hatte Klaus Herrmann eine Platte montiert. Auf ihr konnte man Teller und Töpfe abstellen. Sie aber war nur benutzbar, wenn der Abfluss nicht gebraucht wurde, denn die Platte deckte ihn ab. Sie enthielt ein kleines, genau gezirkeltes Loch, für den Fall, dass der Messing-Wasserhahn tropfte. Während des Krieges hatte der Hausbesitzer neben dem Herd einen Gaskocher mit zwei Flammen montieren lassen. Die Gasuhr, die das verbrauchte Gas zählte, hing im Hausflur und musste mit Groschen gefüttert werden, sonst gab es kein Gas. Allerdings hatte ein paar Jahre nach dem Krieg die neue Hausverwaltung die Groschenuhr durch einen Gaszähler ersetzt, der leider, so fanden Herrmanns, zu schnell und zu gründlich zählte. Mitunter überschritten sie die zugeteilte monatliche Menge, die für acht Pfennige je Kubikmeter zu haben war. Der Mehrbedarf aber war teuer, Gas war noch eine Zeit lang knapp. Aber auch diese war inzwischen vorüber. Herrmanns konnten so viel Gas verbrauchen, wie sie wollten. Es kostete nach wie vor und bis zur Wende 1990 acht Pfennige. Der Staat subventionierte es trotz enorm gestiegener Produktionskosten. Inmitten der Wohnküche stand ein großer Tisch, um den sechs Stühle gruppiert waren – für den Fall, dass Helgas Mutter, Oma Elfriede, vorbeischaute. Ein ererbter Sessel schob sich unter die Dachschräge. Neben ihr war ein selbst gezimmertes Regal eingepasst, auf dem ein paar Bücher von Gerstäcker, Karl May, Courths-Mahler, aber auch Gorkis „Die Mutter“, Ostrowkis „Wie der Stahl gehärtet wurde“ und ein Bändchen „Deutsche Gedichte“ den Leser vergebens lockten. Die Fächer darüber, der Dachschräge angepasst, hatte Helga mit allerlei Nippes ausgefüllt, ererbt von ihrer vor ein paar Jahren verstorbenen Großmutter. Helga hielt die alten, kleinen Sachen hoch, liebte sie als Erinnerungsstücke. Im Schlafzimmer der Eltern versperrte ein großer Schrank den Weg zu einem der Ehebetten. Wer zum Fenster hin lag, musste über das Bett des Partners – das gehörte zu Klaus‘ abendlichen und morgendlichen Übungen. Der Schrank barg die Bettlaken, die Bade- und Handtücher, die Tischdecken und all die anderen Textilien des Haushaltes, außerdem Helgas und Klaus‘ durchaus nicht üppige persönliche Kleidung. Im kleinen Nebenzimmer, zur Straße hin, schliefen Carmen, die Älteste, und Gudrun in einem Etagenbett. Die Jüngste, Bettina, lag in einem inzwischen zu kleinen Kinderbett, das Klaus „strecken“ musste, wie er es nannte, indem er ein Loch in die untere Bettbegrenzung sägte und das Bett um etwa fünfzig Zentimeter erweiterte. Bis zur Decke hin hatte Klaus einen schmalen Schrank eingebaut, der alle Kleidungsstücke der Mädchen enthielt. Es ging eng zu im Zimmer der Eltern und noch gedrängter im Zimmer der Kinder. Doch andere Familien mussten mit weit weniger auskommen. Zu dieser Wohnung – Klaus nannte sie manchmal abschätzig „Wohnstätte“ – gehörte etwas Besonderes und Gewöhnungsbedürftiges: Der stille Ort, von dem man sagt, selbst der Kaiser ging zu ihm zu Fuß, war im dritten Stock eingerichtet worden. Ihn suchte man jetzt also vergebens im Hof, wo er noch immer in vielen Häusern der Eisenberger Straße zu finden war und von drei, vier Familien geteilt wurde, sondern er existierte seit ein paar Wochen auf der gleichen Wohnebene als ein großer Raum, der sowohl als Bad für alle Mieter des dritten Stockes diente, als auch als stilles, in drei Kabinettchen abgeteiltes Örtchen mit je einer Tür, durch die ein Milchglasfenster etwas Licht ins geschlossene Innere spendete. Nun mussten die Mieter nicht mehr die drei Treppen bei Wind und Wetter hinunter über den Hof und hoffen, dass nicht der alte Gäbler, Zeitung lesend, das Trockenklo absaß. Da musste man erst anklopfen und Dringlichkeit anmahnen. Jetzt hatte jede Familie ihre eigene, mit Wasser bespülte Toilette und konnte Zeitung lesend ausharren, so lange sie wollte – allerdings, wegen der Lichtverhältnisse, bei geöffneter Tür. Neben dieser Neuerung war da noch das eine gemeinsam benutzte, eiserne, emaillierte Badewanne mit einem Stöpsel als Abfluss, die gegenüber den Kabinettchen unter einer schrägen Wand zum Bade einlud. Ein Badeofen, mit Holz oder Kohle beheizbar, aus dem heraus ein langes Rohr zum Schornstein hin führte, das Wärme spendete, sorgte für wohliges, warmes Wasser in der Wanne – und jeder badete im frischen Wasser aus dem Ofen. Was war diese herrliche Neuerung gegen das, was vorher üblich war! Die Wanne ersetzte in den Wohnungen die alte Zinkbadewanne, die mit Eimern gefüllt und nach dem Bade wieder leergeschöpft werden musste, wobei meist die Familie nach und nach im selben Wasser badete. Jetzt aber steckte man ein paar Scheite in den Ofen und schon nach kurzer Zeit konnte man sich im warmen Wasser aalen! Helga Herrmann stellte nun fest, dass Rentner Gäbler immer gerade dann sein Örtchen aufsuchen musste, wenn sie mit dem freitäglichen Bad dran war. Er habe es mit der Blase, entschuldigte er sich jedes Mal und gönnte sich einen durchaus unmanierlichen Blick auf die nackte, junge Frau. Klaus hielt es deshalb für angezeigt, Rentner Gäbler auf sein ungebührliches Verhalten aufmerksam zu machen. Der aber reagierte trotzig. Die Weiber sollten sich nicht so haben, er wäre nun einmal krank. Wenn er müsse, dann müsse er eben. Helga drohte Boykott an, verlangte nach der Zinkbadewanne, sollte Klaus nicht Abhilfe schaffen. Von seiner Arbeitsstelle, dem Reichsbahnausbesserungswerk, brachte Klaus einen langen Draht mit und spannte ihn so vor die Badewanne, dass ein Vorhang, den Helga zugeschnitten, genäht und mit Rollen zum Auf- und Zuziehen versehen hatte, die Betrachtung der Badenden verhinderte. Merkwürdigerweise senkte dieser Vorhang den Harndrang des Rentners Gäbler rapide. Mutter Helga hielt das Zepter fest in ihrer Hand. Sie bestimmte den Rhythmus in ihrem Revier und fackelte nicht lange, wenn eines der Kinder ihn durchbrechen wollte. Nicht, dass es Hiebe gab oder andere Handgreiflichkeiten: Sie regierte mit dem Blick, konnte ihre graublauen Augen Bände sprechen, sie funkeln, leuchten, schimmern, lächeln, strahlen lassen. Nur ganz selten gab es auch mal einen Klaps. Während sie am Herd stand und für das mittägliche Sonntagsmahl sorgte, summte oder sang sie Lieder vor sich hin: das Goethe‘sche „Heideröslein“, Schuberts „Lindenbaum“ und das Lied von der „holden, weinenden Gärtnersfrau“, oder auch das Uhland‘sche „Ich hatt‘ einen Kameraden“ – das, was ihr eben in den Sinn kam. Sie sang gern und fand sicher die Töne. In diesen Minuten glitt ein seliges Lächeln über ihr Gesicht. Sie war zufrieden mit ihrem Leben. Sie hatten ihr Auskommen, wobei es schon etwas mehr hätte sein können, und sie hatten drei gesunde, wenn auch ungewollte Kinder, die so waren, wie Kinder sein sollten. Mal machten sie Freude, mal musste man ihnen die Hörner stutzen. Der Respekt vor Helga wuchs aus ihrem sicheren, ruhigen Urteil, das selbst bei größtem Tohuwabohu von ihr ausging. Ihre Singer-Nähmaschine wirkte beruhigend auf sie. Mit ihr fertigte sie alles, was gebraucht wurde: Die Kleider für Carmen, Gudrun und Bettina, ihre eigenen Kleider, Blusen und Röcke, auch Hemden für Klaus. Manchmal brachte eine Bekannte etwas zum Ändern vorbei. Die „Singer“ hatte sie von ihrer Großmutter geerbt. Man musste sie nicht treten, damit die Maschine nähte, ein kleiner Motor trieb sie an. Helga klang es wie Musik in ihren Ohren, sobald sie die Nähte herunter ratterte und der Motor dazu seine Melodie summte. Aber ständig an der Nähmaschine sitzen, das war Helgas Sache nicht mehr. Platz in der Wohnküche der Herrmanns fand sich für die Nähmaschine nicht; sie stand vor der Schranktür im Schlafzimmer und musste immer hin- und hergerückt werden, wollte jemand in den Schrank. Zum Nähen holte sie Helga für ein paar Stunden in die Wohnküche. Dann entschwanden Helgas Gedanken in die Zeit bei ihrer Meisterin, Frau von Kuckowitz. Bei ihr, im Dresdner Vorort Plauen, hatte sie, noch in den letzten Kriegsmonaten beginnend, drei Jahre lang den Beruf einer Damenschneiderin erlernt. Im ersten Lehrjahr bezog sie monatlich 25 Mark, abzüglich der Krankenkasse, im zweiten waren es 35 Mark und im dritten sogar 45 Mark. Es seien Nachkriegszeiten, hatte Frau von Kuckowitz bemerkt, und die tägliche Arbeitszeit von morgens halb acht bis abends um sechs bestimmt. Nur sonnabends endete die offizielle Arbeitszeit bereits um eins. Danach musste noch sauber gemacht und aufgeräumt werden. Da konnte es schon mal halb drei, um drei oder gar um vier werden – das hatte Helgas Lust am Schneidern als Quelle des Lebensunterhalts verdorben. Die Kundinnen ihrer Meisterin waren die Ehefrauen der Professoren und anderer leitender Angestellter der Technischen Hochschule. Auch ein paar Handwerker-Ehefrauen gehörten zum Kundenstamm. Sie selbst sprach nie darüber, wer der Herr von Kuckowitz war, dessen Namen sie schon geraume Zeit trug, und den Helga nie zu Gesicht bekommen hatte. Nirgends hing ein Bild von ihm. Im dritten Lehrjahr nahm Helga sich ein Herz und hatte während einer kleinen Kaffeepause gefragt – es war an einem Sonnabend, die offizielle Arbeitszeit längst vorüber – wer denn der Herr von Kuckowitz sei. „Kucko?,“ hatte Frau von Kuckowitz verwundert geantwortet und dann bündig erklärt: Der lebe, wie sie glaube, bei seinen Negern in Afrika und studiere ihre Sprache. Er sei nämlich ein Negerfreund und wolle diesen schwarzen Affen Bildung beibringen. Sie lachte gekünstelt. Mehr aber gab sie nicht preis. Bei der Kuckowitz hatte Helga genäht und genäht, mehr als die Hälfte der Arbeitszeit mit der Hand, Stich um Stich, mal jene, mal eine andere Art. Das Handwerk läge in der Familie, scherzte Helgas Mutter Elfriede gern und spielte damit auf Helgas fünf Jahre ältere Schwester Hedwig an, die es zur Damen- und Herrenschneidermeisterin gebracht hatte. Als jedoch die drei Jahre Lehrzeit sich dem Ende näherten, meinte Frau von Kuckowitz, sie könne Helga aus zwei Gründen nicht weiter beschäftigen. Erstens könne sie sich eine Gesellin nicht leisten und zweitens nähe Helga viel zu sehr mit dem Kopfe. Sie arbeite sehr sorgfältig und deshalb oft zu langsam. So lasse sich kein Geld verdienen, leider. Als sich Helga bei den wenigen im Dresdner Raum ansässigen Schneidermeisterinnen bewarb, fanden sie lobende Worte zu dem Zeugnis, das ihr Frau von Kuckowitz ausgestellt hatte, drückten aber ihr Bedauern aus und vertrösteten auf später – vielleicht, wenn die Zeiten wieder besser seien. Ein Lehrling war eben billiger. Frau von Kuckowitz hatte Helga fast am Ende ihrer Lehrzeit gebeten, sorgsam geänderte Kleidungsstücke zu einer Frau Westphal an den Münchener Platz zu tragen. Dort öffnete ihr ein junger Mann und bat sie galant herein. Seine Mutter sei nicht da, sagte er, aber er könne ihr die Kleidungsstücke abnehmen. Er beiße nicht, sie solle nur näher treten. Das tat sie auch. Er führte sie in die Bibliothek und gab ihr Einblick in wohlhabendes Bürgertum. Sie staunte über die vielen Bücher an den Wänden, die ledernen Sessel und den schwer von der Decke herabhängenden Leuchter. Noch nie hatte sie eine solche Wohnung betreten. Dem jungen Mann – er war kaum ein Jahr älter als Helga – gefiel das unsichere Mädchen, und er gab sich Mühe, ihr zu imponieren. Nach und nach gelang ihm das. Aus dem Arbeitszimmer seines Vaters führte er sie in sein Zimmer, das er mit seinem älteren Bruder teilte. Hier war kein Protz, hier sah es fast aus wie bei ihr zu Hause, nur sehr viel eleganter: Alles eng, alles einfach, hell und licht, aber auch hier viele Bücher. Er zeigte ihr seine Schallplattensammlung, geordnet nach leichter und, wie er sagte, schwerer Muse und fragte, ob sie eine Platte anhören wolle. Sie hatte nichts dagegen. Der junge, redegewandte und gut aussehende junge Mann beeindruckte Helga. So hatte sie auch nichts einzuwenden, als er sie einlud, mit ihm weitere Schallplatten zu hören. Warum sollte sie nicht? Sie liebte Musik und er führte sie behutsam zur klassischen Musik hin. Das ging ein paar Sonnabende so. Sie lernte Rachmaninow mögen und auch ihn, erlaubte ihm Küsschen und seine Hand um ihre Taille, während sie sittsam auf seinem Klappbett saßen und dem 2. Klavierkonzert Rachmaninows lauschten. Am Ende gab sie seinem Drängen nach. Nun nannte sie ihn, ohne recht zu wissen warum, „ihren Leutnant“, er sie „Kätzchen“, „Röschen“ und dergleichen. Sie besuchte ihn, wenn die Eltern nicht anwesend waren und der Bruder auch nicht. Sie sprachen von „ihrem Geheimnis“, das er dann wohl doch gegenüber seinem Bruder gelüftet hatte, bis eines Tages an einem vereinbarten späten Sonntagnachmittag statt ihres jungen Mannes sein Bruder auf ihr vereinbartes Klingelsignal öffnete und ihr freundlich mitteilte, sein Bruder wäre unerwartet verreist. Sie solle warten, bis er sich wieder melde. Sie hoffte noch ziemlich lange und vertraute sich dummerweise an einem Wochenende ihrer Schwester Hedwig an. Mit einer gewissen Häme und recht unverblümt fragte Hedwig, ob sie es denn nicht wisse, dass dergleichen Leute kein schon gebrauchtes Mädchen heirateten. Und gebraucht sei sie ja wohl. Vielleicht lag es am Altersunterschied, dass Helga ihre Schwester meist mied, vielleicht daran, dass ihr Hedwig immer als Vorbild hingestellt, ihr Fleiß und ihre Geschicklichkeit gerühmt worden waren. Sie räumte auch ein, dass ihr das Lernen schwerer fiel als Hedwig. Sie war langsamer, aber was das Kochen, Aufwischen und all die anderen Hausarbeiten anging, da konnte sich Hedwig von ihr eine Scheibe abschneiden. Elfriede Burgk, ihre Mutter, aber liebte ihre Helga nicht weniger als ihre beiden älteren Kinder Bruno und Hedwig. Die beiden Älteren waren gekommen, wie eben Kinder kommen, Helga aber war ihr Kleines, von ihrem Manne Oswald und ihr gewünscht. Hedwig war nach ihrer Volksschulzeit zu Elfriedes Schwester Ida nach Waldheim in die Lehre gegangen und hatte sich im Laufe der Jahre zur selbstständigen Damen- und Herrenschneiderin gemausert. Bruno hatte gerade noch die Stellmacherlehre abschließen können, da hatte der heitere, lebensfrohe Junge in den Krieg gemusst. Mit seiner kleinen Schwester Helga hatte er sich nur ab und zu abgegeben, mit ihr herumgealbert, ohne sie wirklich zu mögen – pflichtgemäß eben. Weil sie keine andere Arbeit fand, sorgte Helgas Mutter Elfriede für einen Arbeitsplatz in der Küche im sowjetischen Röntgen- und Transformatorenwerk, nachdem sie ihren letzten Arbeitstag bei Frau von Kuckowitz hinter sich gebracht hatte. Sie lernte hier alles, was in einer Großküche unter den Bedingungen der schweren Nachkriegszeit gekocht werden konnte, fühlte sich wohl unter ihren Arbeitskolleginnen, denn außer dem Chefkoch waren hier nur Frauen und Mädchen beschäftigt, lachte mit ihnen und ärgerte sich mit ihnen. Vor allem ihre Arbeitskollegin Franziska fand sie sehr nett, ohne vertraulich zu werden. Die Nachkriegsjahre lasteten noch schwer auf den Menschen, da hatte Helga von Bekannten in Radebeul ein Körbchen Erdbeeren geschenkt bekommen. Ein richtiges Geschenk war das – drei Jahre nach diesem furchtbaren Krieg. Wer gab da ein Körbchen Erdbeeren her, ohne eine Gegenleistung zu erwarten? Einfach so geschenkt! Sie saß in der Straßenbahn und behütete ihr Körbchen. An der Haltestelle, an der man in die Schmalspurbahn nach Moritzburg umsteigen konnte, setzte sich ein junger Mann gegenüber. Schüchtern schaute Helga auf, sah in ein bartloses, unauffälliges und sie anlächelndes Gesicht und in ein Paar braune, sanft blickende Augen. Sie konnte nicht anders als sein freundliches Lächeln zu erwidern, blickte schnell nach unten und sah doch, dass der junge Mann ihr gegenüber, nicht viel größer als sie, in Knickerbockern und einer zu engen, kleinen Jacke, ihr sein Lächeln schenkte. Da naschte er keck eine Erdbeere aus ihrem Körbchen! Das schreckte sie auf. Ihre Augen blitzten den Dieb an, ihre Hände legten sich beschützend über das Körbchen. „Schmecken sehr gut“, sagte er. „Ich wollt‘ eine nur ‚mal kosten, habe seit Jahren keine mehr gegessen. Sie verzeihen mir doch hoffentlich meinen kleinen Mundraub?“ Helga nickte, gab den Blick auf das Körbchen wieder frei und wollte ihm sagen, er solle noch eine nehmen. Sie schwieg jedoch, sah ihn an, und ein schuldbewusstes, doch anmutiges Lächeln glitt über ihr Gesicht: „So ein schöner Mann“, dachte sie. Er bemerkte den Eindruck, den er auf sie machte, und versuchte ein Gespräch. Sie blieb einsilbig, sagte „Ja“ oder „Nein“, mehr nicht. Als er ein paar Stationen weiter zum Aussteigen aufstand, fragte er, sich zu ihr neigend: „Können wir uns wieder sehen, schönes Mädchen?“ Sie schüttelte heftig den Kopf. Er hob die Schultern, sagte „Schade“ und ging zum Ausgang, sprang noch während des Bremsvorganges ab und verschwand. „So ein frecher Kerl!“, dachte Helga und verbannte ihn aus ihrem Kopf. Aber er war doch darin und manchmal bereute sie, dass sie nicht „Ja“ gesagt hatte.
| Erscheinungsdatum | 31.10.2015 |
|---|---|
| Mitarbeit |
Cover Design: Dirk Kohl |
| Sprache | deutsch |
| Maße | 135 x 215 mm |
| Gewicht | 726 g |
| Einbandart | Englisch Broschur |
| Themenwelt | Literatur ► Historische Romane |
| Geisteswissenschaften ► Sprach- / Literaturwissenschaft ► Literaturwissenschaft | |
| Schlagworte | Belletristik: allgemein und literarisch • DDR • Deutsche Geschichte • Deutschland • Dresden, Geschichte; Romane/Erzählungen • Europa • Familienleben • Familiensaga • Generationenromane, Familiensagas • Geschichte • Gesellschaft und Kultur, allgemein • Historischer Roman • Literatur: Geschichte und Kritik • Nachkriegsjahre • Nachkriegszeit (nach dem 2. Weltkrieg); Romane/Erzählungen • Nachkriegszeit; Romane/Erzählungen • Pädagogik • Politik und Staat • SED • Stasi |
| ISBN-10 | 3-906212-21-1 / 3906212211 |
| ISBN-13 | 978-3-906212-21-0 / 9783906212210 |
| Zustand | Neuware |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
aus dem Bereich