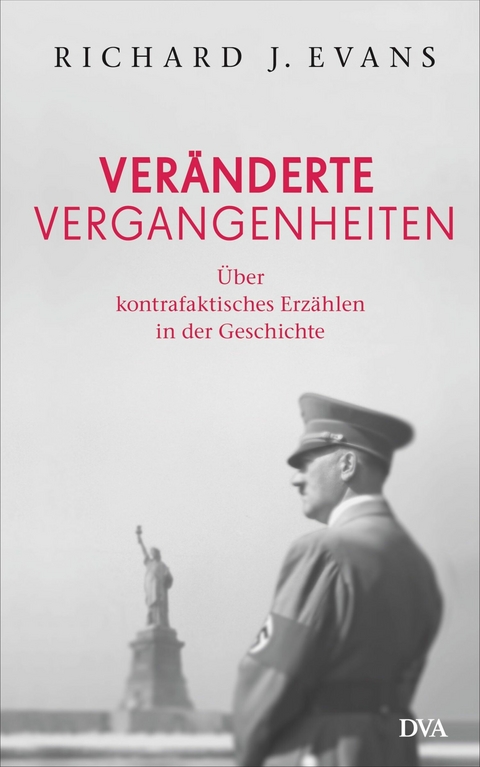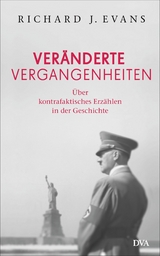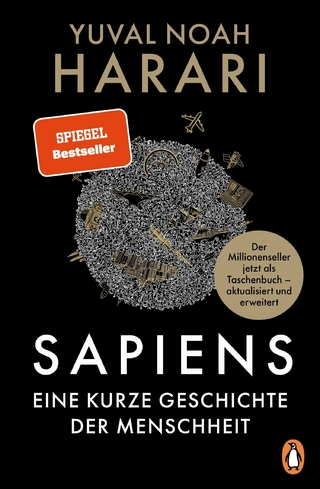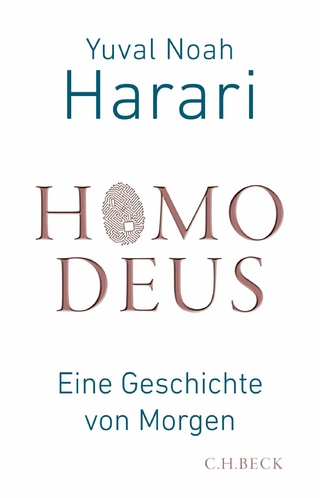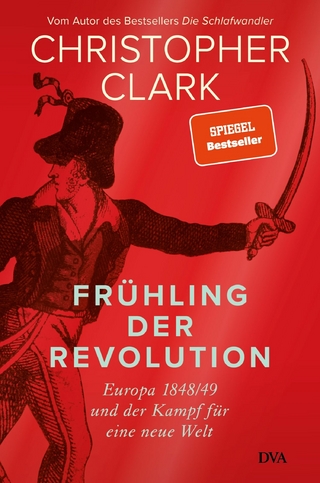Veränderte Vergangenheiten (eBook)
224 Seiten
Deutsche Verlags-Anstalt
978-3-641-14269-8 (ISBN)
Was wäre, wenn Napoleon die Schlacht von Waterloo gewonnen hätte? Was, wenn Hitler 1930 bei einem Autounfall gestorben wäre? Solche Fragen haben Historiker und Geschichtsinteressierte seit jeher fasziniert - und wenn sie auch die Vergangenheit nicht zu ändern vermögen, so sind die Antworten darauf doch ein Spiegel der jeweiligen Gegenwart.
Warum stellen sich Menschen alternative Geschichtsverläufe vor? Der renommierte Historiker Richard J. Evans untersucht die soziale, kulturelle und politische Bedeutung solcher Überlegungen und beschreibt das Aufkommen kontrafaktischer Geschichtsschreibung aus dem Geist der romantischen Vergangenheitsverklärung. Prägnant zeigt Evans, welchen Wert das Nachdenken über jene Wege hat, die nicht beschritten worden sind - und warnt zugleich vor einer gefährlichen Nähe zu Verschwörungstheorien.
Richard J. Evans, geboren 1947, war Professor of Modern History von 1998 bis 2008 und Regius Professor of History von 2008 bis 2014 an der Cambridge University. Seine Publikationen zur deutschen Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts und zum Nationalsozialismus waren bahnbrechend. Zu seinen Auszeichnungen zählen der Wolfson Literary Award for History und die Medaille für Kunst und Wissenschaft der Hansestadt Hamburg. 2012 wurde Evans von Queen Elizabeth II. zum Ritter ernannt. Zuletzt sind von ihm erschienen »Das europäische Jahrhundert. Ein Kontinent im Umbruch - 1815-1914« (DVA 2018), »Das Dritte Reich und seine Verschwörungstheorien« (DVA 2021) und »Tod in Hamburg. Stadt, Gesellschaft und Politik in den Cholera-Jahren 1830-1910« (Pantheon 2022).
KAPITEL 2
VIRTUELLE GESCHICHTE
Seit 1990 ist ein Vielfaches mehr an Büchern und Aufsätzen über »kontrafaktische Geschichte« erschienen, wie deren Vertreter sie seit dem 1997 von Niall Ferguson herausgegebenen Sammelband Virtuelle Geschichte nennen, als in der gesamten realen Geschichte davor. Die Liste der kontrafaktischen Geschichtsdarstellungen ist mittlerweile so lang geworden, dass man sie als eigenes Genre betrachten und analysieren muss. Sie kommen längst nicht mehr als Gesellschaftsspiel oder intellektueller Zeitvertreib daher, sondern nehmen sich selbst außerordentlich wichtig. Die in den entsprechenden Sammelbänden zugrunde gelegte Definition des Kontrafaktischen unterscheidet sich deutlich von der, die Ökonometriker wie Fogel heranziehen. Die Autoren befassen sich nicht mit fiktiven statistischen Berechnungen, sondern legen ernsthafte Argumentationsketten über denkbare, angeblich realistische Alternativen zum tatsächlich Geschehenen vor.
Woher rührt ihre Überzeugung, ihr Vorgehen sei ernster zu nehmen als die von manchen ihrer Vorläufer gespielten Gesellschaftsspiele oder das von anderen gepflegte Wunschdenken? Ihre Antwort lautet, es sei ihr erklärtes Ziel, in der Geschichte, die allzu oft als Spiel anonymer Kräfte dargestellt werde, dem freien Willen, der Kontingenz und dem individuellen Akteur wieder zu ihrem Recht zu verhelfen. »Geschichte, in der es um bedeutende Persönlichkeiten oder Schlüsselereignisse geht«, beklagt Robert Cowley in der Einleitung zu seinem Buch More What If?, »ist außer Mode gekommen. Alles dreht sich heute um allgemeine Trends, um jene großen Wellen, die anschwellen, gebrochen werden und wieder zurückgehen. Dadurch entsteht der Eindruck, dass die Geschichte einer zwangsläufigen Entwicklung folge, dass das, was geschehen ist, keinen anderen Ausgang nehmen habe können und dass generell für Dramatik und Zufall im menschlichen Leben kein Platz sei.«57 Der Zweck kontrafaktischer Szenarien, schlägt Jeremy Black in die gleiche Kerbe, liege darin, den »kontingenten, offenen Charakter historischen Wandels« zu betonen »und jeglichem Eindruck vorzubeugen, die tatsächliche historische Entwicklung sei unvermeidbar gewesen«.58 »Liberale, Marxisten, Deterministen und alle, die glauben, das Leben des Menschen sei vom Schicksal, der Vorsehung oder dergleichen vorherbestimmt«, schreibt Andrew Roberts zur Rechtfertigung kontrafaktischer Geschichtsschreibung, »ärgert dieser Ansatz natürlich mächtig.«59 Sowohl Black als auch Roberts beschwören Historiker, sich von der »Tyrannei des Rückblicks« freizumachen und zu versuchen, die Vergangenheit so zu betrachten, wie die Zeitgenossen sie gesehen haben: voller offener, nicht festgelegter zukünftiger Möglichkeiten. »Indem sie sich auf kontrafaktische Gedankenexperimente einlassen«, so Benjamin Wurgaft in einem jüngst erschienenen Artikel, »könnten Historiker die Geschichte der Schlüsseltexte und -debatten der Geistesgeschichte wieder mit einem Bewusstsein für ihre völlige Kontingenz erzählen.«60
Ganz ähnlich argumentieren Geoffrey Parker und Philip Tetlock, wenn sie im von ihnen herausgegebenen Sammelband Unmaking the West die unter Historikern vorherrschende Haltung eines »retrospektiven Determinismus« anprangern und verkünden, die »Erschütterung des selbstgefälligen Rückblicks« sei die beste Möglichkeit, »uns vor Augen zu führen, wie ungewiss alles erschien, bevor wir alle vom Wissen um das Endergebnis verdorben wurden«.61 Simon Kaye hat in einem kürzlich veröffentlichten Artikel zum Nutzen kontrafaktischer Szenarien verkündet, deren Hauptzweck liege darin, »der beklagenswerten zeitgenössischen Haltung vermeintlicher deterministischer Gewissheit« entgegenzuwirken, indem sie die »Bedeutung des menschlichen Handelns« für die Geschichte betonten.62 Nichts von alledem war sonderlich neu; Aufsätze dieses Genres hatten schon immer die Rolle von Zufall und Kontingenz in der Geschichte betont. »Bei ihren Bemühungen, den Fluss der Ereignisse auf der Welt zu erklären, haben Historiker den Zufall nicht immer gebührend berücksichtigt«, stellte John Merriman 1982 fest. »Ein Bewusstsein für den Einfluss des Zufalls«, so Merriman, »bewahrt den professionellen Historiker vor der selbstverliebten Versuchung, alles erklären zu wollen.«63 Neu an der kontrafaktischen Geschichtsschreibung der 1990er Jahre und zu Beginn des 21. Jahrhunderts war die Häufigkeit und Vehemenz, mit der die Autoren ihren Glauben an den Zufall betonten.
Die meisten kontrafaktischen Szenarien dieser Art wurden, wie nicht anders zu erwarten, von politisch und methodisch konservativen Historikern verfasst. Zu einem gewissen Grad bilden diese sogar eine Gruppe: So hat John Adamson Beiträge zu den Sammelbänden von Ferguson und Roberts verfasst, Roberts hat Artikel für das Buch Fergusons und für More What If? von Cowley geschrieben, aus der Feder Geoffrey Parkers stammen neben seinem eigenen Buch Beiträge zu Cowleys What If und More What If?, während Cowley wiederum einen Artikel zum Band von Roberts beigesteuert hat. Da in kontrafaktischen Szenarien »Akteure« im Mittelpunkt stünden, beziehungsweise »das Handeln einer in der Regel kleinen Zahl von Individuen«, schreibt Jeremy Black, sei sie eindeutig eher nach dem Geschmack von rechten Historikern, da diese sich die Konzepte »Individualismus« und »freier Wille« sehr viel häufiger zu eigen machten als linke Historiker.64 Tatsächlich gibt es, wenn überhaupt, kaum kontrafaktische Szenarien, die aus einer linken Perspektive verfasst sind. Ungeachtet aller Strudel und Gegenströmungen ist die Linke traditionell davon überzeugt, dass der Strom der Geschichte langfristig in eine für sie günstige Richtung fließe. Warum sollten linke Historiker dem nachtrauern, was in der Vergangenheit nicht geschehen ist, wenn ihnen ohnehin die Zukunft gehört? Eine der wenigen Ausnahmen von dieser Grundregel sind die Spekulationen von E. H. Carr, was wohl geschehen wäre, wenn Lenin ein hohes Alter erreicht hätte. Eine weitere sind sozialistische Spekulationen, dass Hitler 1933 nicht an die Macht gekommen wäre, wenn die Linke sich geschlossen gegen ihn gestellt hätte; eine dritte die Überlegungen G. M. Trevelyans, was passiert wäre, wenn Napoleon siegreich aus der Schlacht bei Waterloo hervorgegangen wäre. Aber im Allgemeinen sind derartige Spekulationen auf Seiten der Linken höchst selten anzutreffen. Außerdem gibt es für den Mangel an linken kontrafaktischen Szenarien politische und methodische Gründe. Denn, wie Tristram Hunt dargelegt hat:
Von »Was wäre gewesen, wenn«-Szenarien geht nicht nur eine schleichende Bedrohung für ein umfassenderes Verständnis der Vergangenheit aus, sondern auch für die Politik in der Gegenwart. Dass Progressive wenig für sie übrig haben, ist nicht weiter überraschend, implizieren solche Gedankenspiele doch, dass Gesellschaftsstrukturen und ökonomische Bedingungen keine große Rolle spielen. Der Mensch, so sagt man uns, sei ein von historischen Zwängen fast vollständig unabhängiges Wesen, das seine Entscheidungen aus freien Stücken treffen könne. Andrew Roberts zufolge sollten wir uns klar machen, dass »in menschlichen Angelegenheiten alles möglich ist«. Das bedeutet erstens, dass es aus den Möglichkeiten der Geschichte wenig zu lernen gibt, und zweitens, dass kein Anlass besteht, Ungerechtigkeiten aus der Welt zu schaffen, da sie auf den Fortgang der Ereignisse kaum einen Einfluss haben. Ohne über Gebühr deterministisch erscheinen zu wollen: Es ist nicht schwer, die politischen Intentionen eines solchen reaktionären und historisch redundanten Zugangs zur Vergangenheit zu erraten.65
In der Praxis sind kontrafaktische Szenarien daher traditionell mehr oder weniger ein Monopol der Konservativen.
Die Anhänger kontrafaktischer Geschichtsdarstellungen betonen gerne, ihr Glaube an Kontingenz und Zufall sei die logische Folge ihres Einsatzes für die Rechte des Individuums. Aber das ist möglicherweise nur die halbe Wahrheit. E. H. Carr war der Auffassung, »daß in einer Gruppe oder Nation, die sich in einem Wellental und nicht auf der Höhe der geschichtlichen Ereignisse befindet, die Theorien vorherrschen, die die Rolle des Zufalls oder Unfalls in der Geschichte betonen«.66 Dasselbe ließe sich erst recht von phantasievollen Gedankengebäuden sagen, die sich mit dem beschäftigen, was hätte gewesen sein können, besteht doch bei vielen von ihnen das Fundament aus Bedauern über das, was ist. Gut möglich, dass konservativ orientierte britische Historiker Mitte der 1990er Jahre begannen, die Rolle des Zufalls zu betonen und darüber nachzudenken, dass alles auch anders hätte kommen können (oder vielleicht eher: sollen), weil zu diesem Zeitpunkt die seit 1979 währende, lange Ära der Dominanz der Conservative Party unverkennbar zuende ging. Abzulesen war das an der Ablösung der Heldin der Konservativen, Margaret Thatcher, durch den blassen John Major, dessen Politik bei der neuen Generation des rechten Tory-Flügels, zu der die Anhänger kontrafaktischer Spekulationen eindeutig gehörten, zunehmend auf Widerspruch stieß. Und tatsächlich dauerte es ja nicht lange, bis dessen Regierung, geschwächt von internen Querelen und Machtkämpfen, 1997 von »New Labour« unter Tony Blair entmachtet wurde.
Die wichtigste Zielscheibe der Verfechter kontrafaktischer Geschichte war eindeutig der Marxismus oder das, was sie dafür hielten. So nannte Andrew Roberts drei führende marxistische...
| Erscheint lt. Verlag | 6.10.2014 |
|---|---|
| Übersetzer | Richard Barth |
| Verlagsort | München |
| Sprache | deutsch |
| Original-Titel | Altered Pasts: Counterfactuals in History |
| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Geschichte / Politik |
| Geisteswissenschaften ► Geschichte | |
| Schlagworte | Altered Pasts • Altered Pasts, Was wäre wenn, Holocaustleugner • eBooks • Geschichte • Holocaustleugner • Was wäre wenn |
| ISBN-10 | 3-641-14269-5 / 3641142695 |
| ISBN-13 | 978-3-641-14269-8 / 9783641142698 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 398 KB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich