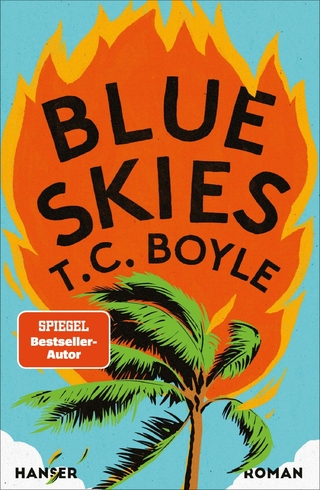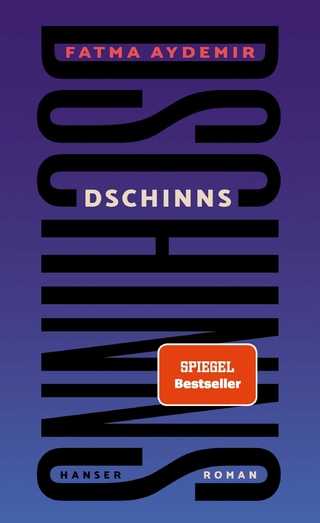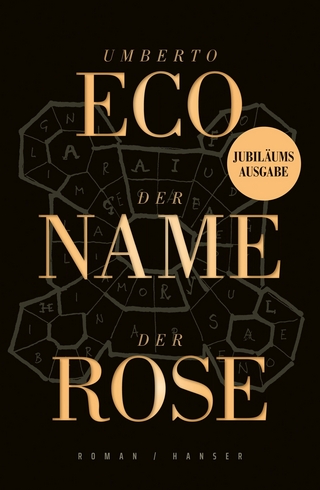Gelegenheiten (eBook)
300 Seiten
Suhrkamp (Verlag)
978-3-518-73825-2 (ISBN)
Seit langem sind die erzählerischen und lyrischen Wortmeldungen Jürgen Beckers im Bewusstsein der literarischen Öffentlichkeit fest verankert. Aus mehr als fünf Jahrzehnten stammt ein eigensinniges und polyphones Werk, das immer auch im historischen Kontext und in seiner Korrespondenz mit den Nachbarkünsten gesehen werden will: Malerei, Musik, Fotografie sind Elemente, die sich direkt in das poetische Werk des Autors eingeschrieben haben. Parallel dazu hat sich Jürgen Becker immer auch in reflexiver Form mit poetologischen Fragestellungen und zeitgenössischen Positionen in den verschiedenen Künsten auseinandergesetzt. Erhellend sind seine Rezensionen amerikanischer Literatur, insbesondere der Lyrik, die seine eigene Schreibweise beeinflusst hat. Daneben stehen Beckers Positionen in der Beschäftigung mit Büchern u. a. von Uwe Johnson, Peter Handke, Peter Weiss und Günter Grass.
Gabriele Ewenz' Edition macht diese wichtigen und erhellenden Texte erneut zugänglich. Sie werden flankiert von Gesprächen und Reden, in denen sich Becker dezidiert über biographische Aspekte sowie gattungsspezifische Fragestellungen im Kontext seines Werkes äußert.
<p>Jürgen Becker wurde 1932 in Köln geboren und verbrachte dort seine Kindheit. Während der Kriegs- und Nachkriegsjahre, zwischen 1939 und 1947, lebte er in Erfurt. Nach Aufenthalten in Osterwieck/Harz und Waldbröl kam er 1950 nach Köln zurück. 1953 Abitur. Nach kurzem, abgebrochenem Studium begann er seine Existenz als freier Schriftsteller; seinen Lebensunterhalt bestritt er jahrelang mit wechselnden Tätigkeiten, als Arbeiter und Angestellter, als Werbeassistent und Journalist. Er arbeitete für den WDR und in den Verlagen Rowohlt und Suhrkamp. Zwanzig Jahre lang, bis 1993, leitete er die Hörspielredaktion des Deutschlandfunks.</p> <p>Große Aufmerksamkeit fand Jürgen Becker mit seinem ersten Prosabuch <i>Felder</i> (1964); die beiden folgenden Bücher <i>Ränder</i> (1968) und <i>Umgebungen </i>(1970) festigten seinen Ruf als Verfasser experimenteller Literatur. Zugleich wirkte er mit seinen ersten Hörspielen (<i>Bilder, Häuser, Hausfreunde</i>) am Entstehen des "Neuen Hörspiels" mit. In seinem 1971 veröffentlichten Fotobuch<i> Eine Zeit ohne Wörter</i> verschmolz er seine literarische Arbeit mit dem visuellen Medium. Die künstlerischen Grenzüberschreitungen der Avantgarde hatte er 1965 bereits mit dem Band <i>Happenings</i> dokumentiert, einer Gemeinschaftspublikation mit dem Happening-Künstler Wolf Vostell.<br /> In den Siebziger und achtziger Jahren konzentrierte sich Jürgen Becker auf die Lyrik. Die in dieser Zeit entstandenen Gedichtbücher - darunter <i>Das Ende der Landschaftsmalerei</i> (1974), <i>Odenthals Küste</i> (1986), <i>Das Gedicht der wiedervereinigten Landschaft</i> (1988) - plazierte die Kritik in die obersten Ränge der zeitgenössischen Poesie. Gleichzeitig schrieb Jürgen Becker weiterhin Hörspiele und die beiden Prosabücher <i>Erzählen bis Ostende</i> (1980) und <i>Die Türe zum Meer</i> (1983). Dazu korrespondierte er weiterhin mit dem visuellen Medium: <i>Fenster und Stimmen </i>(1982), <i>Frauen mit dem Rücken zum Betrachter</i> (1989), <i>Korrespondenzen mit Landschaft </i>(1996) entstanden nach Collagen seiner Frau, der Malerin Rango Bohne, <i>Geräumtes Gelände</i> (1995) nach Bildern seines Sohnes, des Fotografen Boris Becker.<br /> Wende und Wiedervereinigung wirkten entscheidend auf das Schreiben Jürgen Beckers ein. Die Wiederentdeckung der ...
Jürgen Becker wurde 1932 in Köln geboren und verbrachte dort seine Kindheit. Während der Kriegs- und Nachkriegsjahre, zwischen 1939 und 1947, lebte er in Erfurt. Nach Aufenthalten in Osterwieck/Harz und Waldbröl kam er 1950 nach Köln zurück. 1953 Abitur. Nach kurzem, abgebrochenem Studium begann er seine Existenz als freier Schriftsteller; seinen Lebensunterhalt bestritt er jahrelang mit wechselnden Tätigkeiten, als Arbeiter und Angestellter, als Werbeassistent und Journalist. Er arbeitete für den WDR und in den Verlagen Rowohlt und Suhrkamp. Zwanzig Jahre lang, bis 1993, leitete er die Hörspielredaktion des Deutschlandfunks. Große Aufmerksamkeit fand Jürgen Becker mit seinem ersten Prosabuch Felder (1964); die beiden folgenden Bücher Ränder (1968) und Umgebungen (1970) festigten seinen Ruf als Verfasser experimenteller Literatur. Zugleich wirkte er mit seinen ersten Hörspielen (Bilder, Häuser, Hausfreunde) am Entstehen des "Neuen Hörspiels" mit. In seinem 1971 veröffentlichten Fotobuch Eine Zeit ohne Wörter verschmolz er seine literarische Arbeit mit dem visuellen Medium. Die künstlerischen Grenzüberschreitungen der Avantgarde hatte er 1965 bereits mit dem Band Happenings dokumentiert, einer Gemeinschaftspublikation mit dem Happening-Künstler Wolf Vostell. In den Siebziger und achtziger Jahren konzentrierte sich Jürgen Becker auf die Lyrik. Die in dieser Zeit entstandenen Gedichtbücher - darunter Das Ende der Landschaftsmalerei (1974), Odenthals Küste (1986), Das Gedicht der wiedervereinigten Landschaft (1988) - plazierte die Kritik in die obersten Ränge der zeitgenössischen Poesie. Gleichzeitig schrieb Jürgen Becker weiterhin Hörspiele und die beiden Prosabücher Erzählen bis Ostende (1980) und Die Türe zum Meer (1983). Dazu korrespondierte er weiterhin mit dem visuellen Medium: Fenster und Stimmen (1982), Frauen mit dem Rücken zum Betrachter (1989), Korrespondenzen mit Landschaft (1996) entstanden nach Collagen seiner Frau, der Malerin Rango Bohne, Geräumtes Gelände (1995) nach Bildern seines Sohnes, des Fotografen Boris Becker. Wende und Wiedervereinigung wirkten entscheidend auf das Schreiben Jürgen Beckers ein. Die Wiederentdeckung der Orte und Landschaften zwischen Elbe und Oder, Rügen und Thüringer Wald motivierten seine Gedichtbände Foxtrott im Erfurter Stadion (1993) und Journal der Wiederholungen (1999), die Erzählung Der fehlende Rest (1997) und vor allem den im Sommer 1999 erschienenen Roman Aus der Geschichte der Trennungen. Mit den Vorbereitungen dazu begann er während eines Stipendiums im Künstlerhaus Schloß Wiepersdorf. Es ist Jürgen Beckers erster Roman; eine bewegende, persönliche Geschichte, die zugleich von den Widersprüchen der deutschen Erfahrungen erzählt. Jürgen Beckers Werk wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, u.a. erhielt er den Preis der Gruppe 47, den Literaturpreis der Bayerischen Akademie der schönen Künste, das Villa Massimo Stipendium, den Bremer Literaturpreis, den Heinrich Böll Preis. Jürgen Becker ist Mitglied der Akademie der Künste in Berlin-Brandenburg, der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, der Mainzer Akademie der Wissenschaften und der Literatur, sowie des PEN-Clubs. 2001 erhält er für seinen Roman Aus der Geschichte der Trennungen den Uwe-Johnson-Preis, der von der Mecklenburgischen Literaturgesellschaft vergeben wird. 2006 wird er für sein Prosa-Werk,insbesondere den Journalroman Schnee in den Ardennen, mit dem Hermann-Lenz-Preis ausgezeichnet, 2009 erhält er den Schiller-Ring. 2014 wird Jürgen Becker als »maßgebliche Stimme der zeitgenössischen Poesie« mit dem Georg-Büchner-Preis geehrt. Gabriele Ewenz, Literaturwissenschaftlerin, Studium der Literatur-, Theater- und Kunstwissenschaft in Bonn und Berlin; Leiterin des Heinrich-Böll-Archivs und des Literatur-in-Köln-Archivs (LiK) der Stadtbibliothek Köln.
Die Revolte der Widersprüche
»Die einfachste surrealistische Tat besteht darin, mit Revolvern in der Hand auf die Straße zu gehen und solange wie möglich blind in die Menge zu schießen«, schrieb André Breton, Chef-Ideologe der surrealistischen Bewegung.
Der so auf die radikalste Formel gebrachten Revolutionsbereitschaft der Breton’schen Maximen blieb indessen diese Aktion erspart. Vielmehr entstanden Gebilde, surrealistische Gebilde, die die künstlerische Landschaft des 20. Jahrhunderts ausformen halfen. Die Ergebnisse sind inzwischen klassifiziert und verhalten sich durchaus konträr dem Breton’schen Satz: »Vor allem soll man vor der Anerkennung der Masse fliehen« – was den Surrealisten auch ohne Anstrengung gelang. Daß die surrealistische Kunst schließlich ins Museum wanderte, war einer der Widersprüche, der die Bewegung mit in Frage stellte. Aber die Geschichte des Surrealismus ist nicht zuletzt die Geschichte seiner Gefährdung durch seine Widersprüche.
Was ist überhaupt Surrealismus? Ihn heute zu definieren heißt eine Synthese bilden, eine Synthese aus dem Wandel seiner Definitionen, Regeln und Absichten. Sicher ist, daß der Surrealismus primär keinen Stil brach, keinen Stil schuf – wie vergleichsweise der Kubismus. Sicher ist ebenso, daß sich der Surrealismus keineswegs allein im künstlerischen Ausdruck verstanden wissen wollte. André Breton und Philippe Soupault übten sich zunächst im Schreiben automatischer Texte, außerdem entdeckten sie jene außerordentlichen Zustände, die die Vorzimmer des Wunderbaren sind, also Traum, Hypnose, Halluzination.
Somit siedelte der Surrealismus auf dem jenseitigen Ufer der Wirklichkeit. Hier zu leben bedeutete die Absolutierung der Alogik, des Phantastischen, bedeutete die Herrschaft des Fiebers, der Nacht. Indessen besaß die Bewegung Impulse, die ihr über die eigenen Grenzen hinüberhalfen oder Tunnel ins offizielle Leben zurückschlugen. Fraglich, ob die Reflexionen über existentielle und künstlerische Möglichkeiten nicht schon ihre Reinheit aufs Spiel setzten. Gewiss jedoch, daß die Offizialisierung ihr zu einer Wirkung verhalf, die durchaus ihren Intentionen entsprach.
Von 1924 ab hören wir die ersten Stellungnahmen der Surrealisten selbst. Breton schrieb im ersten surrealistischen Manifest: »Surrealismus ist reiner psychischer Automatismus, durch den man sich vornimmt, sei es mündlich, sei es schriftlich, sei es auf ganz andere Weise, das wirkliche Funktionieren der Gedanken auszudrücken.«
Louis Aragon verkündete: »Das Surrealismus genannte Laster ist die in Unordnung gebrachte und leidenschaftliche Anwendung des Rauschgiftes Bild.«
Mit Paul Eluard, dem Lyriker, fügte sich eine neue Komponente in das theoretische Gerüst ein, die soziale Komponente, der Anspruch auf gegenseitige Kommunikation. Er sagt: »Der Surrealismus arbeitet dahin, die Unterschiede, die zwischen den Menschen bestehen, geringer zu machen.«
Mit der Veröffentlichung ihrer Thesen stieß die Bewegung auf neue Problemstellungen. Es erwies sich, daß die isolierende Selbstbeschäftigung die Theoreme sterilisierte, die doch revolutionären Elan keineswegs vortäuschend die Reibung am Realen verlangten. Daß es der logischen Sprache bedurfte, um alogische Sachverhalte auszudrücken, war bereits konzediert – der nächste Schritt führte ins kulturelle Engagement. Weiterhin wurde eingestanden, daß der Surrealismus als Erkenntnismethode ein durchaus ästhetisches Interesse entwickle hinsichtlich einer surrealistischen Literatur und Malerei. Welche Folge diese Konzession hatte, zeigt sich heute, wenn bei der Erwähnung des Begriffs Surrealismus sich im Publikum vorzüglich Erinnerung an surrealistische Bildwerke einstellt. Daß die ausführliche Weise des surrealistischen Malens, das ja ein Malen des sachlichen, gleichviel irrealen Gegenstandes ist, den spontanen Akt des assoziierenden Träumens hintanstellt, hat selbst unter den Anhängern der Bewegung Verwirrung gestiftet. Indessen blieb es das Verdienst der Künstler, mittels ihrer Dokumente das surrealistische Phänomen überhaupt greifbar gemacht und über die Jahrzehnte in die Gegenwart geschleust zu haben. Selbst André Breton und Louis Aragon besannen sich auf die Verwandlungskraft der Poesie und verschmolzen ihre Vorstellungen in Rhythmus und Reim. Und Paul Eluard, der vielleicht bedeutendste Dichter des Surrealismus, widmete ihm seine ganze Person erst nach seiner Reverenz vor der Literatur.
Es verwundert nicht, daß die Anbetung aller revolutionären Tendenzen den Surrealismus in die magnetischen Felder der Politik zog. Seinen Vorstellungen von Revolte, die ja auch das soziale Empfinden umschlossen, mußte also eine politische Idee, wie sie der Kommunismus vortrug, verwandt genug erscheinen, um ihr vorerst Sympathie, später Beitrittserklärungen zu vermitteln. Jedoch bekam dieser Pakt dem Surrealismus ebenso schlecht, wie er dem Kommunismus keine Spuren einprägte. Lediglich Missverständnisse und Aufspaltungen – was den Surrealismus anging. Seine weitere Entwicklung war gezeichnet von Differenzen zwischen ihren Wortführern. Die gemeinsame Artikulation verstummte, die Richtungen trennten und verzweigten sich, nicht nur politische Diskrepanzen trieben Keile, man ging eigene Wege.
Exemplarisch der Fall Aragon. Louis Aragon, eine Kampfnatur, war der Realist unter den Surrealisten. Kennzeichnend für ihn sein Leitsatz: »Ich will wissen, an was ich mich halten kann.« Im Unterschied zu jenen, die die surrealistische Idee mit surrealen Mitteln durchzusetzen suchten, verlegte Aragon seine menschliche und dichterische Aktivität aufs Irdische, Diesseitige. Abseits der Sekten spürte er dem Menschen nach, seine Konzeption zielte auf die Erneuerung des Menschen mittels der Revolte. Er entschied sich für das praktische Engagement, er hielt die Anerkennung des Kommunismus als Möglichkeit unter Möglichkeiten für ungenügend und verschrieb sich den Direktiven Moskaus. André Breton, der dem Surrealismus lediglich die Trotzkische Variante des Kommunismus vorbehalten wollte, unterstellte ihm Verrat und schloß ihn aus der surrealistischen Gemeinde aus. Jedoch, dessen bedurfte es nicht allein, um die spätere Entwicklung Aragons festzulegen. Er schrieb seine Gedichte, als politischer Konvertit hatte er seinen Skandal, die Widerstandsbewegung sah ihn als Initiator und Kämpfer, nach dem Krieg propagierte er die engagierte Literatur und gab eine Zeitung heraus, in letzter Zeit machte er durch seinen Roman La Semaine sainte von sich reden – Tätigkeit genug, um dem französischen Publikum die Gewißheit zu geben, einen redseligen und beflissenen Autor mehr zu besitzen.
Auch Paul Eluard distanzierte sich bereits 1938 von der sich zersetzenden Gruppe, gab aber kurz vor seinem Tod, 1952, zu, daß der Surrealismus die »Befreiung« seiner Dichtung und seine »wunderbare Fähigkeit zu lieben« bewirkt habe. Paul Eluard war auf jeden Fall einer der profiliertesten Dichter, die der Surrealismus entließ: weniger Theoretiker und Propagandist als eben reiner Poet, von dem es hieß, er sei nur zufällig Surrealist gewesen. Um so widersprüchlicher mußte demnach seine Bindung an die Kommunistische Partei erscheinen, obwohl er während des Krieges als Widerstandskämpfer, danach als Funktionär eine enorme, teilweise internationale politische Einsatzfreude entwickelte. Aragon kommentierte zwar: »Mit seinem Beispiel wird eine gewisse Konzeption vom Dichter an den Nagel gehängt. Nichts kann mehr die Tatsache ändern, daß der alte Widerspruch überholt ist, der Widerspruch zwischen reiner Dichtung und Politik« – angesichts seiner späteren Dichtungen jedoch muß man fragen, ob die neue Zufuhr von patriotischen und politischen Themen auch neue poetische Qualitäten enthalten habe. Die Flügel des Surrealismus trugen den Dichter Eluard in fruchtbares Land, aber er legte sie ab und trug sich in die Parteiliste ein – als ein Außenseiter, der seiner Isolation durch Eingliederung in die gelenkte Gemeinschaft zu entgehen suchte.
Versagte also der Surrealismus, der seine besten Talente verlor – u. a. René Char, Philippe...
| Erscheint lt. Verlag | 21.10.2018 |
|---|---|
| Verlagsort | Berlin |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Literatur ► Romane / Erzählungen |
| Schlagworte | biographisch • Georg-Büchner-Preis • Jürgen Becker • Rezensionen • ST 4831 • ST4831 • suhrkamp taschenbuch 4831 |
| ISBN-10 | 3-518-73825-9 / 3518738259 |
| ISBN-13 | 978-3-518-73825-2 / 9783518738252 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 1,8 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich