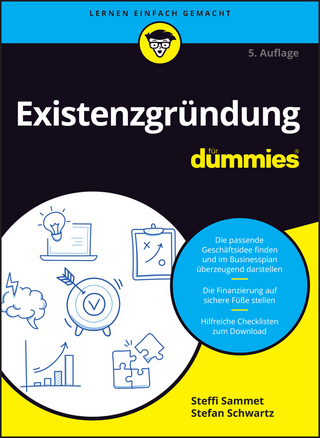Reichtum ohne Gier
"Es ist Zeit, sich vom Kapitalismus abzuwenden", sagt Sahra Wagenknecht. Denn der Kapitalismus ist längst nicht mehr so innovativ, wie er sich gibt. Bei der Lösung der großen Zukunftsfragen - von einer klimaverträglichen Energiewende bis zu nachhaltiger Kreislaufproduktion - kommen wir seit Jahrzehnten kaum voran. Für die Mehrheit wird das Leben nicht besser, sondern härter.
Es ist Zeit für eine kreative, innovative Wirtschaft mit kleinteiligen Strukturen, mehr Wettbewerb und funktionierenden Märkten, statt eines Wirtschaftsfeudalismus, in dem Leistung immer weniger zählt, Herkunft und Erbe dagegen immer wichtiger werden.
Sahra Wagenknecht fordert
- eine andere Verfassung des Wirtschaftseigentums,
- die Demokratisierung des Zugangs zu Kapital und
- die Entflechtung riesiger Konzerne, deren Macht fairen Wettbewerb und Demokratie zerstört.
- Talent und echte Leistung zu belohnen und Gründer mit guten Ideen ungeachtet ihrer Herkunft zu fördern.
Mit ihrem Buch eröffnet Wagenknecht eine politische Diskussion über neue Eigentumsformen und die vergessenen Ideale der Aufklärung. Sie legt eine scharfsinnige Analyse der bestehenden Wirtschaftsordnung vor und zeigt Schritte in ein demokratisch gestaltetes Gemeinwesen, das niemandem mehr erlaubt, sich zulasten anderer zu bereichern.
Aktualisierte Sonderausgabe 2018»Es ist Zeit, sich vom Kapitalismus abzuwenden«, sagt Sahra Wagenknecht. Denn der Kapitalismus ist längst nicht mehr so innovativ, wie er sich gibt. Bei der Lösung der großen Zukunftsfragen - von einer klimaverträglichen Energiewende bis zu nachhaltiger Kreislaufproduktion - kommen wir seit Jahrzehnten kaum voran. Für die Mehrheit wird das Leben nicht besser, sondern härter.Es ist Zeit für eine kreative, innovative Wirtschaft mit kleinteiligen Strukturen, mehr Wettbewerb und funktionierenden Märkten, statt eines Wirtschaftsfeudalismus, in dem Leistung immer weniger zählt, Herkunft und Erbe dagegen immer wichtiger werden.Sahra Wagenknecht fordert- eine andere Verfassung des Wirtschaftseigentums,- die Demokratisierung des Zugangs zu Kapital und- die Entflechtung riesiger Konzerne, deren Macht fairen Wettbewerb und Demokratie zerstört.- Talent und echte Leistung zu belohnen und Gründer mit guten Ideen ungeachtet ihrer Herkunft zu fördern.Mit ihrem Buch eröffnet Wagenknecht eine politische Diskussion über neue Eigentumsformen und die vergessenen Ideale der Aufklärung. Sie legt eine scharfsinnige Analyse der bestehenden Wirtschaftsordnung vor und zeigt Schritte in ein demokratisch gestaltetes Gemeinwesen, das niemandem mehr erlaubt, sich zulasten anderer zu bereichern.
Sahra Wagenknecht ist promovierte Volkswirtin, Publizistin und Politikerin, Mitglied des Bundestags für die Partei Die Linke, für die sie auch im Europäischen Parlament saß. Von 2010 bis 2014 war sie Stellvertretende Parteivorsitzende, von 2015 bis bis 2019 Vorsitzende der Linksfraktion. Sie betreibt einen eigenen Youtube-Kanal, auf dem sie wöchentlich aktuelle Themen kommentiert und schreibt regelmäßig eine »Focus«-Kolumne. Bei Campus sind ihre Dissertation The Limits of Choice und ihre Bücher Freiheit statt Kapitalismus (2012) und Reichtum ohne Gier (2016/2018) erschienen.
Inhalt
Vorwort 9
Leistung, Eigenverantwortung, Wettbewerb -
Die Lebenslügen des Kapitalismus
Die Schurkenwirtschaft: Ist Gier eine Tugend? 45
Glanz und Verfall: Wie innovativ ist unsere Wirtschaft? 55
Tellerwäscher-Legenden, feudale Dynastien und die verlorene Mitte 71
Leistungslose Spitzeneinkommen 71
Über die Aussichtslosigkeit des Sparens als Weg zum Kapital 81
Erbliche Vorrechte: Der Kapital-Feudalismus 87
Aufstieg war gestern. Die "Neue Mitte" ist unten 96
Räuberbarone und Tycoons - Macht statt Wettbewerb 105
Industrieoligarchen: Keine Chance für Newcomer 105
Abgesteckte Claims: Marktmacht als Innovations- und Qualitätskiller 117
Datenkraken: Monopole im Netz 122
Die sichtbare Hand des Staates 140
Warum echte Unternehmer den Kapitalismus nicht brauchen 153
Marktwirtschaft statt Wirtschaftsfeudalismus -
Grundzüge einer modernen Wirtschaftsordnung
Was macht uns reich? 165
Wie wollen wir leben? 187
Wir können anders: Gemeinwohlbanken 207
Herrscher oder Diener: Welche Finanzbranche brauchen wir? 207
Wie entsteht Geld? 218
Geld ist ein öffentliches Gut 239
Eigentum neu denken 265
Eigentumstheorien von Aristoteles bis zum Grundgesetz 265
Eigentum ohne Haftung: Der Clou des Kapitalismus 277
Vorwort Die Zeit ist aus den Fugen: Schmach und Gram, / dass ich zur Welt, sie einzurichten, kam!, ächzt Hamlet in Shakespeares berühmter Tragödie angesichts der Zustände, die er in seinem Königreich vorfindet. Sein Einrichtungsversuch endet bekanntlich in sehr viel Blut und lädt nicht zur Nachahmung ein. Aber das sollte nicht als Mahnung gelesen werden, sich mit gesellschaftlichem Zerfall abzufinden, sondern eher, diesem auf richtige Weise zu begegnen. Hamlet will zurück in die alte Zeit. Aber die Zukunft liegt im Neuen, Noch-nicht-Dagewesenen. Ideen dafür sind an ihrer Plausibilität und Überzeugungskraft zu messen, nicht daran, ob sie in Gänze schon einmal umgesetzt wurden. Denn ist nicht auch unsere Zeit aus den Fugen? Zeigen das nicht die Nachrichten, die wir Tag für Tag hören, die Zeitungen, die wir lesen, all die News, die uns online überfluten? Im Grunde spüren wir doch, dass es so wie bisher nicht weitergehen kann. Und wohl auch nicht wird. Die große Frage ist nur: Was kommt dann? Zivilisation auf dem Rückzug In vielen Regionen unseres Planeten ist die Zivilisation auf dem Rückzug. Kriege und Bürgerkriege haben den Nahen und Mittleren Osten und Teile Afrikas in einen lodernden Brandherd verwandelt. Staatliche Ordnungen zerfallen oder werden wie im Irak, in Libyen oder im Jemen durch militärische Interventionen zerstört. Das Machtvakuum füllen Warlords und islamistische Terrorbanden, die der Zivilbevölkerung noch mehr Armut, Willkür, religiöse Verfolgung, Morde und Grausamkeiten bringen. In nahezu jedem Krieg haben die USA, aber auch europäische Staaten ihre Hände im Spiel. Es geht um Rohstoffe und Absatzmärkte, um Profite und geostrategische Vorteile, um Pipeline-Routen und um das Kräftemessen mit dem alten Gegenspieler Russland, das sich nach seiner Wandlung vom Einparteienstaat zum Oligarchenkapitalismus zunächst von der Weltbühne verabschiedet hatte, inzwischen aber im Kampf um Einflusssphären wieder mitmischt, auch militärisch. Selbst in den Industrieländern, den Wohlstandsinseln mit ihrem vergleichsweise hohen Lebensstandard, ist das Leben für die Mehrheit in den zurückliegenden Jahrzehnten härter statt besser geworden. Finanzblasen, Jobs, von denen man nicht leben kann, Arbeitslosigkeit, sterbende Industrieregionen, verfallende Wohngettos, unterfinanzierte Schulen und Krankenhäuser, Armut im Alter, Lebensunsicherheit, mangelnder Schutz vor Kriminalität … - all das überschattet den Alltag vieler Menschen und macht ihnen Angst. Hassprediger, sei es von der äußersten Rechten oder eines radikalen politischen Islam, haben auch hier Zulauf. Die politische Tektonik der westlichen Gesellschaften hat Risse bekommen. Die Wahl Donald Trumps zeugt von der abgrundtiefen Enttäuschung, der aufgestauten Wut und der Ablehnung, die beachtliche Teile der amerikanischen Bevölkerung heute dem politischen Establishment und den Institutionen ihres Landes gegenüber empfinden. Lieber ein pöbelnder unverschämter Rüpel, der politische Anstandsregeln demonstrativ mit Füßen tritt, als eine korrupte Liberale - das war die Botschaft insbesondere der Arbeiterschaft, deren existenzielle Bedürfnisse von Demokraten wie Republikanern über Jahrzehnte sträflich ignoriert worden waren. In Europa hat sich 2016 das erste Land in einem Referendum für den Austritt aus der Europäischen Union entschieden. Viele Brexit- Befürworter kamen aus den alten Labour-Hochburgen in den früheren Industriestädten Englands, deren Bewohner gute Gründe haben, sich von den wechselnden Regierungen des Königreichs im Stich gelassen zu fühlen. In vielen europäischen Ländern reüssieren rechte Parteien und prägen den politischen Diskurs. In der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahl 2017 erzielte der Front National das beste Ergebnis seiner Geschichte. Ungarn und Polen werden von rechten Regierungen geführt, die Rechtsstaatlichkeit und Gewaltenteilung nicht allzu ernst nehmen, was ihrer Popularität bisher keinen Abbruch tut. In Österreich ist die FPÖ, deren Anhänger in stimmungsvollen Momenten gern mal den Arm zum Hitlergruß heben, erneut an der Regierung beteiligt. Zum unschönen Erbe der Kanzlerschaft Angela Merkels gehört, dass ihre Fehlentscheidungen erstmals in der bundesdeutschen Geschichte einer Partei rechts von der CDU?/?CSU den Weg in den Bundestag gebahnt haben. Der neofeudale Konsens Dafür, dass sich immer mehr Menschen von der liberalen parlamentarischen Demokratie abwenden, gibt es Gründe. Zu lange wurde das demokratische Versprechen der Wahlfreiheit zwischen unterschiedlichen Regierungsprogrammen von den traditionellen Parteien nicht mehr eingelöst. In manchen Ländern unterschieden sich die einstigen Arbeiterparteien von ihren konservativen Konkurrenten nur noch dadurch, dass sie beim Schleifen des Sozialstaates, bei der Privatisierung öffentlicher Leistungen und der Deregulierung des Finanzsektors besonders rabiat vorgingen. Das Wahlvolk erlebte wieder und wieder, dass Regierungen wechselten, die Politik aber im Kern die gleiche blieb. Es erlebte, dass Renten gekürzt, Löhne gesenkt und öffentliche Einrichtungen kaputtgespart wurden, während sich Wirtschaftslobbyisten mit teuren Steuersenkungs- und Subventionsanliegen Gehör verschaffen konnten. Es erlebte Wahllügen, Arroganz und Korruption. Es erlebte die eigene Ohnmacht, eine Politik, die seine Chance auf ein gutes Leben beharrlich verringerte, abzuwählen. Diese Politik wird gemeinhin als neoliberal bezeichnet, obwohl sie genau besehen weder neu noch im tieferen Sinne liberal ist. Ihr Mantra lautet: mehr Markt, mehr Wettbewerb, mehr Freiheit, mehr Leistung und Eigeninitiative, mehr Wachstum. Ihre realen Ergebnisse sind: mehr Macht für globale Mammutkonzerne, weniger Wettbewerb, mehr Einkommen aus Vermögen und weniger Lohn für Arbeitsleistung, mehr Spekulation, Betrug und Gaunerei und weniger Wachstum. Wir sollten dieses politische Programm daher besser als neofeudal bezeichnen. Es hat die Welt Wenigen zu Füßen gelegt und sie für Viele zu einem unkomfortablen Ort gemacht. Heute besitzen die reichsten 1 Prozent der Weltbevölkerung mehr als alle anderen auf der Erde lebenden Menschen zusammen. Allein 42 Multimilliardäre haben mehr Vermögen als die Hälfte der Menschheit.1 In den Industrieländern explodiert der Reichtum der oberen Zehntausend, aber er zieht die Mittelschichten und erst recht die Ärmeren nicht mehr nach. Deren Lebensstandard folgt dem gesamtwirtschaftlichen Wachstum nicht etwa nur langsamer, er folgt ihm überhaupt nicht mehr. Die Flut trägt nur noch die Luxusjachten Die Flut, die einst alle Boote heben sollte, trägt nur noch die Luxusjachten. Seit den achtziger Jahren sind die mittleren Löhne in den Vereinigten Staaten nicht mehr gestiegen und die unteren in den freien Fall übergegangen. Auf dem europäischen Kontinent, vor allem innerhalb des Euroraums, sieht es heute ähnlich aus. Auch hier gibt es mehr und reichere Milliardäre als vor zwanzig Jahren, sogar in den Krisenstaaten Griechenland, Spanien oder Italien, und zugleich weit mehr Menschen als früher, die in ihre Einkaufswagen nur noch Billigwaren legen, im Winter aus Geldmangel in unterkühlten Wohnungen sitzen und von Restaurantbesuchen oder Urlaubsreisen nur noch träumen können. Die Oberschicht wohnt im Penthouse, hat die Fahrstühle außer Betrieb gesetzt und die Leitern hochgezogen. Der Rest kann froh sein, wenn er wenigstens auf seiner Etage bleiben darf. Viele schaffen nicht einmal das. Nicht nur im krisengeschüttelten Südeuropa, auch im reichen Deutschland mit seiner boomenden Exportwirtschaft. Nach einer Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung besaßen 40 Prozent, also fast die Hälfte der deutschen Bevölkerung 2016 spürbar weniger Kaufkraft als Ende der neunziger Jahre. Die mittleren Einkommen sind trotz Wirtschaftswachstum und Dividendenregen seit knapp zwei Jahrzehnten nicht mehr gestiegen. Weder Fleiß und Qualifikation noch Zweit- und Drittjobs sind heute ein Garant dafür, sich und seiner Familie ein einigermaßen sorgenfreies Leben sichern zu können. Der Wohlstand in der von politischen Heuchlern so gern umworbenen "Mitte der Gesellschaft" ist fragil geworden. War früher individueller Aufstieg - wenn auch nicht vom Tellerwäscher zum Millionär, so doch vom Arbeiterkind zum Oberstudienrat - eine breite gesellschaftliche Erfahrung, ist es inzwischen eher der Abstieg oder zumindest die Angst davor. Selten geht es den Kindern heute besser als ihren Eltern, oft ist es umgekehrt. Sicher, es gibt sie noch, die Arbeitsplätze mit gutem Einkommen, die den klassischen Lebensstandard der Mittelschicht ermöglichen. Aber oft sind sie teuer erkauft: mit extremem Leistungsdruck und ständiger Verfügbarkeit, mit einem Leben für die Arbeit, in dem für Familie, Freunde und Freizeit wenig Raum bleibt. Und selbst für Facharbeiter und Akademiker sind auskömmliche Einkommen keine Selbstverständlichkeit mehr. Das Aufstiegsversprechen, dem der Kapitalismus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts einen wesentlichen Teil seiner Popularität verdankt, ist hohl und unglaubwürdig geworden: Weit mehr als Talent und eigene Anstrengung entscheidet inzwischen wieder die Herkunft darüber, ob der Einzelne einen der begehrten Logenplätze an der Spitze der gesellschaftlichen Einkommens- und Vermögenspyramide einnehmen kann. Wirtschaftsfeudalismus im 21. Jahrhundert Die Vermögenskonzentration in den USA und in vielen europäischen Ländern ist inzwischen so hoch wie zu Beginn des 20. Jahrhunderts, in der Endzeit der Vanderbilts, Rockefellers und Carnegies, die man wegen ihrer riesigen Reichtümer und der Art, wie sie sie erobert hatten, Räuberbarone nannte. Überhaupt ähnelt unsere wirtschaftliche Ordnung der damaligen wieder stark, nachdem viele fortschrittliche Reformen, die nach dem Zweiten Weltkrieg zu einer sozialen und demokratischen Bändigung des Kapitalismus geführt hatten, in den letzten Jahrzehnten zurückgenommen wurden. Die Verhältnisse in der Blütezeit des Kapitalismus der Räuberbarone wiederum waren den altfeudalen Zuständen nicht unähnlich. Auch im Mittelalter gehörte etwa 1 Prozent der Bevölkerung zur Oberschicht, sie besaßen die entscheidenden wirtschaftlichen Ressourcen, damals vor allem das fruchtbare Ackerland, die Weiden und Wälder. Sie waren mächtiger als die Könige, beherrschten das öffentliche Leben und bestimmten die Rechtsprechung und die Auslegung der Gesetze. Und selbstredend zahlten sie keine Steuern. Die übrigen 99 Prozent der Bevölkerung arbeiteten, direkt oder indirekt, für diese reichsten 1 Prozent. Die Vermögen und mit ihnen die gesellschaftliche Stellung wurden nach dem Prinzip von Erblichkeit und Blutsverwandtschaft von einer Generation zur nächsten weitergegeben. Der Sohn eines Bauern war wieder ein Bauer und der Sohn eines Barons wieder ein Baron, es sei denn, er entschied sich für eine Laufbahn als kirchlicher Würdenträger oder hoher Militär und blieb als solcher Teil der Oberschicht. Da stehen wir heute wieder. Auch am Beginn des 21. Jahrhunderts konzentrieren sich in der Verfügung der reichsten 1 Prozent die wichtigsten wirtschaftlichen Ressourcen, nur dass diese neben Agrarland und Immobilien heute vor allem Industrieanlagen, technisches Know-how, digitale und andere Netze, Server, Software, Patente und vieles mehr umfassen. Die Konzernbarone herrschen über die gewählten Regierungen, statt von ihnen regiert zu werden. Das Eigentum an den wirtschaftlichen Schlüsselressourcen wird unverändert nach dem Prinzip der Erblichkeit und der Blutsverwandtschaft von einer Generation zur nächsten weitergegeben. Seine Erträge werden auch heute in vielen Fällen nahezu steuerfrei eingestrichen und sie ermöglichen einen Lebensstil, wie er aus Arbeitseinkommen niemals erschwinglich wäre. Und erneut arbeiten 99 Prozent der Bevölkerung einen großen Teil ihres Lebens, direkt oder indirekt, für den Reichtum dieses neuen Geldadels. Man mag einwenden, der entscheidende Unterschied bestehe darin, dass die Wirtschaft in der feudalen Epoche kaum Fortschritte machte, weil es nur wenige Anreize gab, die Produktivität zu steigern und die Produktionsmethoden zu verbessern. Der Kapitalismus dagegen habe jenen enormen Reichtum geschaffen, der heute das Leben selbst des ärmsten Einwohners der Industriestaaten weit über das Niveau seiner Ahnen aus früheren Jahrhunderten hebt. Für die Vergangenheit trifft das zu. Aber gilt es auch für Gegenwart und Zukunft? Zwar wandelt sich die Produktion immer noch, die Digitalisierung verspricht hohe Produktivitätsgewinne, neue Verfahren finden Anwendung, neue Produkte kommen auf den Markt. Aber wem nützt eine dynamische Wirtschaft, wenn die Wohlstands- Dynamik für die Mehrheit abwärts zeigt? Und wie innovativ ist unsere Wirtschaft noch, seit ganze Branchen sich in der Hand weniger globaler Großunternehmen befinden und deren Patentpools innovative Geister in die Verzweiflung treiben? Ist nicht vieles, was wir heute dem Kapitalismus als Leistung zurechnen, Ergebnis einer sehr besonderen Epoche, deren Spezifik gerade darin bestand, dass es gelang, den Kapitalismus weniger kapitalistisch zu machen? Der gebändigte Kapitalismus Nach den Katastrophen des zwanzigsten Jahrhunderts - zwei Weltkriege, eine dramatische Weltwirtschaftskrise, faschistische Diktaturen und rassistisch motivierter Völkermord - war die Einsicht weit verbreitet, dass ein ungezügelter Kapitalismus einen Grad an Ausbeutung und Ungleichheit produziert, der letztlich jede Gesellschaft destabilisiert, und dass einem solchen System ein Hang zur Selbstzerstörung innewohnt. Das Bonmot eines englischen Gewerkschaftsführers, das Karl Marx in einer Fußnote seines Kapital berühmt gemacht hat - "Mit entsprechendem Profit wird Kapital kühn. 10 Prozent sicher, und man kann es überall anwenden; 20 Prozent, es wird lebhaft; 50 Prozent, positiv waghalsig; für 100 Prozent stampft es alle menschlichen Gesetze unter seinen Fuß; 300 Prozent, und es existiert kein Verbrechen, das es nicht riskiert, selbst auf die Gefahr des Galgens" -, hatte sich auf so grauenvolle Weise bewahrheitet, dass es kaum noch eine ökonomische Denkschule mit politischem Einfluss gab, die für ungehemmte Kapitalfreiheiten plädierte. Der deutsche Ordoliberalismus wie der Keynesianismus waren sich in dem Punkt einig, dass der Beherrschung von Märkten und Staaten durch große Firmen die Basis entzogen werden muss, wenn Demokratie und soziale Marktwirtschaft eine Chance erhalten sollten. Deshalb setzten sie sich für eine De-Globalisierung der Wirtschaft und vor allem der Finanzmärkte ein, für lokale Wirtschaftskreisläufe, die Entflechtung großer Konzerne, scharfe Kartellgesetze und strikte staatliche Regeln zur Bändigung der Renditejagd. John Maynard Keynes war überzeugt: "Ideen, Kunst, Wissen, Gastfreundschaft und Reisen sollten international sein. Dagegen sollten Waren lokal erzeugt werden, wo immer dies vernünftig möglich ist; vor allem aber die Finanzen sollten weitgehend im nationalen Kontext verbleiben."2 Damals wäre noch niemand auf die Idee gekommen, ein solches Anti-Globalisierungsprogramm als "nationalistisch" zu diffamieren, vielleicht auch, weil man im Jahr 1933, als Keynes das schrieb, mit den Nazis in Deutschland vor Augen hatte, was echter Nationalismus und Rassismus bedeuten: nicht die Konzentration auf die Verhältnisse im eigenen Land, sondern die aggressive Verfolgung globaler Ambitionen durch Unterwerfung und Vernichtung anderer Völker; nicht die Wahrung der eigenen Souveränität und Identität, sondern die Verachtung anderer Kulturen und das Zertrümmern der Souveränität anderer Länder. De-Globalisierung und Wohlfahrtsstaat Der Kopf der Freiburger Schule, Walter Eucken, ging nach Kriegsende so weit, zur Verhinderung des erneuten Entstehens wirtschaftlicher Machtkonzentration ein Niederlassungsverbot für multinationale Unternehmen auf dem europäischen oder mindestens dem deutschen Markt zu fordern. Er wollte, dass "das Eindringen internationaler Konzerne vom Osten und vom Westen zum Stehen kommt und rückgängig gemacht wird".3 Aber auch ohne formellen politischen Beschluss hatten Krise, Krieg und der Zusammenbruch der Kolonialreiche die globalen Wirtschaftsstrukturen weitgehend durchtrennt und den internationalen Kapitalmarkt zerstört. Diese De-Globalisierung der Wirtschaft führte zu einer Machtverschiebung zwischen Nationalstaat und Großunternehmen, die die Entstehung halbwegs funktionsfähiger Demokratien in den westlichen Industrieländern erst möglich machte. Unter diesen Voraussetzungen entstanden die modernen Wohlfahrtsstaaten, die das Kapital auf jene 10 oder 20 Prozent Profit reduzierten, der sich als nutzbringender Anreiz wirtschaftlichen Wachstums kanalisieren ließ, und die durch eine Reihe neuer Institutionen dafür sorgten, dass die große Mehrheit der Bevölkerung an diesem Wachstum teilhaben konnte. Zu den neuen Institutionen gehörte ein engmaschiges soziales Netz, das Beschäftigte für Lebensrisiken wie Krankheit und Arbeitslosigkeit und für ihr Alter absicherte. Zu ihnen gehörten öffentliche Dienste, die lebenswichtige Bereiche gänzlich dem Kommerz entzogen und sie dem Nutzer preiswert oder kostenlos zur Verfügung stellten. Die wichtigsten unter ihnen waren die Gesundheitsversorgung, die Bildung, der Wohnungsmarkt, die Post und Kommunikation, der Nah- und Fernverkehr, die Energieversorgung, außerdem kulturelle Einrichtungen und in vielen Ländern auch wesentliche Teile des Finanzsektors. Tragende Säule der Wohlfahrtsstaaten war ein gesetzlicher Rahmen für den Arbeitsmarkt, der die zum Ausspielen der Arbeiter gegeneinander bewährte Praxis des hire and fire unmöglich machte. Die neuen Arbeitsmarktregeln stabilisierten die Arbeitsverhältnisse und begünstigten dadurch Lohnkämpfe und einen hohen Organisationsgrad der Gewerkschaften, insbesondere in den klassischen Industrien und im öffentlichen Dienst. Im Ergebnis wurden die Marktgesetze für große Teile des Arbeitsmarktes außer Kraft gesetzt. Während auf einem offenen Markt das Ungleichgewicht von Angebot und Nachfrage den Preis bewegt und daher bei Arbeitslosigkeit (also fast immer) die Löhne bestenfalls stagnieren, aber nie relevant steigen, schaffen breit organisierte, durch Kündigungsschutz und gute Sozialgesetze unterstützte Gewerkschaften eine Art Preiskartell. Ein Preiskartell bedeutet, dass die Anbieter eines Produkts sich verabreden, ihre Ware nicht unterhalb eines bestimmten Preises anzubieten, unabhängig davon, wie die Nachfrage sich entwickelt. Wenn Unternehmen solche Preisabsprachen treffen, dient das in der Regel dazu, Extragewinne für sich herauszuschlagen, weshalb diese Praxis mit Kartellstrafen geahndet wird, wenn die betreffenden Firmen sich erwischen lassen. Aber die Arbeit ist nicht irgendein Produkt. Auf dem Arbeitsmarkt sind längerfristig steigende Löhne und damit eine Teilhabe der Beschäftigten am Wirtschaftswachstum nur durchsetzbar, wenn es gelingt, die Marktgesetze durch ein solches Preiskartell auszuschalten. Dass der Arbeitsmarkt wiederum kein Markt sein muss, um Vollbeschäftigung zu erreichen, zeigte sich spätestens Ende der sechziger Jahre, als es in den meisten Industrieländern nur noch wenige Arbeitssuchende, aber viele freie Stellen gab. Natürlich soll man die Nachkriegsjahrzehnte nicht idealisieren. Für Andersdenkende, Anderslebende oder auch nur Andersaussehende waren es oft keine guten Zeiten. Das damals noch vorherrschende Ideal der Alleinverdienerehe mit klarer Zuständigkeit des weiblichen Teils der Bevölkerung für Heim und Herd ist sicher nicht das, wovon eine moderne Frau träumt. Trotzdem bleibt es eine Tatsache, dass die alten Wohlfahrtsstaaten der Mehrheit der Menschen ein besseres und vor allem sichereres Leben ermöglichten als der globalisierte Konzernkapitalismus unserer Tage, denn sie boten ihnen stabile Beschäftigung, reale Aufstiegschancen und soziale Sicherheit. Wenn Menschen, die diese Zeit noch erlebt haben, vor allem solche aus der Arbeiterschaft, sich nach ihr zurücksehnen, ist das kein rückwärtsgewandter Traditionalismus, sondern verständlich und berechtigt. Die große Lüge des Neofeudalismus Die Zerstörung dieses Modells und die erneute Entfesselung der grenzenlosen Jagd nach dem Höchstprofit begannen in den achtziger Jahren unter der britischen Premierministerin Maggie Thatcher und dem amerikanischen Präsidenten Ronald Reagan. Endgültig aufgekündigt wurde der New Deal eines sozial und demokratisch gebändigten Kapitalismus aber erst nach dem Ende des Kalten Krieges. Die Aufkündigung erfolgte unter dem Vorwand, sich einer neuen Entwicklung - der Globalisierung - anpassen und alle Bereiche der Gesellschaft den neuen Anforderungen gemäß modernisieren zu müssen. Die wie eine Naturgewalt über uns gekommene Auflösung traditioneller Besitzstände im Zeitalter der Globalisierung ist die Schlüsselerzählung des Neofeudalismus. Und obwohl diese Erzählung von Reagan bis Obama, von Thatcher bis Blair und von Schröder bis Merkel und Macron von höchst unterschiedlichen Politikern und Parteien verbreitet wurde und wird, beruht sie auf einer großen Lüge. Denn erstens ist die Globalisierung nichts Neues. Der Kapitalismus ist seit seiner Entstehung eine globale Wirtschaftsordnung. Die Industrialisierung in England und später auf dem Kontinent wäre unmöglich gewesen ohne jene global tätigen Handelsgesellschaften, die den Rohstoffhunger der jungen Fabriken durch Ausplünderung der Kolonien befriedigten und den Erzeugnissen der Fabrikanten Absatzmärkte in aller Welt eröffneten. An der Schwelle zum zwanzigsten Jahrhundert gab es viele international tätige Unternehmen, deren Radius mindestens bis in die Kolonien des Mutterlandes und oft darüber hinaus reichte. Der Goldstandard begründete eine globale Währungsordnung, in deren Rahmen Finanzkapital relativ frei und unreguliert zirkulierte. Dass die Globalisierung in jüngerer Zeit wegen neuer Techniken für Transport und Kommunikation und infolge der Digitalisierung eine andere Dimension annehmen konnte, ist unbestritten. Aber das ändert nichts daran, dass die Globalisierung der Wirtschaft im Kapitalismus die Regel war, die De-Globalisierung in der Mitte des letzten Jahrhunderts dagegen die Ausnahme. Diese Ausnahme allerdings war die entscheidende Bedingung für die Gestaltbarkeit des Wirtschaftslebens im Rahmen demokratischer Wohlfahrtsstaaten. Die Globalisierung ist aber nicht nur nichts Neues, ihr Durchbruch in jüngerer Zeit war auch alles andere als eine Naturgewalt. Sie war Schritt für Schritt das Ergebnis freiwilliger, durch nichts erzwungener, allerdings für gewisse Interessengruppen hocherwünschter politischer Entscheidungen. Kapitalverkehrskontrollen, Einschränkungen der Niederlassungsfreiheit, Finanzmarktregeln und vieles andere mehr verschwanden nicht von selbst, sie wurden abgebaut. Die Umgehung nationaler Regeln und Gesetze, Betriebsverlagerungen in Niedriglohnländer, globales Steuerdumping, Anwerbung billiger Arbeitskräfte aus dem Ausland, - all das konnte nur stattfinden, weil die Regierungen der Industriestaaten es ermöglicht haben. Schon der erste zarte Keim eines von den nationalen Regeln für Zinsen und Kreditvergabe befreiten globalen Finanzmarktes, der Euromarkt für Fremdwährungsanlagen in London, konnte sich nur etablieren, weil er von der britischen Regierung geduldet wurde, und er wuchs auch deshalb, weil die Zentralbanken der europäischen Länder, insbesondere die Bundesbank, ihre Währungsreserven dort angelegt haben.
| Erscheinungsdatum | 02.03.2018 |
|---|---|
| Zusatzinfo | Aktualisierte Neuausgabe 2018 |
| Verlagsort | Frankfurt |
| Sprache | deutsch |
| Maße | 136 x 216 mm |
| Gewicht | 432 g |
| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Beruf / Finanzen / Recht / Wirtschaft ► Wirtschaft |
| Sachbuch/Ratgeber ► Geschichte / Politik ► Politik / Gesellschaft | |
| Wirtschaft ► Volkswirtschaftslehre ► Finanzwissenschaft | |
| Schlagworte | Allgemeinwohl • Allmende • Anti-commons • Aufstieg ermöglichen • besser wirtschaften • betriebliche Innovation • Capitalism • Common Good • Common Property • Common resources • Commons • Eigentum • Eigentum reformieren • Equity • Erbe • Fairness • Gemeineigentum • Gemeingüter • Gemeinschaftsgüter • Gemeinwohl • Gerechtigkeit • Horizontale Gerechtigkeit • Idee • Ideen • Innovation • Justice • Kapitalismuskritik • Klima • Kollektiveigentum • Leistung belohnen • Neue Wirtschaftsordnung • Neuheit • Ownership • private enterprise • Privateigentum • Private Property • privater Sektor • private sector • Privates Unternehmen • Privatsektor • Privatunternehmen • Privatwirtschaft • property • Public welfare • Rally • Rheinischer Kapitalismus • Rhineland capitalism • Sammlungsbewegung • Social Market Economy • Soziale Herkunft • Soziale Marktwirtschaft • Tragedy of the commons • Vertikale Gerechtigkeit • Vision • Volkseigentum |
| ISBN-10 | 3-593-50875-3 / 3593508753 |
| ISBN-13 | 978-3-593-50875-7 / 9783593508757 |
| Zustand | Neuware |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
aus dem Bereich