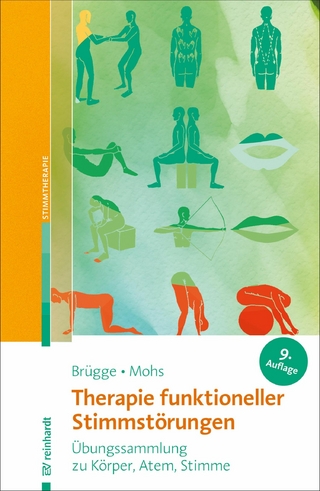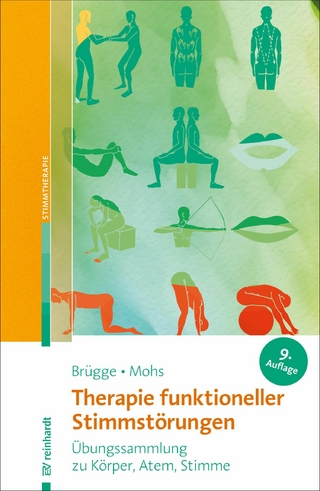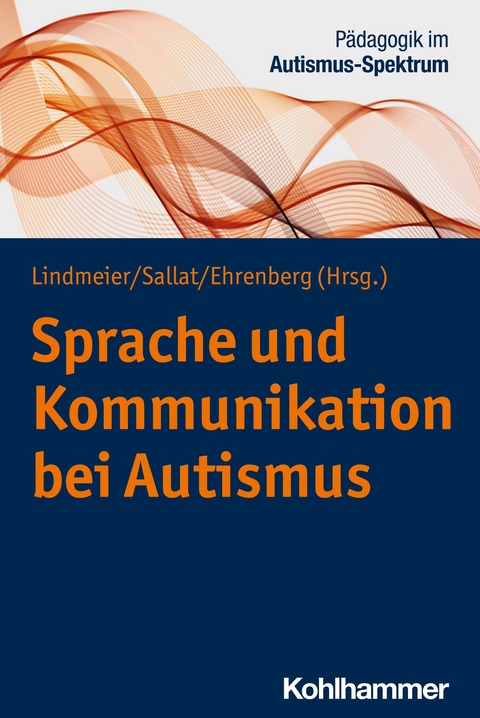
Sprache und Kommunikation bei Autismus (eBook)
304 Seiten
Kohlhammer Verlag
978-3-17-041272-9 (ISBN)
Prof. Dr. Christian Lindmeier und Prof. Dr. Stephan Sallat lehren und forschen am Institut für Rehabilitationspädagogik an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Katrin Ehrenberg ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Sonderpädagogik der Leibniz Universität Hannover.
Prof. Dr. Christian Lindmeier und Prof. Dr. Stephan Sallat lehren und forschen am Institut für Rehabilitationspädagogik an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Katrin Ehrenberg ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Sonderpädagogik der Leibniz Universität Hannover.
Vorwort
Der zweite Band der Buchreihe »Pädagogik im Autismus-Spektrum« beschäftigt sich mit dem Thema »Sprache und Kommunikation bei Autismus«. Da es zu dem Thema im deutschsprachigen Raum bislang fast ausschließlich Forschungs- und Expert*innenbeiträge aus den Feldern der Sonderpädagogik, Psychologie sowie Sprachtherapie gibt, die dem störungsorientierten Paradigma zuzuordnen sind, war es uns als Herausgeber*innen1 ein wichtiges Anliegen, auch die Perspektive der Neurodiversitätsbewegung einzubeziehen, die maßgeblich durch Expert*innen aus eigener Erfahrung geprägt ist, aber auch von Wissenschaftler*innen unterstützt wird, die zu Autismus forschen (vgl. Vorwort des Reihenherausgebers sowie Band 1 der Reihe).
Um diesem Anliegen Rechnung zu tragen, haben wir Expert*inneninterviews mit adoleszenten und erwachsenen Autist*innen und Eltern von Kindern und Jugendlichen im Autismus-Spektrum in den Band aufgenommen, die durch Autor*innen bzw. uns Herausgeber*innen selbst geführt wurden, mit dem Ziel, ihre Perspektiven auf Sprache und Kommunikation und ihre Unterstützung (Förderung, Therapie) durch pädagogische und therapeutische Fachkräfte bzw. die Zusammenarbeit mit ihnen abzubilden. Außerdem wurde die Sprach- und Identitätspolitik der autistischen Selbstvertretungs- bzw. Neurodiversitätsbewegung, die in internationalen Auseinandersetzungen über »Identity-first languge« vs. »Person-first language« Niederschlag findet, näher untersucht.
Die weiteren Beiträge des Sammelbandes wurden von Forscher*innen und Praktiker*innen mit unterschiedlicher disziplinärer Verortung verfasst. Diese interdisziplinäre Ausrichtung der Beiträge soll der Vielfältigkeit des wissenschaftlichen und praktischen Diskurses um Sprache und Kommunikation bei Autismus Rechnung tragen. Zugleich soll ein multiperspektivischer Blick auf Fragen der sprachlich-kommunikativen Entwicklung, Förderung und Therapie sowie auf die Gestaltung von kommunikativen Alltagssituationen und Gesprächen und mögliche sprachlich-kommunikative Barrieren gerichtet werden.
Eine erste Gruppe der Beiträge in diesem Band bezieht sich dabei auf das Assessment und die Unterstützung autistischer Kinder, Jugendlicher und Erwachsener, die zwar über eine funktionale Lautsprache bzw. gute expressive Sprachfertigkeiten verfügen, aber dennoch aufgrund von Einschränkungen in Semantik und Pragmatik besondere Unterstützung benötigen, um Kommunikationssituationen meistern zu können (z. B. Sprecherwechsel, Perspektivübernahme, Erkennen von Ironie, Verständnis von Redewendungen).
Eine zweite Gruppe fokussiert die Zielgruppe »nicht verbaler« und »minimal verbaler« Autist*innen2, unter die Kinder und Jugendliche mit einer verzögerten, gestörten und teilweise ausbleibenden Entwicklung der Lautsprache subsumiert werden. Im Fokus stehen Möglichkeiten der Entwicklungsbegleitung, (Früh-)Förderung und Therapie mit dem Ziel der Stärkung von Teilhabemöglichkeiten. Die Bandbreite dieser Angebote reicht von der Anbahnung von Vorläuferfähigkeiten der Sprachentwicklung sowie Möglichkeiten der Unterstützten Kommunikation über Aspekte der nonverbalen Kommunikation und Interaktion, des Wortschatzes, des Sprach- und Symbolverständnisses sowie der Erzählfähigkeit (auch unter Einbezug alternativer Kommunikationsformen). Die Förderung und Therapie von Sprache und Kommunikation sowie von sozialer Interaktion erfolgt einzeln oder in Gruppen.
Ein weiterer Zugang für diesen Band zu »Sprache und Kommunikation bei Autismus«, der mit diesen beiden Schwerpunksetzungen einhergeht, ist der bildungsbezogene institutionelle Zugang. Mehrere Beiträge beschäftigen sich mit pädagogischen Handlungsfeldern der Sprach- und Kommunikationsförderung, die in der ersten Lebenshälfte angesiedelt sind (Frühförderung, Kindertagesstätte, allgemeinbildende Schule, außerschulische Bildung, berufliche Bildung).
Zwar konzipieren wir Herausgeber*innen Autismus als Spektrum und unterstützen die Ablösung des kategorialen durch das dimensionale Erklärungsmodell im DSM-5 (APA 2013; s. auch Lindmeier 2020) und in der ICD 11 (WHO 2019). Dennoch, so meinen wir, müssen bestimmte Bedarfe von einzelnen Gruppen auf dem Spektrum besonders berücksichtigt werden. Durch die gezielte Akquirierung von Beiträgen zu nicht verbalen oder minimal verbalen Autist*innen wollten wir der Verzerrung der Forschungsergebnissen zugunsten verbaler und intellektuell fähiger autistischer Teilnehmer*innen (›selection bias towards verbal and intellectually able autistic participants‹) (Happé & Frith 2020, 219) der jüngeren sprach- und kommunikationsbezogenen Forschung und Praxis entgegenwirken, die laut Happé & Frith eng mit der historischen Entwicklung der Konzeptualisierung von Autismus verbunden ist.
In den 1980er Jahren war das Konzept des Autismus viel enger gefasst als heute, was sich daran ablesen lässt, dass in der dritten Auflage des Diagnostischen und Statistischen Handbuchs der American Psychiatric Association (DSM-3, APA 1980), in der »frühkindlicher Autismus« zum ersten Mal als eigene Diagnose aufgeführt wurde, zwei der sechs DSM-III-Diagnosekriterien die verzögerte und teilweise fehlende Sprachentwicklung thematisierten: »Grobe Defizite in der Sprachentwicklung« und »Wenn Sprache vorhanden ist, auffällige Sprachmuster wie sofortige und verzögerte Echolalie, metaphorische Sprache, Pronomenumkehr«. Der Schwerpunkt lag also auf Sprache und nicht auf Kommunikation, und es gab die Erwartung, dass viele autistische Kinder keine Sprache zeigen würden. Entsprechend wurde die Sprachstörung als zentral für Autismus angesehen, und kommunikative Aspekte traten in den Hintergrund. In den frühen 1980er Jahren wurde in Forschung und Therapie der verzögerten und atypischen Sprache bzw. Sprachentwicklung bei Autismus folglich viel Aufmerksamkeit geschenkt.
Erst Ende der 1980er Jahre veränderte sich der Fokus stärker zu funktionaler Sprache im Kontext von Autismus, und das Asperger-Syndrom wurde zunächst in die ICD-10 (WHO 1990) und das DSM-4 (APA 1994) aufgenommen. Fortan involvierte die Forschung vorrangig autistische Kinder, die keine Verzögerung der Entwicklung der expressiven Sprache und Intelligenz zeigten, so dass heute eine Vernachlässigung von intellektueller und sprachlicher Beeinträchtigung bzw. nicht oder minimal verbalen Teilnehmer*innen in Forschungsstudien zu konstatieren ist.
Ein nächster weitreichender Schritt, der in der ICD-10 durch die Aufnahme des ›atypischen Autismus‹ bereits vorbereitet wurde, wird durch das DSM-5 (APA, 2013) in Form der Überwindung einer binären Vorstellung von Asperger Autismus (funktional sprechende Kinder) einerseits und frühkindlichem Autismus andererseits vollzogen. Das durch das DSM-5 etablierte Verständnis von Autismus, das im Spektrum-Begriff zum Ausdruck kommt, hat sich inzwischen auch in weiten Teilen der Praxis etabliert. In Bezug auf Sprache geriet immerhin stärker in den Blick, dass es auch Kinder und Jugendliche im Autismus-Spektrum gibt, die trotz einer unauffälligen Sprachentwicklung pragmatisch-kommunikative Probleme aufweisen, die sich in der sozialen Interaktion mit anderen Personen zeigen. Vor diesem Hintergrund werden in der S3-Linie zur Autismustherapie (AMWF 2021) psychosoziale Interventionen empfohlen und die Einflüsse der möglicherweise auch beeinträchtigten sprachlichen Fähigkeiten weniger beachtet. Auch diese Entwicklung wird einen Einfluss auf die zukünftige Forschung zum Autismus-Spektrum haben.
Für die Gegenwart konstatieren Happé und Frith (2020), dass die sprachlichen Kompetenzen, einst ein Schwerpunkt der Autismusforschung, heute relativ wenig erforscht werden. Gleichwohl sind viele wichtige Fragen offen, auch aus der Sicht der Neurodiversitätsbewegung: Beispielsweise ist die Frage von Interesse, wie es einigen autistischen Kindern möglich ist, Sprache scheinbar ohne Verzögerung oder atypisch zu erwerben, wenn man bedenkt, dass die soziale Interaktion im frühen Spracherwerb eine entscheidende Rolle spielt (z. B. in frühen Eltern-Kind-Dialogen, für die Aufmerksamkeitslenkung/Triangulation, für das Erkennen der Absichten des*der Sprechers*in). Außerdem stellt sich die Frage, welche Rolle motorische Beeinträchtigungen oder Beeinträchtigungen im Bereich des willentlichen Handelns für das (weitgehende) Ausbleiben verbaler Sprache von non-verbalen oder minimal verbalen Autist*innen zukommt.
Zum Aufbau des Bandes
Das Ziel dieses Bandes ist – wie eingangs beschrieben – ein interdisziplinärer Blick auf Sprache, Kommunikation, Interaktion und Partizipation, der neben Forschungs- und Expert*innenbeiträgen auch die Perspektive der Expert*innen aus eigener Erfahrung und der Eltern mit einbezieht. Diese interdisziplinäre Ausrichtung und der damit verbundene multiperspektivische Blick sollen dem »zu viel« und »zu wenig« in der Beachtung von Sprache und Kommunikation bei Menschen mit Autismus entgegenwirken.
Der erste Teil des Bandes befasst sich mit den Grundlagen von Sprache und Kommunikation bei Autismus. Neben Beiträgen zur Sprach- und...
| Erscheint lt. Verlag | 26.7.2023 |
|---|---|
| Mitarbeit |
Herausgeber (Serie): Christian Lindmeier |
| Verlagsort | Stuttgart |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sozialwissenschaften ► Pädagogik ► Sonder-, Heil- und Förderpädagogik |
| Schlagworte | Diagnose • Förderung • Sprachtherapie |
| ISBN-10 | 3-17-041272-8 / 3170412728 |
| ISBN-13 | 978-3-17-041272-9 / 9783170412729 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 7,6 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich