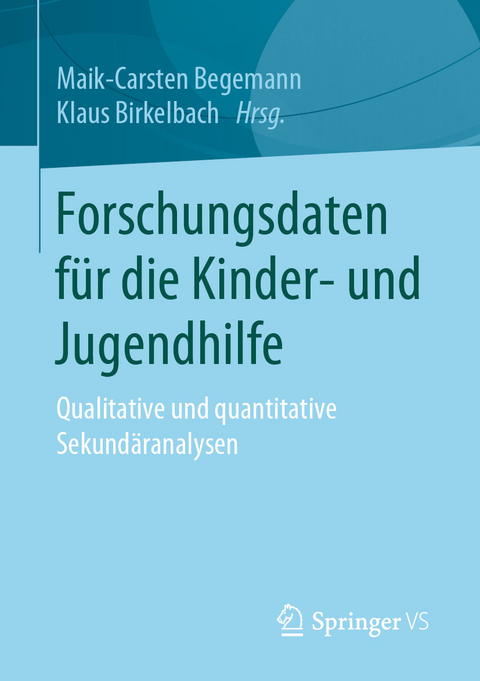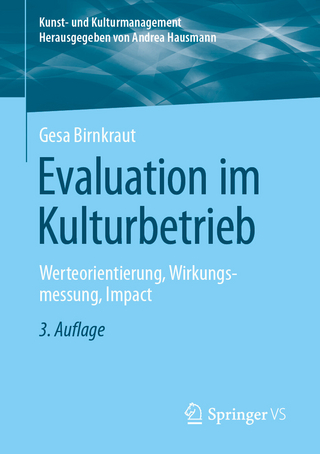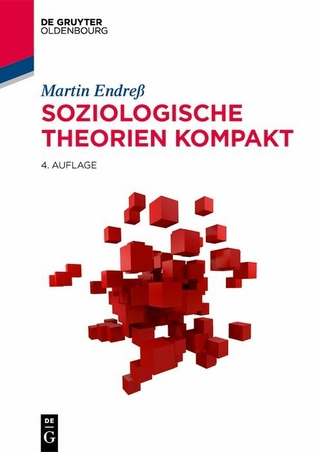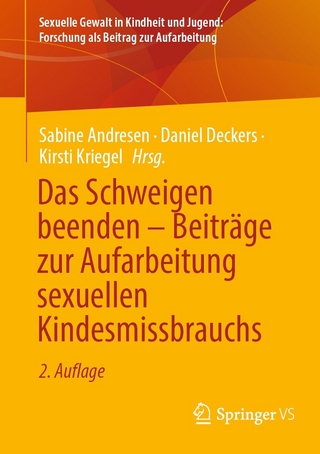Forschungsdaten für die Kinder- und Jugendhilfe (eBook)
VIII, 621 Seiten
Springer Fachmedien Wiesbaden (Verlag)
978-3-658-23143-9 (ISBN)
Der Sammelband arbeitet das bislang unterschätzte, jedoch zunehmend an Bedeutung gewinnende Potenzial von Sekundäranalysen in der Kinder- und Jugendhilfe heraus. Dazu werden nicht nur verschiedene, bereits durchgeführte Analysen präsentiert, sondern auch Möglichkeiten für eigene Sekundärauswertungen - beispielsweise durch Beschreibung des Zugangs zu kontinuierlich erhobenen Daten - aufgezeigt.
Der Inhalt
Grundlagen • Regelmäßig erhobene Querschnittsdaten und Panelstudien • Daten der amtlichen Statistik • Akten und andere Dokumente • Systematische Auswertungen verschiedener Studien und unterschiedlicher Datenquellen zu spezifischen Themen • Trägerstatistiken • Sozialraumbezogene Daten • Datenarchive
Die Herausgeber
Dr. Maik-Carsten Begemann ist aktuell Lehrbeauftragter am Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften der Hochschule Düsseldorf.
Dr. Klaus Birkelbach ist Professor für Soziologie am Institut für Soziale Arbeit und Sozialpolitik der Universität Duisburg-Essen.
Dr. Maik-Carsten Begemann ist aktuell Lehrbeauftragter am Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften der Hochschule Düsseldorf.
Dr. Klaus Birkelbach ist Professor für Soziologie am Institut für Soziale Arbeit und Sozialpolitik der Universität Duisburg-Essen.
Inhaltsverzeichnis 5
Sekundäranalysen im Kontext der Kinder- und Jugendhilfeforschung: Eine Einführung 9
1Einleitung 9
2Datenquellen in der KJH-Forschung 14
3Die Beiträge des vorliegenden Bandes 19
Literatur 25
Teil I Grundlagen 27
Die empirische Wende 28
1Empirische Wende – eine partikulare oder eine generelle Entwicklung? 28
2Forschung und Sekundäranalysen in der Kinder- und Jugendhilfe 30
3Der gesellschaftliche Bedeutungswandel der Kinder- und Jugendhilfe 35
4Die empirische Wende der Kinder- und Jugendhilfe 38
4.1Zur Empirisierung durch das Recht 39
4.2Zur Empirisierung der Fachpraxis 42
4.3Zur Empirisierung der Forschung 44
Literatur 51
Qualitative Sekundäranalyse 55
1Einleitung 55
2Ziele, Varianten und Forschungsdesigns der Sekundäranalyse 56
3Beurteilung des Analysepotenzials der Daten 58
4Fallauswahl in Sekundäranalysen 59
5Das Problem der Kontextsensitivität 61
6Sekundäranalyse und Forschungsethik 64
Literatur 67
Sekundäranalyse quantitativer Daten 71
1Einführung 71
2Empirische Sozialforschung zur Kinder- und Jugendhilfe 72
3Sekundäranalyse in der empirischen Sozialforschung 72
4Verwendung von Sekundärdaten 77
4.1Forschungsökonomie und belastbarere Ergebnisse 77
4.2Voraussetzungen und Vorgehensweise bei einer Sekundäranalyse mit Surveydaten 79
4.3Sekundärdaten in der akademischen Lehre 81
Literatur 83
Die Erforschung der Kinder- und Jugendhilfe mittels der Triangulation von Primärerhebungen und Sekundäranalysen 87
1Einleitung 87
2Triangulation in der Empirischen Sozialforschung 88
2.1Methoden-, Theorie-, Forscher- sowie Datentriangulation 88
2.2Triangulation von Primärerhebungen und Sekundäranalysen 89
3Triangulation von Primärerhebungen und Sekundäranalysen – Das besondere Potenzial in der Kinder- und Jugendhilfe 92
3.1Projekt zur Prognose des Jugendamtsbezirksspezifischen Fachkräftebedarfs für Kindertagesbetreuung in Einrichtungen in Hessen 93
3.2Typische Anwendungsfelder, mögliche Ausweitungen und zukünftiger Bedarf 98
4Fazit und Ausblick 104
Literatur 105
Teil II Regelmäßig erhobene Querschnittsdaten und Panelstudien 110
Die Studie „Aufwachsen in Deutschland: Alltagswelten“ (AID:A) – Anlage, Inhalte und Auswertungsbeispiel zur Inanspruchnahme sozialstaatlicher Leistungen von Personen mit Migrationshintergrund 111
1Einleitung 111
2Anlage und Inhalte der Studie „Aufwachsen in Deutschland: Alltagswelten“ (AID:A) 112
3Inhalte des AID:A-Surveys 113
4Inanspruchnahme von Unterstützungsleistungen durch Personen mit Migrationshintergrund 116
4.1Ergebnisse 122
4.2Resümee der Analysen 128
Literatur 128
Das Beziehungs- und Familienpanel pairfam 131
1Einleitung 131
2Zielsetzungen von pairfam 132
3Das Forschungsdesign 134
4Die Stichprobe 138
5Die Kinder- und Erziehungsbefragung 139
5.1Die Kinderbefragung 140
5.2Die Erziehungsbefragung 141
6Das Auswertungspotenzial der Daten 142
6.1Eltern-Kind-Beziehung, Erziehung und das Wohlergehen der Kinder 142
6.2Die Inanspruchnahme von Beratungs- und Unterstützungsangeboten 146
7Zugang zu den Daten des Beziehungs- und Familienpanels 148
8Fazit 148
Literatur 149
Das Nationale Bildungspanel (NEPS) als Datenangebot für Forschungsfragen der Kinder- und Jugendhilfe 152
1Das Nationale Bildungspanel – Themenbereiche und Design 153
2Forschungsbeispiele mit den Daten des Nationalen Bildungspanels 157
2.1Soziale und migrationsspezifische Ungleichheiten im Säuglings- und Kindesalter 157
2.2Lerngelegenheiten außerhalb der Schule 161
3Zugangsmöglichkeiten zu den Daten des Nationalen Bildungspanels 163
Literatur 164
Die Haushaltspanelstudie sozio-ökonomisches Panel (SOEP) und ihre Potenziale für Sekundäranalysen 168
1Das sozio-ökonomische Panel (SOEP) – eine Panelstudie seit 1984 168
2Informationen zu allen Kindern im Haushalt 170
2.1Beispielhafte Untersuchungen unter Nutzung der Proxyinformationen 170
3Altersspezifische Instrumente mit Themenschwerpunkten 172
3.1Themengebiete des „Mutter und Kind“ Fragebogen (0 Jahre – 1 Jahr Mutter und Kind A)
3.2Themengebiete des Fragebogens „Ihr Kind im Alter von 2 oder 3 Jahren“ (Mutter und Kind B) 177
3.3Themengebiete des Fragebogens „Ihr Kind im Alter von 5 oder 6 Jahren“ (Mutter und Kind C) 177
3.4Themengebiete des Fragebogens „Ihr Kind im Alter von 7 oder 8 Jahren“ (Eltern D) 178
3.5Themengebiete des Fragebogens „Ihr Kind im Alter von 9 oder 10 Jahren“ (Mutter und Kind E) 178
3.6Themengebiete des Fragebogens „Schülerinnen und Schüler“ (11–12 Jahre) 179
3.7Themengebiete des Fragebogens „Frühe Jugend“ (14 Jahre) 179
3.8Beispielhafte Untersuchungen der altersspezifischen Instrumente 180
4Der Jugendfragebogen für 16–17-Jährige und kognitives Potenzial 181
4.1Beispielhafte Untersuchungen mit dem Jugendfragebogen 182
5Zusammenfassung und Ausblick 183
Literatur 184
Die IAB-BAMF-SOEP-Befragung von Geflüchteten 190
1Einleitung 190
2Studiendesign und Feldergebnisse aus der ersten Befragungswelle 192
2.1Hintergrund und Zielsetzung der IAB-BAMF-SOEP-Befragung von Geflüchteten 192
2.2Grundgesamtheit und Stichprobenziehung 193
2.3Die Durchführung der Befragungen 197
2.4Das Fragenprogramm 200
2.5Datenzugang 202
3Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in der IAB-BAMF-SOEP-Befragung von Geflüchteten 204
3.1Größe und Zusammensetzung der Stichprobe 204
3.2Familiäre Situation 204
3.3Schulische Allgemeinbildung 207
3.4Berufliche Bildung 209
3.5Erwerbstätigkeit der jungen Erwachsenen 210
4Zusammenfassung und Fazit 210
Literatur 211
Forschungsdaten für die Berufsbildungsforschung: Das BIBB-FDZ 213
1Einleitung 213
2Die Forschungsdaten des BIBB-FDZ 214
2.1Strukturierung der Forschungsdaten 214
2.2Datenzugang 222
3Ausgewählte Studien und Ergebnisse 224
3.1Die BIBB-Übergangsstudie 2006 und 2011 224
3.2Das BIBB-Qualifizierungspanel 227
3.3Die BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung 2006 und 2012 229
4Fazit/Ausblick 230
Literatur 231
Teil III Daten der amtlichen Statistik 235
Kinder- und Jugendhilfestatistik 236
1Strukturen und Konstruktionsprinzipien 238
1.1Erhebungsdimensionen und ihre Gründe 238
1.2Organisation und Durchführung der Erhebungen 243
2Details zu den Erfassungsinhalten 245
2.1Erzieherische Hilfen und sonstige Hilfen (Teil I) 245
2.2Angebote der Kinder- und Jugendarbeit (Teil II) 248
2.3Einrichtungen und tätige Personen (Teil III) 249
2.3.1 Erhebungen zur öffentlich organisierten Kindertagesbetreuung 250
2.3.2 Erfassung von Strukturen anderer Arbeitsfelder 251
2.4Ausgaben und Einnahmen (Teil IV) 251
3Weiterentwicklungsoptionen für eine bessere Nutzung der Ergebnisse in der Kinder- und Jugendhilfeforschung 252
4Resümee 254
Literatur 255
Die amtliche Schulstatistik als Datenquelle für die Kinder- und Jugendhilfe 258
1Einleitung 258
2Zum Verhältnis der pädagogischen Institutionen Schule und Kinder- und Jugendhilfe 259
3Die amtliche Schulstatistik 260
3.1Hintergründe, Systematik und Quellen der amtlichen Schulstatistik 260
3.2Ausgewählte Anwendungsfelder und Möglichkeiten der Datenanalyse mit amtlichen Schuldaten 263
4Sekundäranalysen mit amtlichen Schulstatistiken in ausgewählten Datenbereichen 265
4.1Regionale/räumliche Differenzen der Bildungssituationen 265
4.2Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund 267
4.3Integration von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischen Förderbedarfen 269
4.4Ganztagsangebote und ganztätige Betreuung 271
4.5Übergänge und Schulabschlüsse 273
5Schlussbetrachtung 275
Literatur 276
Sekundäranalysen der amtlichen Statistik – Mikrozensus 279
1Grundinformationen 279
1.1Erhebungsprogramm 280
1.2Stichprobe 283
1.3Hochrechnung 284
1.4Konzepte und Definitionen 285
1.4.1 Bevölkerungsbegriff 285
1.4.2 Familien und Lebensformen 286
1.4.3 Erwerbstätigkeit und atypische Erwerbsformen 287
1.4.4 Berufe und Berufsklassifikationen 288
1.5Nutzung des Mikrozensus 288
2Exemplarische Analysen zu Beschäftigungsbedingungen in sozialen Berufen 289
3Fazit 296
Literatur 297
Teil IV Akten und andere Dokumente 299
Die prozessorientierte Aktenanalyse 300
1Problemstellung 300
2Die Bedeutung der Aktenführung in der Kinder- und Jugendhilfe 301
3Aktenanalyse als sozialwissenschaftliche Methode 302
4Die prozessorientierte Aktenanalyse 303
4.1Vorbereitung und Vorstudie 304
4.1.1 Prozessmodellierung 304
4.1.2 Qualitative Inhaltsanalyse 304
4.1.3 Kommunikative Validierung 304
4.2Erhebungsphase 305
4.3Die besondere Rolle des Datenschutzes 305
4.4Auswertungsphase 306
5Ein Beispiel: Aktenanalyse in den Sozialen Diensten der Justiz 306
5.1Anlass und Auftrag 307
5.2Vorstudie zur Aktenführung der Sozialen Dienste der Justiz 307
5.3Praktisches Vorgehen in der Haupterhebung 309
5.4Ergebnisse 311
5.5Diskussion der Ergebnisse 313
5.6Methodische Einschränkungen 314
6Transfermöglichkeiten in das Feld der Kinder- und Jugendhilfe 315
7Fazit 316
Literatur 317
Erfolg und dessen Einflussfaktoren in Therapeutischen Jugendwohngruppen – eine retrospektive Aktenanalyse 319
1Einführung 319
1.1Das Konzept Therapeutischer Wohngemeinschaften 320
1.2Stand der Forschung 322
2Methodik 323
2.1Quantitatives Forschungsdesign 323
3Ergebnisse der Aktenanalyse 325
3.1Stichprobe 325
3.2Interventionsbedürftige Probleme 325
3.3Erfolg und Einflussfaktoren 326
3.4Verbleib der Jugendlichen nach Abschluss der Maßnahme 328
4Diskussion 329
Literatur 331
Jugendgerichtsakten als Datengrundlage für wissenschaftliche Fragestellungen der Kinder- und Jugendhilfe 334
1Einleitung 334
2Jugendgerichtsakten als Datengrundlage für Forschung in der Kinder- und Jugendhilfe 336
2.1Inhalt von Jugendgerichtsakten 336
2.2Zugang zu Daten 338
2.3Datenqualität 339
3Auswertung von Jugendstrafakten 341
3.1Quantitative Auswertung 342
3.2Qualitative Analyse 343
4Beispiele von Forschung auf der Grundlage von (Jugend-)Strafakten 344
4.1Delikte und Delikthintergründe verstehen: Phänomenbeschreibung am Beispiel von Tötungsdelikten an Kindern 345
4.2Die Sanktionspraxis besser verstehen: Evaluationsforschung am Beispiel der Evaluation von § 16a JGG 348
5Fazit 350
Literatur 351
Analysen von publizierten Dokumenten 354
1Die Kinder- und Jugendhilfe in öffentlichen Debatten 354
2Zur Wahl des Beobachtungszeitraums 356
3Zur Auswahl der Medien 359
4Methodische Entscheidungen: Inhaltsanalyse oder Diskursanalyse? 361
5Ein Forschungsbeispiel: Zur Entwicklung der Säuglingsheime 364
6Nutzen und Grenzen der Analyse von Dokumenten 367
Literatur 368
Teil V Systematische Auswertungen verschiedener Studien und unterschiedlicher Datenquellen zu spezifischen Themen 371
Sekundäranalysen in der Schulsozialarbeit 372
1Schulsozialarbeit – Ein äußerst unübersichtliches Arbeitsfeld der Kinder- und Jugendhilfe 373
2Allgemeine Datenlage zur Schulsozialarbeit 373
3Bundesweite Sekundäranalysen zur Schulsozialarbeit 376
3.1Bundesweite Kinder- und Jugendhilfestatistik 376
3.2„AID:A II – Aufwachsen in Deutschland: Alltagswelten“ des Deutschen Jugendinstituts 379
4Landesweite Sekundäranalysen zur Schulsozialarbeit 381
4.1Sekundäranalysen zur Schulsozialarbeit in Sachsen-Anhalt 382
4.2Sekundäranalysen zur Jugendsozialarbeit in Schulen in Berlin 385
5Ausblick 388
Literatur 389
Wie können Wirkungen pädagogischer Interventionen gemessen werden? 390
1Das pädagogische Modell von Entwicklung 391
1.1Entwicklung als Eigenleistung, die auf Anregungen angewiesen ist 391
1.2Entwicklung in Verhältnissen 393
2Forschung auf der Basis eines pädagogischen Modells 394
2.1Erlebensperspektive und Deutungsmuster 394
2.2Multiperspektivität 395
2.3Prozesse in Interdependenzgeflechten 395
3Metaanalyse ausgewählter qualitativer Studien 396
4Synthese der Ergebnisse 414
5Zusammenfassung 417
Literatur 417
Was wirkt in der Kinder- und Jugendhilfe? Metaanalysen von quantitativen Studien zu den Hilfen zur Erziehung 419
1Einleitung 419
2Von Menschen, Institutionen und dem Begriff der Wirkung 421
2.1Die Frage nach Wirkung als Frage nach Verantwortung 422
2.2Transitionen, Biografie und die subjektive Wirkungsebene 424
3Metaanalyse ausgewählter Studien 425
3.1Zentrale Vorbemerkungen zur Möglichkeiten und Grenzen der Metaanalyse 425
3.2Einflüsse von zentralen Prozessmerkmalen auf Wirkungen 427
3.3Einflüsse von zentralen Strukturmerkmalen auf Wirkungen 429
3.4Einflüsse von Merkmalen der Kinder und Jugendlichen und ihrer Bezugssysteme 432
4Kritische Reflexion der Erkenntnisse aus der Metaanalyse 432
5Fachliche Konklusionen 434
Literatur 436
Sekundäranalysen von empirischen Studien zur Jugend(verbands)arbeit bis 1990 440
1Einleitung 440
2Herangehensweise und Vorstrukturierung des Beitrages 441
3Recherche, Auswertung, Systematisierung und Schreibprozess 443
4Ergebnisse 444
5Schlussbemerkung 448
Literatur 449
Die Verwendung von Schuleingangsdaten für bildungs- und familienökonomische Analysen – das Beispiel der Analyse von Elterngeldeffekten auf sozioökonomische Unterschiede bei kindlichen Entwicklungsmaßen 450
1Einleitung 450
2Beispielhafte Analyse: Wirkungen des Elterngeldes auf sozioökonomische Unterschiede in der kindlichen Entwicklung 452
2.1Hintergrund 452
2.2Unterschiedliche Auswirkungen des Elterngelds auf Einkommen und Erwerbstätigkeit 453
2.3Was ist für die kindliche Entwicklung zu erwarten? 454
2.4Datengrundlage 456
2.5Methodisches Vorgehen 457
2.6Ergebnisse 459
3Weitere bildungs- und familienökonomische Studien auf Basis von Schuleingangsdaten 462
4Schlussbemerkungen 464
Literatur 466
Schuleingangsuntersuchung: Chancen und Stolpersteine am Beispiel früher Bildungsungleichheit 468
1Einleitung 468
2Schuleingangsuntersuchung 469
3Schuleingangsuntersuchung der Stadt Osnabrück 470
3.1Kognitive Kompetenz: CPM-Testscore 471
3.2Deutsche Sprachkompetenz: Förderbedarf in der deutschen Sprache 472
3.3Beurteilung der Schulfähigkeit 472
3.4Ergänzende Merkmale 472
4Bisherige Ergebnisse mit diesen Daten 473
4.1Kognitive Kompetenz (CPM-Testscore) 475
4.2Sprachliche Kompetenz (Förderbedarf in Deutsch) 478
4.3Start der Bildungskarriere (Beurteilung der Schulfähigkeit) 478
5Zusammenfassung und Ausblick 483
Literatur 484
Forschung zu Segregation im Elementarbereich: Die Rekonstruktion von Kita-Kompositionen anhand von Daten der Schuleingangsuntersuchung 487
1Forschung zu Segregation im Elementarbereich 487
2Sekundäranalysen anhand von Daten der Schuleingangsuntersuchung 489
2.1Schuleingangsuntersuchungen im Kontext wissenschaftlicher Forschung 489
2.2Schuleingangsuntersuchungsdaten im Kontext von Forschung zu Segregation 490
3Rekonstruktion der Kita-Komposition 492
3.1Theoretische Vorüberlegungen und Annahmen 493
3.2Empirische Analysen und Beispielarbeiten 494
3.2.1 Kohortenbezogenes Vorgehen 495
3.2.2 Jahrgangsübergreifendes Vorgehen 496
3.2.3 Validierung anhand von Befragungsdaten 498
3.2.4 Weitergehende Analysen: Informationen zum Kita-Wechsel 500
4Fazit und Diskussion 500
Literatur 502
Teil VI Trägerstatistiken 505
Die Zentralstatistik des Deutschen Caritasverbandes e. V. 506
1Der Deutsche Caritasverband e. V. und seine Zentralstatistik 506
1.1Struktur des Deutschen Caritasverbandes e. V. 507
1.2Konsequenzen aus der Verbandsstruktur für die Statistik 508
2Methodik der Zentralstatistik 509
2.1Der Weg zu einheitlichen Regelungen 510
2.2Die Rahmenbestimmungen als Grundlage für die Erhebung 510
2.3Erkenntnisinteresse 511
2.4Grundgesamtheit 511
2.5Untersuchungseinheiten und Untersuchungsgegenstand 512
2.6Erhebungsweg 513
2.7Auswertung der Daten 514
3Ergebnisse der Zentralstatistik 514
3.1Überblick der wichtigsten Ergebnisse 515
3.2Beschäftigungsvolumen und Schwerpunkte der Fachbereiche 517
3.3Die zehn größten Einrichtungsarten 518
3.4Regionale Verteilung des Beschäftigungsvolumens 519
3.5Entwicklung des Beschäftigungsvolumens 521
3.6Größenstruktur der Rechtsträger 523
3.7Weitere Ergebnisse der Zentralstatistik 525
4Übersicht 526
Abkürzungen 527
Literatur 527
Einrichtungsstatistik der Diakonie Deutschland 528
1Einleitung 528
2Überblick: Daten zur Kinder- und Jugendhilfe in der Statistik der Diakonie 531
3Detaillierte Daten zur Kinder- und Jugendhilfe nach Einrichtungsart 533
3.1Stationäre Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe 533
3.2Teilstationäre Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe 533
3.3Beratungsstellen sowie ambulante Dienste der Kinder- und Jugendhilfe 537
3.4Ausbildungsstätten der Kinder- und Jugendhilfe 539
3.5Selbsthilfegruppen und Organisationen Freiwilligen Engagements der Kinder- und Jugendhilfe 540
4Resümee 540
Literatur 541
Teil VII Sozialraumbezogene Daten 542
Der Wegweiser Kommune – Ein Zugang zu Daten auf Gemeindeebene 543
1Einleitung 543
2Der Wegweiser Kommune – Struktur und Aufbau 544
2.1Der Statistikbereich: Ist-Daten, Prognose-Daten, Wanderungsgrafiken und die Demographietypisierung 545
2.2Aktualisierungsprozesse 550
2.3Unterschiedliche Zugänge zu den Daten des Wegweisers Kommune 551
2.4Der Wegweiser Kommune: Indikatoren mit Bezug zur Kinder- und Jugendhilfe 552
3Fazit 556
Literatur 558
Der KECK-Atlas als kleinräumiges Monitoring-Instrument – auch für die Kinder- und Jugendhilfe 559
1Der KECK Atlas: ein kostenfreies Instrument für Kommunen 559
1.1Projekthintergrund 560
1.2Chancen und Möglichkeiten der Nutzung 561
1.3Konkrete Nutzung des KECK-Atlas 563
2Analysen in der Kinder- und Jugendhilfe mit KECK 564
2.1Bevölkerungsstruktur 568
2.2Armut und soziale Ungleichheit 569
2.3Gesundheit 570
2.4Hilfen zur Erziehung 572
2.5Schule 573
2.6Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung 574
3Erfahrungen aus der Kinder- und Jugendhilfe mit KECK 576
3.1Unterstützung bei der Berichterstellung 577
3.2Aufklärung der Öffentlichkeit 578
4Fazit 579
Literatur 580
Teil VIII Datenarchive 582
Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland. Datenangebot über GESIS 583
1Einleitung 583
2GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften 584
3Übersicht Datenangebot, Bsp. 15. Kinder- und Jugendbericht, 2017 584
4Datenrecherche und Datenservices 585
5Übersicht Datenangebot über GESIS 588
Literatur 591
Literarische Textproduktionen Jugendlicher 592
1Das Datenarchiv „Kindheit und Jugend im urbanen Wandel“ an der Universität Duisburg-Essen 593
2Jugendforschung auf der Grundlage von Textproduktionen Jugendlicher – Forschungsstand und analytische Perspektiven 595
3Der Jugendaufruf 1983 und die literarästhetischen Textproduktionen Jugendlicher als Artefakte 596
4Literarästhetische Produktionen Jugendlicher als Zugang zu historischen Differenzordnungen 598
5Differenzordnungen und Subjektformen im Kontext der 1980er Jahre: eine exemplarische Analyse 600
5.1Zugehörigkeiten und Geschlechterverhältnisse: differente Markierungsformen 601
6Fazit: Potenziale einer sekundäranalytischen Analyse von Textproduktionen Jugendlicher 604
Literatur 606
| Erscheint lt. Verlag | 30.8.2019 |
|---|---|
| Zusatzinfo | VIII, 621 S. 54 Abb. |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sozialwissenschaften ► Soziologie |
| Schlagworte | childhood studies • Empirische Forschung • Jugendhilfeplanung • Methoden • Soziale Arbeit • Sozialpädagogik • Statistik • Studien zu Kindheit und Jugend |
| ISBN-10 | 3-658-23143-2 / 3658231432 |
| ISBN-13 | 978-3-658-23143-9 / 9783658231439 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 8,2 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: PDF (Portable Document Format)
Mit einem festen Seitenlayout eignet sich die PDF besonders für Fachbücher mit Spalten, Tabellen und Abbildungen. Eine PDF kann auf fast allen Geräten angezeigt werden, ist aber für kleine Displays (Smartphone, eReader) nur eingeschränkt geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. den Adobe Reader oder Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. die kostenlose Adobe Digital Editions-App.
Zusätzliches Feature: Online Lesen
Dieses eBook können Sie zusätzlich zum Download auch online im Webbrowser lesen.
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich