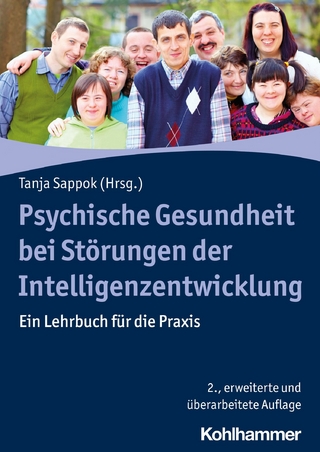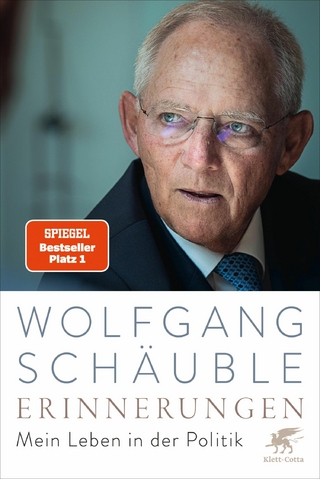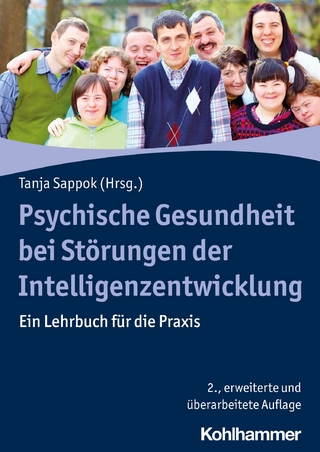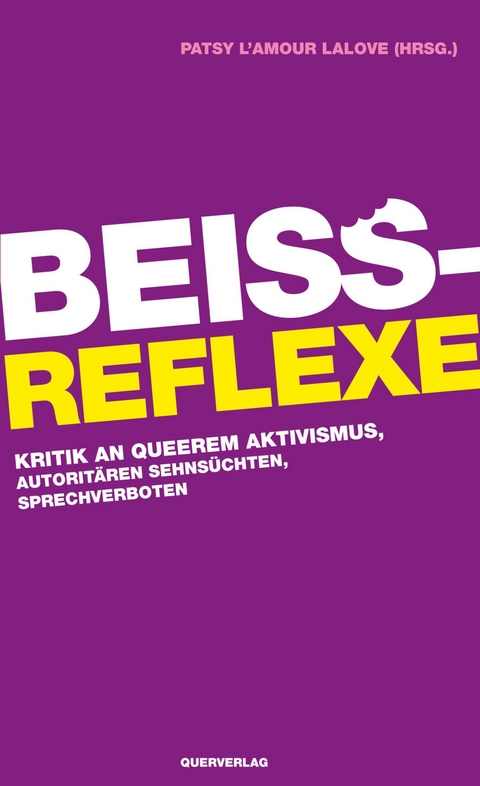
Beißreflexe (eBook)
Querverlag
978-3-89656-644-7 (ISBN)
Patsy l'Amour laLove, Polit-Tunte und Geschlechterforscherin, Dissertation zur Schwulenbewegung der 1970er Jahre, Organisatorin wissenschaftlicher und kultureller Veranstaltungen wie Polymorphia - die TrümmerTuntenNacht, arbeitet im Archiv & Kuratorium des Schwulen Museums* und als Referent des LGBTI-Referats an der HU Berlin. Im Querverlag hat Patsy den Titel Selbsthass & Emanzipation - Das Andere in der heterosexuellen Normalität 2016 herausgegeben. 2017 folgte der Sammelband Beißreflexe - Kritik an queerem Aktivismus, autoritären Sehnsüchten, Sprechverboten.
Beißreflexe
Kritik an queerem Aktivismus, autoritären Sehnsüchten, Sprechverboten
Patsy l’Amour laLove
In „Queer“ scheint das utopische Glück auf, dass die sexuell Anderen ohne Angst verschieden sein können. Queer transportiert eine Geschichte emanzipatorischen Kämpfens und ist ein theoretisch sowie politisch reizvoller Begriff, der zum Hinterfragen und zur Kritik an der heterosexuellen Normalität ebenso aufruft wie zur selbstbewussten Entgegnung der Perversen und Anderen. An dieses Queer möchte ich erinnern. Aktueller queerer Aktivismus aber konzentriert sich auf Verletzungen und ist vor allem um Verbote und Angriffe bemüht. Diese Anstrengungen könnten hin zu einem anderen Umgang mit Irritationen, Erfahrungen von Diskriminierung und Konflikten gewendet werden. Ein solcher Umgang würde die Realität des subjektiven Erlebens respektvoll würdigen und dieselben hinterfragen. Das bedeutet, die Erfahrung zu reflektieren, ohne ihren Gehalt in der unmittelbaren Überführung in Aktivismus unumwunden zur allgemeinen Wahrheit zu küren. Empathie hingegen, die den Anderen als Anderen weiß, ist gefragt angesichts des nach wie vor bestehenden Hasses auf das sexuell und geschlechtlich Andere.
In diesem Text geht es um die autoritäre Form aktuellen queeren Aktivismus, in dem statt Empathie Anprangern und Ausschluss gängige Praxis sind. Diese findet sich vorrangig in Universitäts- und Großstädten und dort in aktivistischen und akademischen Diskussionen. Den schwulen und lesbischen Aktivist_innen, die in den 1970er Jahren aktiv waren, kommen diese Praktiken meist recht vertraut vor. Stalinistische und K-Gruppen der Zeit verhielten sich ähnlich und so ist es hilfreich, sich den Erzählungen dieser älteren Bewegungsgeneration zu widmen.
Queeraktivistische und -theoretische Darstellungen wehren eine (Selbst)Kritik in aller Regel ab. Darüber hinaus findet sie in vielen Fällen nicht statt, weil es Kritiker_innen rasch passieren kann, dass sie der rechten Seite zugeschrieben werden. Auf grundsätzliche Kritik reagieren queere Aktivist_innen zumeist durch eine Nicht-Beschäftigung mit derselben. Stattdessen wird versucht, die Kritikerin möglichst öffentlich namentlich anzugreifen und ihren Ruf zu schädigen. Solches autoritäre Vorgehen wird nach außen wie nach innen angewendet. Diesen Reaktionen entgegnend versammelt Beißreflexe erstmals recht unterschiedliche Formulierungen einer solchen Kritik in einem Band. Im Folgenden wird mit einem Schwerpunkt auf Berlin ein Einblick in Vorgehensweisen und Ansätze im queeren Aktivismus angeboten, verknüpft mit einer Deutung hin zu Emanzipation und Kritik.
Queer: Sammelbegriff, Subversion, Autorität
In den 1980er und zu Beginn der 1990er Jahre erlebte eine ganze Generation von Schwulen eine Trauer, die ich nur aus den Erzählungen derer kenne, die Freunde und Partner an AIDS verloren. Während sich die offene Schwulenfeindlichkeit verschärfte, mussten eigene Formen des Trauerns gefunden werden. Unter anderem weil die Verstorbenen häufig von der Familie aus ihrem schwulen Umfeld gerissen und fernab ihres vorherigen Lebensmittelpunktes beerdigt wurden. Der Autor Tjark Kunstreich erinnert in Dialektik der Abweichung (2015) an diese Zeit in den USA: „In dieser Situation begannen die verschiedenen Communities der sexuellen Minderheiten, die bis dahin nebeneinander existiert hatten, zusammenzuarbeiten, und der Begriff ‚queer‘, der im US-Amerikanischen jede Form der Abweichung fasst, wurde zum Synonym für dieses Bedürfnis. Der gemeinsame Gegner war nicht nur die Krankheit, der Gegner war eine Gesellschaft, die Leute dahinsiechen ließ, weil sie anders waren. Queer war keine Theorie, sondern ein Sammelbegriff für jene einzelnen und Gruppen, die ihrem Erschrecken über den offen ausgesprochenen Vernichtungswunsch gegen sexuelle Minderheiten in Aktionen Ausdruck verliehen.“ (Kunstreich 2015: 76)
Queer beschrieb das bestehende Bündnis der Zeit. Auf die Idee des Bündnisses wird im Zusammenhang von Queer auch heute regelmäßig verwiesen, doch mehr als Forderung oder Wunsch denn als Beschreibung. Die Zusammenarbeit indes zwischen Lesben, Schwulen und Transleuten findet vielerorts auf selbstverständliche Weise statt. Im deutschsprachigen Raum dient Queer daher unter anderem als modische englische Beschreibung dieser Zusammenkunft. Selbstverständlich würde der Begriff in seiner sinngemäßen Übersetzung, etwa „pervers“, nicht so beliebt sein. Pervers wird zu häufig abwertend gebraucht und eignet sich nicht gleichermaßen zur modischen Selbstbezeichnung, sondern hebt das sexuell Andere hervor, eine Unnormalität, die man nicht nach Belieben anlegen und abstreifen kann, wie es das im Deutschen ganz offene Queer vermittelt. Aus diesem Grunde bezeichnet die Berliner Verlegerin Manuela Kay Queer als „das neue Wischiwaschi“ (Kay 2016: 147).
Der eher beschreibende Gebrauch wird zunehmend angeführt, um dies als falsche Verwendung von Queer darzustellen – Queer müsse mehr bedeuten, radikal sein, widerständig und eben nicht bloß synonym für „Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transleute“ verwendet werden. Queer als Schirmbegriff ist meines Erachtens aber nicht die Funktion, an der sich eine schlechte Verwendung von Queer aufzeigen lässt. Die Beschreibung etwa eines Stadtmagazins, in dem Homosexuelle und Transleute zusammenarbeiten, muss nicht „subversiv“ sein – und sofern Queer als Sammelbegriff in den subkulturellen Sprachgebrauch eingegangen ist, ist diese Verwendung schlicht passend: Beispielsweise im Falle der Berliner Siegessäule – We are queer Berlin. Was Kay mit dem Begriff „Wischiwaschi“ kritisiert, ist vielmehr die Behauptung zahlreicher Aktivist_innen, Queer sei gegenüber den Bezeichnungen lesbisch, schwul oder trans ein besonders progressiver, radikaler Begriff. Dabei wird unter anderem übersehen, dass mit Queer das selbstbewusste Anderssein, zu welchem das Konkrete der sozialen Realität und damit das Wesentliche gehört, teils abgewehrt wird. So gerät letztlich, wie Kunstreich ausführt, die Feindseligkeit in dieser Gesellschaft aus dem Blick: „Heute scheint es selbstverständlich, dass queer irgendwie alles ist, was sich selbst eine Abweichung von der Norm zuschreibt. Niemand will heute mehr normal sein, also sind alle queer, denn jede sexuelle Differenz, jeder Fetisch wird zum Bestandteil einer Identität. […] Ist das nicht schön, ist das nicht toll, und können wir nicht dabei bleiben? Alle dürfen alles, damit hat es sich. Leider ist es nicht so. Die Betonung einer gewissen Anormalität schlägt um in Ignoranz gegenüber der Homophobie, die nicht in dem Maße verschwindet, wie sexuelle Differenzen anerkannt zu werden scheinen.“ (Kunstreich 2015: 73)
Die Bedeutung, die Queer zukommen könnte, also für Perverse, sexuell und geschlechtlich Andere zu stehen, ihrer Kritik an der heterosexuellen Normalität oder ihrem Wunsch nach Emanzipation Ausdruck zu verleihen, müsste aktuell erst neu behauptet werden. Es gibt vereinzelt queere oder queerfeministische Gruppen, die Queer nicht als gleichmachenden Begriff gebrauchen – meiner Erfahrung nach von Berlin bis nach Tübingen. Zumeist aber wird Queer im politischen Aktivismus der vergangenen Jahre anders genutzt. Diese letztere Form von queerem Aktivismus steht im Mittelpunkt dieses Artikels.
Falsche Zöpfe, oder: Queer in Berlin
Ein Blick zurück ins Jahr 2013: In einem alternativen Berliner Szenetreffpunkt schneiden sich mehrere junge Leute die Zöpfe ab – unter traurigen, schuldbewussten Mienen trennen sie sich von ihren Dreadlocks. Die Anführerin verspricht derweil Erlösung. Andere entledigen sich ihrer Tunnelohrringe. Nur wenige, aber es gibt sie doch, verweigern sich dem Irrsinn und kommen nie wieder. Es folgen Bußen in Form von Entschuldigungen derer, die sich ihrer schändlichen Insignien entledigt haben, nach einem bestimmten Protokoll: Selbstpositionierung/Bekenntnis („ich bin weiß, weiblich, lesbisch“), Sünde/Tatbestand („ich trage Dreadlocks und bin weiß“), Gelübde („nur Betroffene dürfen urteilen und sprechen, ich darf nicht sprechen und alles, was ich sagte, war folglich nicht nur falsch, sondern auch extrem verletzend“). Dieser Vorgang wird ins Unendliche zu ziehen versucht, indem keine Buße, keine Entschuldigung jemals für ausreichend befriedigend formuliert befunden wird. Nicht die Zusammenkunft einer apokalyptischen Sekte, sondern das Plenum eines queeren Großevents im Jahr 2013 wurde hier geschildert.
Das Ritual war Teil der Reaktionen auf „antirassistische“ Interventionen innerhalb der queerfeministischen Szene Berlins der letzten Jahre, die sich ab dem Frühjahr 2013 besonders zuspitzten. Zahlreiche Plena waren dadurch nur noch im schlechteren Sinne queer. Keine Orte also, an welchen man die Differenz als solche zu akzeptieren suchte. Nicht respektvoller Umgang, sondern Unterordnung und Ausschluss wurden gefordert, die als eigentümliche Form von sogenannter Selbstreflexion verstanden wurden.
Aus dieser Zeit beispielhaft ein kleiner Abriss: Über den linken Mailverteiler Genderliste schickte im Frühjahr 2013 eine Aktivistin im Abstand von wenigen Stunden über mehrere Wochen hinweg E-Mails, in denen sie sich über allerhand Kleidungsstücke und Begriffe echauffierte, die in ihren Augen den eklatanten Rassismus weißer linker Queers ausdrückten. Im Zentrum standen Dreadlocks und Tunnelohrringe. In dieser Mailflut tauchte von einem anderen Listenmitglied eine Ankündigung zu der Veranstaltung Antiziganistische Zustände 2 auf. Diese Ankündigung entfachte die Wut der queeren Aktivistin erst richtig – und...
| Erscheint lt. Verlag | 5.10.2017 |
|---|---|
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sozialwissenschaften ► Politik / Verwaltung |
| ISBN-10 | 3-89656-644-X / 389656644X |
| ISBN-13 | 978-3-89656-644-7 / 9783896566447 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 430 KB
Digital Rights Management: ohne DRM
Dieses eBook enthält kein DRM oder Kopierschutz. Eine Weitergabe an Dritte ist jedoch rechtlich nicht zulässig, weil Sie beim Kauf nur die Rechte an der persönlichen Nutzung erwerben.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich