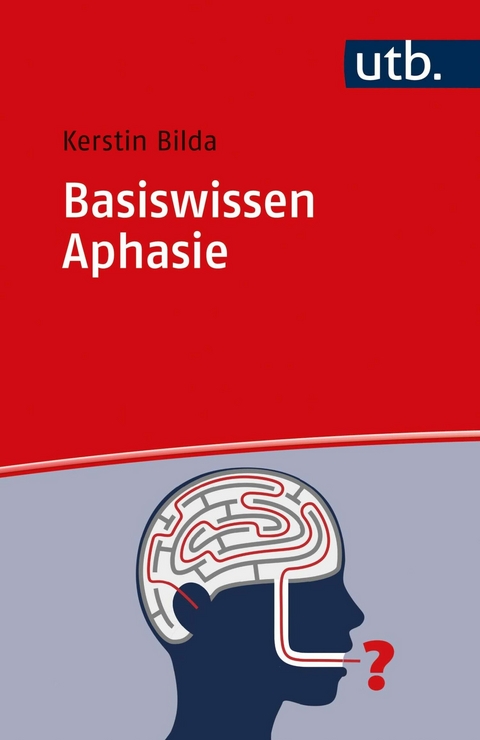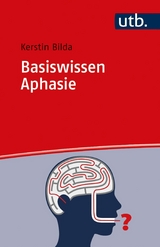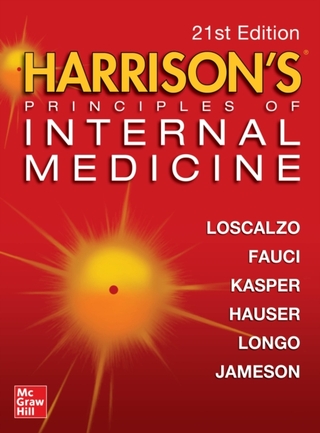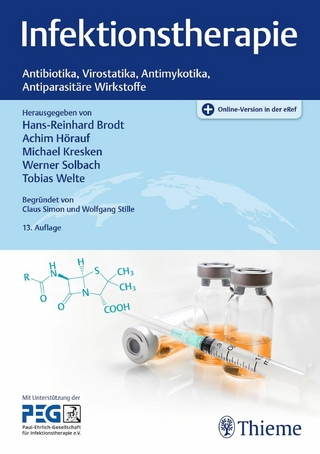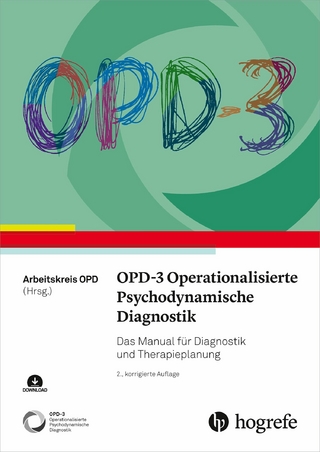Basiswissen Aphasie (eBook)
134 Seiten
utb. (Verlag)
978-3-8463-5824-5 (ISBN)
Vorwort 9
1 Einleitung 10
2 Beschreibung der Aphasien 12
2 1 Definition der Aphasie 12
2 2 Einteilungen von Aphasien 13
Akute, postakute und chronische Aphasie 14
Flüssige und nichtflüssige Aphasien 14
Rest-Aphasie 15
Aphasie bei Kindern 15
Aphasie bei Mehrsprachigkeit 16
2 3 Klassifikation von Aphasien 17
Syndromansatz 18
Individualansatz 20
2 4 Abgrenzung der Aphasie zu anderen Kommunikationsstörungen 21
Dysarthrophonie 21
Sprechapraxie 21
Kommunikationsstörungen bei Demenz 22
Kognitive Kommunikationsstörungen 27
3 Medizinische Grundlagen 29
3 1 Lokalisation der Sprache im Gehirn 29
Kurzer historischer Überblick 29
Bildgebende Methoden 33
Funktionelle Verfahren 34
Hemisphärendominanz 36
3 2 Neuronale Korrelate der Sprachverarbeitung 38
Sprachverarbeitung im gesunden Gehirn 38
3 3 Sprachverarbeitung 41
Netzwerkreorganisation: Restitution von Sprachfunktionen 42
Links- und rechtshemisphärische Netzwerke: Spracherholung 43
Domänenübergreifende Hirnareale: Spracherholung 45
4 Aphasische Symptome 48
4 1 Erscheinungsbild 48
4 2 Begleiterkrankungen: Alexie, Agrafie und Akalkulie 49
5 Diagnostik der Aphasie 52
5 1 Anamnese 54
5 2 Standardisierte und normierte Verfahren 60
5 3 Modellorientierte Verfahren 62
5 4 Kommunikativ-pragmatisch orientierte Verfahren 66
Direkte Verfahren zur Erfassung der Alltagskommunikation 66
Indirekte Qualitative Verfahren zur Erfassung kommunikativer Fähigkeiten67
6 Therapie der Aphasie 70
6 1 Therapieansätze bei Aphasie 71
Sprachsystematische Ansätze 72
Stimulierende Ansätze 72
Modellbasierte Ansätze 74
Verhaltensorientierte Ansätze 77
Kommunikativ-pragmatisch orientierte Therapie 78
6 2 Beratung der Angehörigen und Patienten 81
6 3 Neue Technologien in der Aphasietherapie 83
Technologiegestützte Therapie 84
Teletherapie 85
Soziale Roboter 88
Gleichstromstimulation (tDCS) 91
6 4 Pharmakotherapie 98
6 5 Evidenzbasierte Rehabilitation bei Aphasie 100
Wirksamkeitsnachweise für die Rehabilitation bei Aphasie 101
Therapieeffektivität in den klinischen Verlaufsphasen 103
Beispiele aus der Praxis 105
6 6 Leitlinien und Reha-Therapiestandards 107
7 Zukunft 110
Literatur 112
Sachregister 133
| Erscheint lt. Verlag | 11.7.2022 |
|---|---|
| Verlagsort | Stuttgart |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Medizin / Pharmazie ► Allgemeines / Lexika |
| Schlagworte | Aphasietherapie • APHASISCHE SYMPTOME • chronische Aphasie • Demenz • Diagnose • Ergotherapie • Gesundheitswissenschaft • Hemisphärendominanz • Kognitive Kommunikationsstörungen • Kommunikationsstörungen • Lehrbuch • Logopädie • Logotherapie • Medizinische Grundlagen der Sprache • Neurologie • Pharmakotherapie • Rehabilitation bei Aphasie • Schlaganfall • Soziale Roboter • Sprachbeeinträchtigung • Sprache im Gehirn • Sprachfunktionen • Sprachstörung • Sprachsystematische Ansätze • Sprachtherapie • Sprachverarbeitung • Sprachwissenschaft • Technologiegestützte Therapie • Teilnahmslosigkeit • Teletherapie • Therapie • Therapie bei Aphasie |
| ISBN-10 | 3-8463-5824-X / 384635824X |
| ISBN-13 | 978-3-8463-5824-5 / 9783846358245 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich