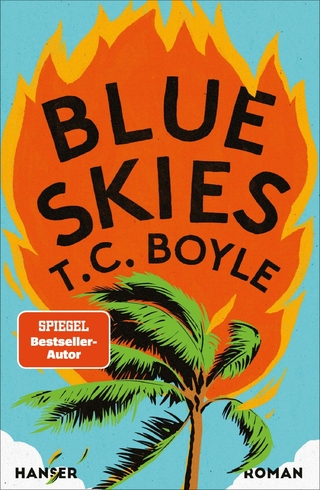Der Seher von Étampes (eBook)
350 Seiten
Matthes & Seitz Berlin Verlag
978-3-7518-0974-0 (ISBN)
Abel Quentin, 1985 in Lyon geboren, arbeitet als Strafverteidiger in Paris und debütierte als Schriftsteller mit einem politischen Thriller über die islamistische Radikalisierung. S?ur, so der Titel, wurde für den Prix Goncourt nominiert, war Finalist des Goncourt des lycéens und erhielt Prix Première. Für seinen zweiten Roman Le voyant d'Étampes erhielt er den Prix Maison rouge und den Prix de Flore
»›Wir sind alle Einwandererkinder‹ … Was soll das bitte heißen?! Glauben Sie wirklich, dass Sie auch nur einen Bruchteil von dem empfinden können, was eine migrantisierte Person empfindet? Finden Sie nicht, dass es allerhöchste Zeit ist, die ›Einwandererkinder‹ selbst sprechen zu lassen? Endlich damit aufzuhören, ihnen die Stimme wegzunehmen?«
Jeanne, die neue Freundin meiner Tochter, sah mich streng und schmallippig an. Sie erinnerte mich an eine Puritanerin aus dem Iowa des neunzehnten Jahrhunderts. Infolge andauernden Leidens war ihre Kiefermuskulatur angespannt.
Es war zwanzig Uhr und der Abend stand unter keinem guten Stern. Als ich eine Suze bestellen wollte, hatte mich der Kellner nur fragend angeschaut: Offensichtlich war ihm so etwas noch nie zu Ohren gekommen. So hatte ich mich mit einem Cocktail auf Gurkenbasis begnügen müssen, an dessen Oberfläche vereinzelte Sesamkörner dümpelten. »Sieht aus wie Zwergmausköttel«, hatte ich gewitzelt, um die Atmosphäre etwas aufzulockern, leider ohne Erfolg.
Am Tisch herrschte klebrige Spannung – innerhalb weniger Minuten Bande der Herzlichkeit zwischen den Menschen entstehen zu lassen, war kein leichtes Unterfangen. Nur Léonie schien sich wohlzufühlen und schlürfte geräuschvoll ihren Szechuan-Pfeffer-Tee, während sie unserer Diskussion lauschte. Das reine und gutmütige Mädchen, das sie war, konnte sich beim besten Willen nicht vorstellen, dass zwei Menschen, die es liebte, nicht automatisch Freundschaft miteinander schlossen.
Ich stotterte mir ein improvisiertes Schuldbekenntnis zurecht und versuchte meinen Satz zu erklären, indem ich daran erinnerte, dass Harlem Désir, der Mitbegründer von SOS Racisme, antillische Vorfahren gehabt hatte. Bei Julien Dray war ich mir nicht so sicher, da müsste ich nachgucken, aber er könnte schon so was wie ein elsässischer Jude gewesen sein. Oder eben doch aus Algerien. Ich versprach, mich zu informieren.
♦
Wir saßen zu dritt am Tisch, ich, meine Tochter Léonie und ihre Freundin Jeanne. Das allein war schon eine kleine Revolution. Vor fünf Jahren hatte ich das Ritual des sonntäglichen Abendessens mit meiner Nachfahrin eingeführt, und zwar in trauter Zweisamkeit. Dritte waren nicht zugelassen. Ich war dabei dem Rat meiner Ex-Frau Agnès gefolgt, einen heiligen Vater-Tochter-Moment zu etablieren. Agnès – die Frau mit den wertvollen Ratschlägen, deren Weisheit ich seit unserer Scheidung und nun, da ich allein meiner Wege gehen musste, schmerzlich vermisste.
Léonie wohnte in Pontoise, im Viertel Saint-Martin, das seine engen und feuchten Straßen rund um den Bahnhof der Pariser Vorstadt zog. Sie hatte mich nie zu sich eingeladen, und ich hatte mich damit abgefunden: Bestimmt fürchtete sie meine sarkastischen Kommentare zur Ausstattung ihrer kleinen Butch-Residenz, die sie vermutlich nach dem Umzug aus der Kapitale eins zu eins wiederhergestellt hatte, mit sämtlichen Christine and the Queens-Postern und dem unvermeidlichen armenischen Räucherpapier. Es war schrecklich, dem eigenen Kind ein solches Gefühl zu vermitteln (anstatt ihm ein Zufluchtsort zu sein, das vertraute Antlitz der Güte und Geborgenheit …). Dabei richteten sich die sarkastischen Kommentare, die mir hier und da wohl tatsächlich entglitten, doch vor allem gegen mich selbst. Ich nahm es Léonie übel, dass sie mir so ähnlich war. Meine Tochter hatte von mir eine gewisse Neigung zum Scheitern geerbt, wobei diese bei ihr ganz ohne die väterliche Bitterkeit auskam, ohne dessen finsteren Scharfsinn: Léonie hatte ein sonniges Gemüt. Sie arbeitete im Bereich Unternehmenscoaching mit Schwerpunkt Beziehungsarbeit – einer dieser Jobs, die in den verschiedenen Sektoren und Branchen der freien Marktwirtschaft gerade wie Pilze aus dem Boden schossen (wie Fliegenpilze, hätte Marc gesagt), dank der Hochkonjunktur eines so scheinheiligen Konzepts wie der sogenannten Corporate Social Responsibility. Für CSR-bekehrte Unternehmen bestand die Idee in etwa darin, die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass sie Akteure eines Kapitalismus menschlichen Antlitzes waren, dass ihre Gefräßigkeit, ihr Zynismus, ihre Brutalität Grenzen kannten und dass sie sich um das Wohlbefinden ihrer Angestellten sorgten (und warum nicht gleich auch um deren CO2-Bilanz). Um dieser Idee Substanz zu verleihen, bezahlte man externe Dienstleister (schlecht), damit diese den Leuten beibrachten, wie man miteinander spricht, wie man »die Rede im open space befreit«. Das also tat Léonie Tag für Tag in überheizten Meeting Rooms des Geschäftsviertels La Défense. Konkret bestand ihre Arbeit darin, lustige Spielchen für mal pikierte, mal zum Scherzen aufgelegte Führungskräfte zu organisieren und PowerPoint-Folien zu sharen, die allen Ernstes erklärten, dass »ein ausweichender Blick in der non-verbalen Kommunikation ein Zeichen von Misstrauen ist«. Manchmal erteilte sie ihre Ratschläge auch dezentral, über Skype. Kurzum, es war ein Scheißjob, und es wäre durchaus vergnüglich gewesen, gemeinsam mit der Betroffenen darüber zu lachen, unter Freunden sozusagen. Aber Léonie war eines jener Wesen, die unfähig sind, den eigenen Niederlagen ins Auge zu sehen – genauso, wie sie ihren Umzug ins Val-d’Oise damit erklärt hatte, das Pariser Stadtleben nicht mehr zu ertragen, wobei es ein offenes Geheimnis war, dass sie einfach die Wuchermiete ihrer Wohnung im Osten der Kapitale nicht mehr stemmen konnte; genauso, wie sie gesagt hatte, die Beziehung mit ihrer vorherigen Freundin Maeva hätte sowieso keine Zukunft gehabt, als diese sie für eine Praktikantin in den Wind schoss; genauso, wie sie gesagt hatte, dass die Umstände dieser Trennung die Persönlichkeit ihrer großen Liebe in einem neuen Licht erstrahlen ließen und dass besagter Maeva im Grunde nichts Besseres im Leben hätte passieren können, als von einer Schlampe mit Kreolen und Sandaletten abgeschleppt zu werden. Genauso, wie sie ihre emotionalen Enttäuschungen in schillernde Farben zu kleiden pflegte, endete Léonie ihren Bericht, wenn sie wieder einmal mit Pauken und Trompeten irgendwo gescheitert war: »Das ist das Beste, was mir passieren konnte.« Als sei jede Bauchlandung ein Geschenk des Himmels.
Mir gefiel es, mich von diesem fröhlichen, unfassbar gutmütigen Mädchen verhätscheln zu lassen. Léonie war eine jener Alltagsheiligen, die leuchten, ohne je ein Wunder getan oder eine spektakuläre Handlung begangen zu haben – einen Mann mit Glasknochenkrankheit heilen zum Beispiel, oder eine Marienstatue Blutstränen vergießen lassen. Die Chancen, dass der Bischof von Pontoise ein Diözesanverfahren zu ihrer Seligsprechung einleiten würde, gingen folglich gegen Null. Bei meiner Scheidung vor fünf Jahren hatte sie sich in erstaunlicher Weise auf meine Seite geschlagen. Dabei war sie damals gerade volljährig geworden und konnte zum Elternteil ihrer Wahl ziehen, oder einfach direkt die Fliege machen. Zweifelsohne wäre ihr Leben im Penthouse der Beraterin von Bain & Company, die ihre Mutter war, angenehmer gewesen, aber Léonie hatte sich loyal gezeigt und geopfert, weil sie wusste, dass ich mich in einer Notlage befand (wir sprechen hier von einer sehr düsteren Periode, in der ich im Halbdunkel meine Motörhead-Alben rauf und runter hörte und Morgen für Morgen erwachte wie nach einer Amputation). Léonie hatte es nicht übers Herz gebracht, mich allein zu lassen, und mir hatte der Mumm gefehlt, dieses Almosen abzulehnen. Egoistisch, wie ich war, hatte ich »eingewilligt«. So waren wir zwei Jahre lang Mitbewohner gewesen, bevor sie ein Studienaufenthalt für ein Jahr nach Kopenhagen beförderte. Vielleicht war sie in unserer WG trotzdem auf ihre Kosten gekommen, schließlich hatte ihre Mutter die nervige Angewohnheit, Léonie mit ihren eigenen Träumen und Ansprüchen einer überambitionierten Workaholic unter Druck zu setzen. Agnès forderte immer von ihr, über sich hinauszuwachsen; sie präsentierte ihr die Welt wie einen Dschungel, in dem man sich jeden Sieg mit den Zähnen erkämpfen musste. Das war ziemlich zutreffend – und total beängstigend. Ich für meinen Teil war nicht wirklich die erdrückende Figur des Patriarchen, der über seine Sippschaft wacht: Diese Rolle war Agnès auf ganz natürliche Weise zugefallen. So hatte meine Ex-Gattin diesen Kummer über meine Komplizenschaft mit Léonie so hingenommen, wie sie es mit jedem Kummer tat: ohne mit der Wimper zu zucken.
♦
Jeanne, Léonies neue Freundin, hatte darauf bestanden, das Restaurant auszusuchen. Vielleicht war das eine Art, ihr Revier zu markieren, oder zumindest, die Feindseligkeiten in einer Umgebung zu eröffnen, die ihr den Heimvorteil sichern würde (ich meine mich zu erinnern, wie Marc einmal einen Strategen des alten China zu diesem Thema zitiert hatte: »Wer die Beschaffenheit des Terrains nicht kennt, wird seine Truppen...
| Erscheint lt. Verlag | 28.3.2024 |
|---|---|
| Übersetzer | Laura Strack |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Literatur ► Romane / Erzählungen |
| ISBN-10 | 3-7518-0974-0 / 3751809740 |
| ISBN-13 | 978-3-7518-0974-0 / 9783751809740 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 1,2 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich