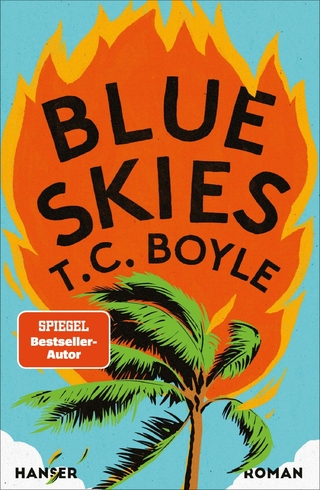Nackt war ich am schönsten (eBook)
320 Seiten
Rowohlt Verlag GmbH
978-3-644-01760-3 (ISBN)
Veronika Peters, 1966 in Gießen geboren, verbrachte ihre Kindheit in Deutschland und in der heutigen Republik Kongo sowie in der Elfenbeinküste. Nach einer heilpädagogischen Ausbildung arbeitete sie als Erzieherin in einem psychiatrischen Jugendheim. Mit Anfang zwanzig stieg sie für einige Jahre aus dem sogenannten bürgerlichen Leben aus und trat in eine Kommunität von Benediktinerinnen ein, wo sie unter anderem als Gärtnereigehilfin, Restauratorin und Buchhändlerin tätig war. Seit dem Jahr 2000 lebt sie als freiberufliche Autorin in Berlin. Veronika Peters ist verheiratet mit dem Schriftsteller Christoph Peters und hat eine Tochter. Im März 2022 ist ihr siebtes Buch erschienen, «Das Herz von Paris», ein Roman über die Frauen der literarischen Avantgarde im Paris der Zwischenkriegsjahre.
Veronika Peters, 1966 in Gießen geboren, verbrachte ihre Kindheit in Deutschland und in der heutigen Republik Kongo sowie in der Elfenbeinküste. Nach einer heilpädagogischen Ausbildung arbeitete sie als Erzieherin in einem psychiatrischen Jugendheim. Mit Anfang zwanzig stieg sie für einige Jahre aus dem sogenannten bürgerlichen Leben aus und trat in eine Kommunität von Benediktinerinnen ein, wo sie unter anderem als Gärtnereigehilfin, Restauratorin und Buchhändlerin tätig war. Seit dem Jahr 2000 lebt sie als freiberufliche Autorin in Berlin. Veronika Peters ist verheiratet mit dem Schriftsteller Christoph Peters und hat eine Tochter. Im März 2022 ist ihr siebtes Buch erschienen, «Das Herz von Paris», ein Roman über die Frauen der literarischen Avantgarde im Paris der Zwischenkriegsjahre.
1 Toni
Am ersten Morgen nach meiner Rückkehr wurde ich von Loups tiefem Knurren geweckt. Nach der viel zu kurzen, in muffigen alten Laken verbrachten Nacht wollte ich nichts als weiterschlafen, deshalb knurrte ich zurück und vergrub mein Gesicht in den angemoderten Federkissen. Ich hatte keine Lust auf diesen Tag, keine Lust auf das Dorf, und am allerwenigsten Lust hatte ich, mich um dieses marode, von allen guten Geistern verlassene Haus zu kümmern.
«Keine Lust ist ein Argument für gar nichts», hörte ich meine tote Großmutter schimpfen.
Ich öffnete die Augen.
Loup stand am Fenster, schaute zu mir, dann wieder nach draußen, trat aufgeregt von einer Pfote auf die andere, winselte, knurrte erneut.
Als er sah, dass ich die Beine aus dem Bett schwang, stieg Loup mit den Vorderläufen auf die Fensterbank, wo eingestaubte Trockenblumen vor sich hin bröselten. Ein Bund Craspedia, deren ursprüngliches Sonnengelb sich kaum noch erahnen ließ, zerfiel unter den Pranken des alten Wolfshunds, ergrauter Lavendel rieselte zu Boden. Ich hob einen der Stängel auf, hielt ihn mir an die Nase, da war ein schwacher Hauch von angegammeltem Heu und sonst nichts.
So war das jetzt also.
Früher hatte das komplette Waldhaus wie ein provenzalisches Stück Seife gerochen, ebenso unsere Hemden und Pullis, die Handtücher, das Bettzeug, selbst die Unterhosen und die Socken, sogar die Sofakissen und die Küchenvorhänge, einfach alles. Man hätte, da bin ich mir sicher, mit verbundenen Augen jede von uns dreien im samstäglich überfüllten Spar-Markt als Waldhausbewohnerin identifizieren können, allein am Duft, der uns anhaftete. Meine Großmutter hatte mit der ihr eigenen Hartnäckigkeit ein kleines Lavendelfeld bewirtschaftet, gleich neben der Streuobstwiese auf dem nach Süden hin abfallenden Hang hinter dem inneren Gartengelände, der einzigen Stelle, an der die Sonne sich den ganzen Sommer über gegen den Schatten des Waldes durchsetzte. Selbst der alte Blumen-Weidner, der es ja schließlich wissen musste, war nach anfänglicher Skepsis überrascht gewesen, wie gut das Kraut unter den hiesigen Witterungsbedingungen gedieh. «Respekt, Emma!», hatte er gesagt, und danach war Oma nicht mehr zu bremsen gewesen. Meine gesamte Kindheit hindurch hatten im Spätsommer die Bündel zum Trocknen an quer durch die Zimmer gespannten Schnüren gehangen, so niedrig, dass wir uns die Köpfe daran stießen, und auf dem Herd hatte das frisch aufgesetzte Öl stundenlang im Wasserbad vor sich hin gesimmert. In seinen unterschiedlichen Verarbeitungszuständen war das Zeug dann an jeder denkbaren und undenkbaren Stelle im Haus verteilt oder versprüht worden: in den Kleiderschränken und Sockenschubladen, in Einkaufsbeuteln und Jackentaschen, auf den Fensterbänken und Türrahmen. Sogar die Nachbarn und selbstverständlich auch der Blumen-Weidner waren mit getrockneten Blüten, duftenden Stoffsäckchen oder handbeschrifteten Ölfläschchen beschenkt worden. «Das vertreibt Kummer und Skorpione!», hatte meine Großmutter immer behauptet. Als hätte sich jemals ein Skorpion nach Lindbach verirrt! Und ich kämpfte auch zwanzig Jahre nach Omas Tod noch mit den Tränen, wenn ich irgendwo Lavendel roch. Das immerhin ersparte mir das Waldhaus an diesem Morgen. Es stank nach alter Kanalisation und abgestandener Leere, damit konnte ich umgehen.
Loup bellte. Ich trat neben ihn und strich ihm über den Kopf.
Er beruhigte sich umgehend, blieb aber hoch aufgerichtet am Fenster stehen, die Ohren wachsam gespitzt, den Blick starr in den Vorgarten gerichtet. Seite an Seite schauten wir durch die Scheiben meines ehemaligen Kinderzimmers nach draußen. Und dann sah ich, was Loup alarmiert hatte: Da war eine Frau mit ihrem Hund unterwegs. Aber was für eine! Selbst in mit Exzentrikerinnen gesegneten Großstädten, sagen wir Berlin, Paris, London oder San Francisco, wäre die alte Dame, die eben das Grundstück in Richtung Wald verließ, eine spektakuläre Erscheinung gewesen, in Lindbach allerdings, diesem «oberhessischen Ende der Welt», wie meine Mutter es genannt hatte, war sie schlicht eine Sensation. Um die schmächtigen Schultern wehte ein violetter langer Umhang, auf dem Kopf thronte eine fuchsienfarbene Fliegerkappe, geziert von einem Gebilde, das auf die Entfernung aussah wie fächerartig arrangierte Silberlöffel. Neben der Alten trippelte, den Kopf hoch erhoben, ein lackschwarzes italienisches Windspiel. Sie hinkten beide, die Frau links, das Hündchen hinten rechts, was allerdings mehr nach minimalistischer Tanzchoreografie als nach Gehbehinderung aussah und ihrer beider Eleganz keinerlei Abbruch tat. Im Gegenteil. Ich war hingerissen! Und als wäre sich die Frau dessen bewusst, dass sie bestaunt wurde, blieb sie für einen Moment stehen, drehte sich ins Profil, schlug dabei mit theatralischem Schwung den Umhang zurück. Ein lila glitzerndes Pailletten-Oberteil kam zum Vorschein, über dem ein halbes Dutzend Perlenketten mit auf die Entfernung undefinierbaren silbernen Anhängern hing, dazu trug sie eine tannengrüne, mit bunten Fäden bestickte Pluderhose und schwarz-golden funkelnde Schnabelschuhe, deren Spitzen sich schneckenartig aufrollten. Auch das Windspiel schimmerte in der Morgensonne, von seinem perlenbesetzten Halsband baumelten Seidenquasten, farblich auf die Herrin abgestimmt. Man hätte meinen können, die beiden seien auf dem Weg zu einem mondänen Kostümball anstatt zur Gassirunde in den Lindbacher Forst.
«Heilige Scheiße!», murmelte ich.
«Wie soll Scheiße bitte schön heilig sein? Wenn du schon fluchen musst, dann bleib wenigstens logisch, mein Mädchen!»
Verschwindet aus meinem Kopf, alle beide!, dachte ich. In Anbetracht meiner gegenwärtigen Situation ein extrem dämlicher Gedanke.
Die Stimmen meiner Mutter und Großmutter hatten quasi identisch geklungen. Selbst die Dorfleute, die uns gut kannten, der Blumen-Weidner zum Beispiel, Doktor Arnold oder Pfarrer Martinek, hatten sie am Telefon nicht auseinanderhalten können. «Wen hab ich dran?», hatten sie immer gefragt. «Emma eins oder Emma zwei?» Der Einfachheit halber waren die Bachmann-Emmas im Dorf nummeriert worden. Dass man es mir durch abweichende Namensgebung verweigert hatte, die Nummer drei zu werden, habe ich meine gesamte Grundschulzeit hindurch als höchst unfair empfunden. «Hier ist keine Emma!», hatte ich als Zehnjährige einmal in den Hörer gebrüllt, was Pfarrer Martinek dazu veranlasst hatte, mich im Religionsunterricht fortan mit «Keine-Emma» anzureden. In der Regel war bei uns aber immer Emma eins, meine Oma, ans Telefon gegangen. Die Anrufer hätten das wissen können, denn Emma zwei, meine Mutter, war meistens anderswo, allein im Wald unterwegs, zum Malen, Trinken und Schlafen im ehemaligen Pferdeschuppen eingeschlossen oder gleich für mehrere Wochen ganz verschwunden. Auch ich hatte ihre Stimmen mehr als einmal verwechselt, obwohl es immer und ausschließlich Oma gewesen war, die mich zum Abendessen ins Haus gerufen hatte.
«Ach, mein Mädchen!»
Meine Mutter hätte mich nicht «mein Mädchen» genannt.
Eine Sache war im Waldhaus demnach wie früher: Oma sprach mit mir, während Mama schwieg. Vielleicht wurde ich aber auch einfach wahnsinnig.
Ich verließ mein Zimmer und betrat die Küche, um vom dortigen Erkerfenster aus den Waldweg besser einsehen zu können.
Was die beiden Emmas wohl zum Auftauchen der exzentrisch aussehenden Fremden in unserem Vorgarten gesagt hätten? Meine Mutter hätte wahrscheinlich stumm eine Skizze auf irgendeinen herumliegenden Zettel geworfen und wäre anschließend kommentarlos im Atelier verschwunden. Meine Großmutter hörte ich «nu brat mir einer ’nen Storch!» murmeln. Im gleichen Atemzug hätte sie das Fenster aufgerissen und nach der rätselhaften Unbekannten gerufen, sie hereingebeten, auf einen Tee eingeladen, Melisse oder Minze, denn «zum Kennenlernen gibt es bekanntlich nichts Besseres als einen leckeren und gesunden Aufguss aus frischen Gartenkräutern!». Auch das Hündchen hätte einen Butterkeks oder eine Scheibe Fleischwurst bekommen, dazu eine Schale Wasser und vermutlich sogar eine Decke, damit es weich lag.
«Zu meiner Zeit hat es in diesem Haus noch so etwas wie Gastfreundschaft gegeben!»
«Oma, sei still!»
«So weit kommt’s noch!»
«Du bist gar nicht hier, schon seit einer halben Ewigkeit nicht mehr.»
«Deswegen muss ich mir noch lange nicht den Mund verbieten lassen, schon gar nicht von einer, die genauso lange nicht mehr hier war und keine todsichere Ausrede für ihre Abwesenheit hat.»
Dieses helle Oma-Kichern, wenn sie sich selbst umwerfend witzig gefunden hatte.
Der Küchenschrank hinten an der Wand stand offen. Auf den blau-weiß gemusterten Tellern hatte meine Großmutter mir Blaubeerpfannkuchen und Eierbrot angerichtet, in Gabelhappen geschnitten, auch dann noch, als ich längst erwachsen gewesen war. In den geblümten Keramiktassen hatte ich von ihr Kamillentee oder warme Milch mit Honig serviert bekommen. Gelegentlich hatten wir uns auch etwas Rotwein in diesen Tassen genehmigt, heimlich eingegossen, um meine Mutter nicht zum Mittrinken zu animieren.
«Ach, mein Mädchen!»
Schluss damit!, dachte ich. Ein Zimmer im Gasthof hätte ich nehmen sollen, wo es frisch bezogene Betten, eine funktionierende Elektrik sowie ein ordentliches Frühstücksangebot gab und niemand aus den Geschirrschränken zu mir sprach.
Ich ließ meinen Blick durch den Raum wandern. Erst in diesem Moment wurde mir bewusst, dass es nicht nur drüben in meinem alten Zimmer, sondern auch in dieser Küche so aussah, als sei seit Jahren keiner mehr hier gewesen. Was,...
| Erscheint lt. Verlag | 12.3.2024 |
|---|---|
| Verlagsort | Hamburg |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Literatur ► Romane / Erzählungen |
| Schlagworte | bücher literatur • Bücher Neuerscheinungen 2024 • Bücher zum nachdenken • Dadaismus • Deutsche Literatur • Deutsche Romane • Elsa von Freytag-Loringhoven • Emanzipationsgeschichte • Familienbeziehungen • Feminismus • Feministische Literatur • Frauen-Generationen • Frauenleben • Frauenromane • Freiheit • Freundschaft • Gegenwartsliteratur • Generationenroman • Heimatroman • Kunst • Lebenslust • Mariana Leky • Muse • Mutter-Tochter-Beziehung • Romane für Frauen • romane neuerscheinungen 2024 • Roman Frauen • Skurriler Humor • Vergangenheitsbewältigung • Was in zwei Koffer passt • weibliche Kunst • Zeitgenössische Literatur |
| ISBN-10 | 3-644-01760-3 / 3644017603 |
| ISBN-13 | 978-3-644-01760-3 / 9783644017603 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 6,9 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich