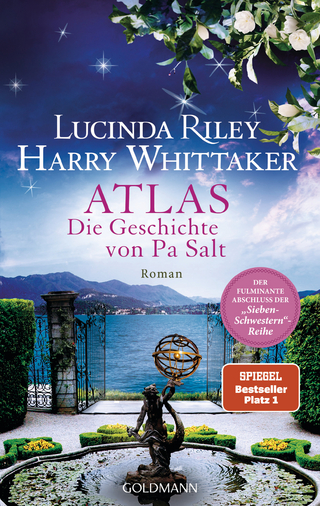Wenn mein Herz erwacht
Francke-Buch (Verlag)
978-3-96362-253-3 (ISBN)
Jody Hedlund lebt mit ihrem Mann, den sie als ihren größten Fan bezeichnet, in Michigan. Ihre fünf Kinder werden zu Hause unterrichtet. Die Zeit, die ihr neben dieser Tätigkeit noch bleibt, widmet sie dem Schreiben.
Kapitel 1 New York Mai 1857 »Verlasst den sündigen Weg der Prostitution und lauft zu unserem himmlischen Vater, der euch mit Liebe in seinen vergebenden Armen aufnimmt.« Pastor Bedells Stimme übertönte das Schniefen und erstickte Weinen der Frauen, die dicht gedrängt auf den harten Bänken der Kapelle in der Centre Street saßen. In der vordersten Reihe faltete Christine Pendleton die Hände auf ihrem Schoß und weinte innerlich über die Sittenlosigkeit, der diese Frauen Nacht für Nacht ausgesetzt waren. Obwohl sie seit einem Monat jeden Sonntag ehrenamtlich in der Kapelle mitarbeitete, litt ihr Herz jedes Mal, wenn sie die vielen Einwanderinnen sah, die in ein unmoralisches Leben hineingerutscht waren. Als jemand an den Falten ihres schwarzen Rocks zupfte, blickte sie nach unten und sah, dass die schmutzigen Finger eines Kleinkinds, das hinter ihr auf dem Boden spielte, den Seidenstoff gepackt hatten. Die Hände waren nicht nur dreckig, sondern auch vom Schleim ganz schmierig. »Nimm die Finger von der eleganten Dame!« Dem strengen Flüstern hinter Christine folgte ein Klaps auf die Hand des Kindes. Der kleine Junge wimmerte und zog schnell die Hand von dem edlen Rock zurück. »Das macht doch nichts.« Christine lächelte die junge Mutter an, die ein neugeborenes Baby in ihren dürren Armen hielt. Die Frau erwiderte ihr Lächeln nicht, sondern schaute Christine nur mit müden Augen an. Sie gab dem Baby, das sie im Arm hielt, einen leichten Klaps, obwohl der Säugling, der in ein zerschlissenes Tuch gewickelt war, während des gesamten Gottesdienstes keinen Ton von sich gegeben hatte. Christine hatte zwar keine Ahnung von Kindern, aber sie ging davon aus, dass Quengeln und Zappeln besser wären als diese Lethargie. Das Kleinkind auf dem Boden blickte mit Tränen in den Augen zu ihr hi-nauf. Ihm lief die Nase ununterbrochen und der grünliche Schleim klebte ihm im Gesicht. Christine wollte gar nicht daran denken, was jetzt alles an ihrem Rock seine Spuren hinterließ. »Hier.« Sie löste den verkrampften Griff um ihr Taschentuch und hielt es dem kleinen Jungen hin. Seine klebrigen Finger berührten zögernd den Spitzenrand des Stoffes. »Du kannst es haben«, flüsterte Christine. Der Junge nahm das Taschentuch vorsichtig zwischen Daumen und Zeigefinger. Das fleckenlose Weiß bildete einen starken Kontrast zu seinem Hemd, das wahrscheinlich irgendwann einmal weiß gewesen war, aber jetzt so grau war wie schmutziges Spülwasser. Seine Hose wurde von einer Schnur um die Taille gehalten und die Hosenbeine waren hochgekrempelt, da die Hose für ein viel größeres Kind gedacht war. Das war unübersehbar. Aus dem weiten Stoff ragten die Füße des Jungen wie dürre Zweige und seine Fußsohlen, die so schwarz waren wie Ruß. »Ihr könnt euer Leben ändern«, sprach der Pastor weiter. »Es besteht Hoffnung. Ein besseres Leben ist möglich.« Der Junge breitete das Taschentuch auf seinem Schoß aus und begann, mit dem Finger den gezackten Rand nachzufahren. Christine wartete darauf, dass die Mutter das Tuch nehmen und dem Jungen die Nase putzen würde, da er selbst offensichtlich nicht die Absicht hatte, das zu tun. Aber die junge Frau sah ihr Kind gar nicht an. Es war fast so, als hätte sie vergessen, dass der Junge überhaupt da war. Hatten sie vielleicht beide noch nie ein Taschentuch gesehen? Bei diesem beunruhigenden Gedanken drehte sich Christine wieder nach vorne und versuchte, sich auf Pastor Bedell zu konzentrieren, der hinter dem schlichten Predigtpult stand. Die Armut und das Elend dieses Ortes erdrückten sie erneut genauso wie an dem Tag, an dem sie den Pastor bei der Veranstaltung der Damen-Missionsgesellschaft hatte sprechen hören. Er hatte sich so leidenschaftlich über die Nöte der Einwanderer in Lower Manhattan geäußert. Er hatte einige Situationen beschrieben, die er erlebt hatte: den Alkoholmissbrauch, die Diebstähle und die Verdorbenheit, die in dieser »teuflischen Hölle«, wie er diesen Stadtteil bezeichnete, überall anzutreffen waren. Obwohl er eigentlich gekommen war, um seinen Jahresbericht vorzustellen, hatte er seine Rede mit der Einladung an die Damen abgeschlossen, seine evangelistischen Bemühungen zu unterstützen und mit ihm die Armen zu besuchen. Seit sie den Pfarrer gehört hatte, hatte Christine kaum mehr an etwas anderes denken können und sich von ihrem Kutscher schließlich zur Kapelle in der Centre Street fahren lassen. Selbstverständlich hatte ihr Besuch nichts mit Pastor Bedell selbst zu tun. Auch wenn die anderen Damen tuschelten, wie attraktiv der verwitwete Pastor aussehe, schenkte Christine solchem Gerede keine Beachtung. Mit ihren dreißig Jahren hatte sie sich längst damit abgefunden, für den Rest ihres Lebens allein zu bleiben. Sie hatte ihre Hoffnungen und Träume von einem Mann und Kindern begraben und sah keinen Sinn darin, sie neu zu beleben. Sie wollte doch nicht enttäuscht werden. Außerdem hatte sie sich so viele Jahre rund um die Uhr um ihre Mutter gekümmert, dass sie keine Zeit für irgendetwas anderes gehabt hatte. Jetzt, da ihre Mutter gestorben war, wollte sie sich darauf konzentrieren, diesen bedauernswerten Seelen zu helfen und sich nicht von Gedanken an attraktive, unverheiratete Männer ablenken zu lassen. »Ich flehe euch an, von euren Sünden zu lassen.« Das angespannte Gesicht des Pastors war ernst, er hatte die Stirn gerunzelt, aber seine Augen waren freundlich und mitfühlend. Er war ein eindrucksvoller Mann mit dem Körperbau eines Riesen – breite Schultern, kräftige Arme und ein breiter Oberkörper. Obwohl sein Erscheinungsbild Furcht einflößend war, strahlten sein zerzaustes weizenblondes Haar und seine Miene, die seine harten Kanten abmilderte, etwas Jungenhaftes aus. Das Weinen in der Kapelle wurde lauter. Obwohl er freundlich und einfühlsam sprach, brachte er mit seinen klaren und eindringlichen Predigten die Frauen jede Woche zum Weinen. Wenn er die Frauen nur dazu bewegen könnte, ihren Lebensstil zu ändern! Pastor Bedell schwieg einen Moment und beugte den Kopf. Seine kräftigen Hände umklammerten das Predigtpult. Man spürte, dass er von der tiefen Sehnsucht getrieben war, Gott möge diese Frauen anrühren. Der schmale Raum war bis auf das Licht, das durch die schmutzigen vorderen Fenster eindringen konnte, unbeleuchtet. Die Wände waren weiß getüncht, der Holzboden sauber geschrubbt. Trotzdem war der Raum dunkel und der widerliche, süßliche Geruch von Alkohol erfüllte die Luft. Er mischte sich mit den Ausdünstungen der vielen ungewaschenen Frauen, die auf so engem Raum beieinandersaßen. »Herr Pfarrer«, sagte eine Stimme aus dem hinteren Teil des Raums. Seit Christine angefangen hatte, die Gottesdienste in der Kapelle zu besuchen, hatten die Frauen während der Gottesdienste nie ein Wort gesprochen. Deshalb drehte sie sich jetzt zusammen mit allen anderen um, um zu sehen, wer so kühn war, den Pfarrer bei seiner Predigt zu unterbrechen. In der hintersten Reihe stand eine groß gewachsene Frau auf. Ihr marineblauer Rock war zerschlissen, ihr mit Rüschen verziertes Mieder war voller Flecken. Der Schnitt des Stoffes und die Verarbeitung verrieten, dass ihre Kleidung früher von guter Qualität gewesen war, ein Zeugnis dafür, wie tief die Frau gefallen war. Ihr Haar war zu einem Knoten zurückgebürstet und ihr Gesicht war genauso aschfahl und hager wie das der anderen Frauen. »Entschuldigen Sie, Herr Pfarrer«, sagte die Frau mit einem leichten Akzent, »aber Sie predigen jede Woche, dass wir unser Leben ändern müssen. Ich sitze jede Woche hier und bete dafür, dass ich das auch schaffe …« Ihr versagte die Stimme und sie wischte sich mit schmutzigen Fingern die Tränen von der Wange. »Sie brauchen uns nicht zu beschreiben, wie glücklich wir früher waren und wie erbärmlich wir jetzt sind oder wie elend wir in der Ewigkeit sein werden. Das alles wissen wir selbst. Zeigen Sie uns lieber eine Möglichkeit, wie wir auf anständige Weise unseren Lebensunterhalt verdienen können. Dann geben wir dieses Leben sofort auf. Wenn wir eine andere Chance hätten, um nicht zu verhungern, würden wir sie sofort ergreifen.« Die anderen Frauen begannen zustimmend zu nicken und ein leises Murmeln setzte ein. Einige richteten sich auf. Andere riefen: »Ja.« Diese plötzliche Energie war unerwartet und sprach in Christine die gleiche Sehnsucht an, die Pastor Bedells leidenschaftliche Predigt an jenem Tag bei der Damen-Missionsgesellschaft in ihrem Herzen geweckt hatte. Diese Frauen brauchten Hilfe. Dringend. Aber sie waren, ähnlich wie Motten in einem Lampenschirm, in ihren Lebensumständen gefangen. Selbst wenn sie noch so kräftig mit den Flügeln schlugen, gab es für sie kein Entkommen. Vor dem Gottesdienst hatte Christine gehört, wie die Frauen flüsternd von zwei Schwestern erzählt hatten, die ihre Arbeit verloren hatten und nichts Neues fanden. Statt ihren Körper zu verkaufen, um sich vor dem Hungertod und der Obdachlosigkeit zu retten, hatten sie sich gebadet und ihre besten Kleider angezogen. Dann hatten sie Gift getrunken, sich auf ihr Bett gelegt, sich an den Händen gehalten und waren eingeschlafen. Für immer. Während der ganzen Predigt ging Christine das Bild von diesen zwei Schwestern nicht aus dem Kopf. Und jetzt schrie ihr Herz laut, dass die Einwanderinnen unbedingt andere Optionen brauchten als die Prostitution oder den Tod. Pastor Bedell wusste doch bestimmt eine Lösung für ihr Dilemma. Pastor Bedell löste seinen festen Griff um das Predigtpult und wandte sich schließlich an die Frau, die den Mut aufgebracht hatte, das Wort zu ergreifen. »Mrs Watson, manchmal erfordert es große Opfer, das alte Leben aufzugeben. Lassen Sie uns beten und Gott bitten, dass er Ihnen allen die Kraft dazu gibt.« Christines Hoffnungen wurden enttäuscht. Als der Pastor zu beten begann, beugte sie den Kopf und schloss die Augen, aber seine Antwort überzeugte sie nicht. Sie war so niedergeschlagen, dass sie ihm gar nicht weiter zuhören konnte. Als das Gebet zu Ende war und die Frauen aufstanden, um die Kapelle zu verlassen, stand wieder eine tiefe Hoffnungslosigkeit in ihren Gesichtern. Das kurze Aufflackern von Energie und Leben war erloschen. Mit schweren Schritten schleppten sie sich aus dem Raum, so als kämen sie von einer Beerdigung und nicht von einem Gottesdienst. Christine half, die Bänke gerade zu rücken, und beobachtete Pastor Bedell, der sich an der Tür von der letzten Frau und ihrem Kind verabschiedete. Als er in die Hocke ging, sah das Mädchen, das den Daumen im Mund hatte, neben ihm winzig aus. Der Pfarrer sprach sanft mit dem Kind und legte ihm die Hand auf den Kopf, um es zu segnen, bevor er sich wieder aufrichtete und die Mutter mit einem letzten Lächeln bedachte. Die Mutter nickte nur, bevor sie ihr Kind aus dem Raum führte. Während der Pastor der mitleiderregenden Familie nachblickte, verschwand sein Lächeln und Traurigkeit legte sich auf sein Gesicht. Dieselbe, die Christine schon vorher bei ihm aufgefallen war. Sie wusste, dass sie ihn nicht anstarren sollte, sondern wie alle anderen ehrenamtlichen Mitarbeiter sollte sie die Kapelle verlassen. Aber dieses Gefühl in ihrer Brust ließ ihr keine Ruhe. Als der Pastor zum Predigtpult zurückkehrte, ging sie einige Schritte auf ihn zu, blieb dann aber stehen und spielte nervös mit ihrem Perlentäschchen. Wer war sie, dass sie den Pastor ansprechen wollte? Sie war eine unauffällige, unbedeutende Frau. Sie ging normalerweise nicht auf andere Menschen zu, sondern arbeitete im Stillen. Mit ihrem eher schlichten Aussehen, ihrer zierlichen Figur und ihrem unscheinbaren dunklen Haar stach sie nicht aus der Menge heraus. Und damit war sie auch vollkommen zufrieden. Heute jedoch wünschte sie, das wäre anders, während sie mutig auf den Pastor zuging. Sie blieb erst stehen, als sie vor dem Predigtpult stand, wo er mit einem geistesabwesenden Stirnrunzeln mehrere Blätter in seine Bibel steckte. Sie wartete, während er seine Notizen einpackte, seine Bibel zuklappte und sich schon umdrehen wollte, ohne sie zu bemerken. Etwas in ihr wollte am liebsten geräuschlos davonhuschen wie eine Maus, die in ihr Loch flieht. Aber sie nahm ihren ganzen Mut zusammen. »Pastor Bedell?«, sagte sie. Er hielt inne und blickte sie an. Sie rechnete damit, dass er sie gereizt oder wenigstens erschöpft ansah. Aber sein herzliches Lächeln und die echte Freundlichkeit in seinen Augen überraschten sie. »Ja? Mrs …? Verzeihen Sie, ich habe anscheinend Ihren Namen vergessen.« »Bitte machen Sie sich deshalb keine Mühe. Sie müssen sich so viele Namen merken.« In seinen Augenwinkeln lagen sympathische Fältchen, die im Gegensatz zu seinem übrigen Erscheinungsbild verrieten, dass er schon ein wenig älter war. Sie hatte die anderen Damen der Damengesellschaft tuscheln gehört, dass er einen erwachsenen Sohn habe, der Theologie studierte und Pfarrer werden wollte. Aber Pastor Bedell sah nicht so alt aus, dass dieses Gerücht stimmen konnte. »Ich versuche immer, mir die Namen der ehrenamtlichen Helfer zu merken. Das dauert allerdings eine gewisse Zeit, Mrs …« »Miss Pendleton«, antwortete sie und bewegte sich unbehaglich, als sein Blick über ihr schwarzes Kleid mit den abgeschrägten Schultern, den weiten Ärmeln und dem vollen Rock wanderte. Ihre Mutter war im März gestorben, und die sechsmonatige Trauerzeit war noch nicht vorbei, die beim Tod eines Elternteils von der Gesellschaft erwartet wurde. »Mrs Pendleton«, sagte er. »Mein herzliches Beileid. Ihr Mann?« »Oh, nein. Ich bin nicht verheiratet. Ich bin Miss Pendleton.« Sie betonte die Anrede laut und deutlich, doch dann begriff sie, dass sie soeben der ganzen Welt unmissverständlich verkündet hatte, dass sie eine alte Jungfer war. Sie errötete beschämt. »Verzeihen Sie«, sagte der Pfarrer. »Meine Mutter ist kürzlich verstorben«, ergänzte sie und beeilte sich, ihre Verunsicherung zu überspielen. »Sie war viele Jahre lang krank und wurde schließlich von ihrem Leiden erlöst.« »Noch einmal mein herzliches Beileid.« Das Mitgefühl in seinen Augen vermittelte ihr den starken Eindruck, dass er diese Worte nicht nur aus Höflichkeit sagte, sondern sie ernst meinte. »Danke.« Wenn sie dieses Mitgefühl nur nötig hätte! Sie senkte den Blick, um ihre Schuldgefühle zu verbergen. Die Wahrheit war, dass sie bei Mutters Tod keine Trauer gespürt hatte, und auch jetzt regte sich keine Traurigkeit in ihrem Herzen. »Die Zeit wird den Schmerz lindern«, sagte er, da er ihren gebeugten Kopf offenbar als Zeichen der Trauer deutete. »Ich spreche aus Erfahrung.« Sie wagte es nicht, ihn anzublicken. Er würde sie sicher für hartherzig halten, da sie zu keiner echten Trauer fähig war. Außerdem würde er dann sehen, dass sie die Gerüchte über ihn gehört hatte und wusste, dass er Witwer war. Die Damen hatten erwähnt, dass Pastor Bedells Frau vor über zehn Jahren gestorben war, er aber nie ein Interesse daran gezeigt hatte, wieder zu heiraten. Natürlich waren sich die Damen einig gewesen, dass dies sehr schade war. Er schwieg einen Moment, als teile er ihre Trauer. Dann drückte er überraschend ihren Oberarm. Die Berührung war kurz, aber herzlich. »Der Einsatz für den Herrn hilft, den Schmerz zu lindern. Das Leid anderer Menschen lenkt unseren Blick von unseren eigenen Umständen ab, nicht wahr?« Sie nickte und hob endlich den Blick. »Darüber wollte ich mit Ihnen sprechen, Herr Pfarrer.« Als sie jetzt in seine mitfühlenden Augen blickte, stellte sie fest, dass sie eine interessante blaugrüne Farbe hatten, die an Eukalyptus erinnerte. Sie verkrampfte die Hand um ihr Handtäschchen und spielte verlegen mit dem Verschluss. Ihr wurde plötzlich bewusst, wie attraktiv dieser Mann war und sie so gar keine Erfahrung im Umgang mit dem anderen Geschlecht hatte. Er klemmte die Bibel unter seinen Arm und wartete. »Ja«, sagte sie eilig. »Ich würde gern einen Weg finden, diesen Frauen zu helfen.« »Sie schenken ihnen Ihre Zeit, indem Sie mit ihnen Gottesdienst feiern. Das ist ein sehr guter Anfang.« »Aber es muss doch noch mehr geben, was ich tun kann.« Der Pastor warf einen Blick auf ihr kleines Perlentäschchen, dann zog er die Brauen hoch und in seinen Augen funkelte etwas, das hoffentlich keine Belustigung war. »Miss …?« »Pendleton«, antwortete sie, ohne sich daran zu stören, dass er ihren Namen schon wieder vergessen hatte. »Miss Pendleton, wären Sie bereit, uns am nächsten Samstag zu helfen, Traktate zu verteilen? Mehrere ehrenamtliche Helferinnen und Helfer besuchen mit mir die Menschen in diesem Stadtteil, verteilen Traktate und laden zum Gottesdienst ein.« Traktate verteilen? Sie weigerte sich, die Pamphlete anzusehen, die in einer Kiste neben der Tür lagen. Schon letzte Woche nach dem Gottesdienst hatte sie sie am Ausgang an die Frauen verteilt. Die wenigen, die eines genommen hatten, hatten es achtlos eingesteckt. »Ich werde es mir überlegen.« »Gut. Dann erwarte ich Sie am nächsten Samstag um elf Uhr.« Er wollte sich wieder abwenden. »Bitte entschuldigen Sie, aber ich frage mich, ob wir nicht vielleicht andere Möglichkeiten in Erwägung ziehen sollten, um den Frauen zu helfen. Mehr als Traktate und Predigten.« Die Worte sprudelten aus ihr heraus, ehe sie es verhindern konnte. »Die Frauen und Kinder sehen unterernährt aus. Viele haben keine Schuhe. Ihre Kleidung ist zerschlissen. Sie brauchen eine Arbeit, mit der sie auf ehrliche Weise ihren Lebensunterhalt verdienen können.« Als der Pfarrer sie dieses Mal ansah, schien er sie zum ersten Mal richtig wahrzunehmen. Sie wand sich innerlich, und als sie sich im Raum umsah, stellte sie fest, dass sie die einzige ehrenamtliche Mitarbeiterin war, die noch hier war. Ihr Kutscher stand im Türrahmen, da er sich offenbar Sorgen gemacht hatte, als sie nicht zusammen mit den anderen die Kapelle verlassen hatte. Ridley bestand darauf, jede Woche auf sie zu warten, obwohl sie ihm versichert hatte, dass sie allein zurechtkam. Er hatte nur den Kopf geschüttelt und gesagt, dass er sie im Sechsten Bezirk auf keinen Fall allein lassen würde, selbst wenn das ein Kündigungsgrund wäre. »Sie haben recht, Miss Pendleton«, sagte Pastor Bedell schließlich. »Es gibt viele Nöte. Ganz Lower Manhattan müsste umstrukturiert und reformiert werden, um etwas gegen das Leiden und die Armut, die hier herrschen, zu unternehmen.« Auf dem Weg zur Kapelle in der Centre Street war sie an viel Elend und Not vorbeigefahren. Sie hatte die überfüllten Mietskasernen gesehen, die Betrunkenen und Bettler auf den Straßen und den stinkenden Müll in den Rinnsteinen. Die riesige Masse an Menschen, die in diesem Moloch lebten, war erdrückend. Da jeden Tag unzählige neue Einwanderer im Hafen von New York eintrafen, war die Stadt zum Bersten voll. »Sie klingen, als gäbe es für die Not der Frauen keine Hoffnung«, sagte sie. »Oh, nein«, erwiderte er. »Natürlich gibt es eine Hoffnung. Die Hoffnung in Jesus Christus.« »Ich will die geistliche Not dieser Frauen bestimmt nicht verharmlosen, aber ich habe den Eindruck, dass wir versuchen, ihren Seelen Nahrung zu geben, während ihre Körper verschmachteten.« Sie wand sich innerlich und wartete nur darauf, dass der Pfarrer sie wegen dieser unverblümten Worte tadeln würde. Aber das tat er nicht. Stattdessen drehte er sich wieder zum Predigtpult um, legte seine Bibel darauf ab und nickte ernst. Sie war überrascht. »Ich verstehe, was Sie meinen, Miss Pendleton. Wir können sie vielleicht mit Kleidung und Nahrung versorgen, aber ohne echte Umkehr und eine Veränderung ihrer Herzen werden sie zu ihren unmoralischen Wegen zurückkehren.« Sie schwieg einen Moment und dachte über seine Worte nach. Seine Logik konnte sie nachvollziehen. Trotzdem … »Warum können wir nicht ihre geistliche und ihre körperliche Not gleichzeitig lindern? Warum muss es ein Entweder-oder sein?« »Der Heilige Geist gibt Leben und Vollmacht. Wenn Menschen von ihren Sünden wirklich frei werden, haben sie die Motivation und den Wunsch, ein besseres Leben ohne Sünde zu suchen.« »Demnach hätte Jesus während seines Dienstes auf der Erde nur gepredigt. Aber hat er nicht auch Kranke geheilt und fünftausend Menschen satt gemacht? Zeigt das nicht, dass ihn sein Mitgefühl dazu trieb, mehr als nur die geistliche Not zu stillen?« Pastor Bedell legte die Ellbogen auf das Predigtpult und stützte sich darauf. Seine Augen waren geweitet und eine Nuance heller geworden; sie sahen jetzt eher blau als grün aus, als habe der Sonnenschein alle Schatten vertrieben. Wieder spielte sie nervös mit ihrem Handtäschchen, doch dann schob sie es sich auf den Rücken, um es nicht weiterhin auf- und zuzumachen. »Miss Pendleton«, sagte der Pfarrer mit einem langsamen Lächeln. Sie glaubte fast, einen Anflug von Bewunderung in seiner Miene zu entdecken. »Sie sind scharfsinnig und ich schätze Ihre Logik. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass Jesus auf eine Weise, zu der wir nicht in der Lage sind, körperlichen Nöten abhelfen und gleichzeitig Herzen verändern konnte.« »Aber ihm war es sehr wichtig, die körperlichen Bedürfnisse der Verlorenen zu stillen.« Sie deutete auf die Bibel, die auf dem Predigtpult lag. »Darf ich?« »Natürlich.« Er reichte ihr das Buch. Sie schlug die abgegriffenen Seiten auf und bemerkte die vielen unterstrichenen Textstellen und Anmerkungen an den Seitenrändern. Sie blätterte zum 25. Kapitel des Matthäusevangeliums, räusperte sich und begann zu lesen. »›Geht mir aus den Augen, ihr Verfluchten, ins ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel bestimmt ist! Denn ich war hungrig, aber ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig, aber ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war als Fremder bei euch, aber ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen, aber ihr wolltet mir keine Kleider geben. Ich war krank und im Gefängnis, aber ihr habt mich nicht besucht. … Ich versichere euch: Die Hilfe, die ihr meinen geringsten Brüdern und Schwestern verweigert habt, die habt ihr mir verweigert.‹« Sie klappte die Bibel wieder zu und legte sie zurück. Ridley wartete immer noch an der Tür. Die Etikette gebot ihr, sich zu verabschieden und zu gehen. Noch länger zu bleiben und weiter mit ihm zu diskutieren, wäre nicht damenhaft. Während sie bereits einen kleinen Schritt zurücktrat, sagte Pastor Bedell: »Jedes Mal, wenn ich diese Frauen besuche, komme ich ehrlich gesagt deprimiert zurück und wünsche und bete, ich könnte mehr tun. Es gibt Tage, an denen ich mich frage, was ich hier eigentlich mache. Ich sehe keine Fortschritte. Wenn ich den Dienst hier aufgebe und woanders hingehe, könnte vielleicht ein Pastor hierherkommen, der fähiger ist als ich und das schaffen kann, was mir verwehrt ist.« Kaum hatte er diese Worte ausgesprochen, da fuhr er sich mit der Hand über den Mund, als würde er das Gesagte gern zurücknehmen. »Entschuldigen Sie, Miss Pendleton.« »Ich kann nur ahnen, wie entmutigend diese Arbeit Tag für Tag sein muss.« Sie schätzte seine Ehrlichkeit und hatte das Bedürfnis, ihn zu beruhigen. »Ich wäre wahrscheinlich auch manchmal entmutigt.« Er nickte stumm. »Aber es gibt nicht viele Menschen, die so sind wie Sie, Pastor Bedell. Menschen, die bereit sind, die Not der Einwanderer zu sehen. Deshalb bezweifle ich, dass Gott Sie von dieser Aufgabe entbinden wird.« Er blickte ihr ernst in die Augen. Das Fenster zu seiner Seele stand offen und er gewährte ihr einen tiefen Einblick in seine Verunsicherung und seine Ängste. »Vielleicht sollten Sie nicht überlegen, ob Gott Sie in einer anderen Gemeinde haben will«, sprach sie weiter. »Vielleicht fordert er Sie ja dazu auf, einige Veränderungen in Erwägung zu ziehen. An dem Ort, an dem Sie gerade sind.« Seine Miene verriet, dass er ihre Worte ernsthaft abwog. »Erst diese Woche habe ich darüber gebetet, ob ich meine Kündigung einreichen soll. Ich habe den Eindruck, dass mir Gott durch Sie, Miss Pendleton, gerade seine Antwort gibt.« Eine leichte Befriedigung breitete sich in ihrer Brust aus, und sie konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen. Seine Augen leuchteten und sein Lächeln kehrte zurück. Er strahlte eine Freude aus, die vorher nicht da gewesen war. Sie staunte erneut darüber, was für ein attraktiver Mann er war, und betrachtete die widerspenstige Haarsträhne, die ihm in die Stirn fiel. Als er sie zurückkämmte, wandte sie sich ab. Es war ihr unangenehm, dass sie ihn so interessiert gemustert hatte. »Ich muss jetzt gehen, Herr Pfarrer. Ich habe Sie ohnehin länger aufgehalten, als ich vorhatte.« Sie ging einige Schritte durch den Mittelgang auf Ridley zu. Einen Moment lang sagte der Pfarrer kein Wort, aber sie war sich sicher, dass er jeden ihrer Schritte verfolgte. Obwohl sie sich bemühte, ruhig zu bleiben, spürte sie unter seinem Blick ein nervöses Kribbeln im Bauch. Sie war schon fast an der Tür, als seine Stimme die Stille durchbrach. »Warten Sie bitte.« Sie drehte sich wieder um. Viel zu schnell. Er war um das Predigtpult herumgekommen und sah aus, als habe er die Absicht, ihr nachzulaufen. Erwartungsvoll sah sie ihn an. Aber warum hielt sie dabei die Luft an? Und warum wurde ihr plötzlich so warm? »Haben Sie irgendwelche Ideen, was ich – was wir – hier anders machen könnten?«, fragte er. Die Befriedigung, die sie vorher schon gespürt hatte, kehrte zurück. Pastor Bedell bewies Güte und Demut, wenn er sie um einen Rat fragte, obwohl sie sich ihm ungebeten aufgedrängt hatte. »Ich fürchte, ich habe heute schon zu viel gesagt.« »Ganz und gar nicht. Wenn Gott Sie als Antwort auf mein Gebet heute hierhergeführt hat, will er vielleicht, dass Sie noch viel mehr sagen.« Pastor Bedell sah mehr in ihr, als sie verdiente. Sollte sie ihm sagen, dass sie niemand Besonderes war? Aber als sie seine erwartungsvollen Augen sah, wollte sie ihn nicht enttäuschen. »Vielleicht sollten Sie weiterbeten. Wenn Gott Ihr letztes Gebet erhört hat, wird er Ihnen bestimmt wieder antworten.« »Das mache ich«, sagte er. Sie nickte und wandte sich erneut zum Gehen. »Dann sehe ich Sie am Samstag beim Besuchsdienst?« Seine Stimme klang so hoffnungsvoll, dass sie innehielt. »Sind Sie bereit, sich dann noch mehr von mir anzuhören?« Er schmunzelte. »Unbedingt.« »Dann komme ich.« Sie wurde sich erneut ihres kühnen Auftretens gegenüber diesem Mann bewusst und hatte es jetzt eilig, die Kapelle zu verlassen. Ihr Kutscher hielt ihr die Tür auf. Als sie an ihm vorbeiging, versuchte sie zu ignorieren, dass Ridley die Brauen hochgezogen hatte und sie fragend ansah. Angesichts ihres Gesprächs mit dem Pfarrer hatte ihr lieber, treuer Freund wahrscheinlich den Verdacht, sie sei nicht mehr ganz richtig im Kopf. Und sie befürchtete, dass dieser Verdacht berechtigt sein könnte.
| Erscheinungsdatum | 03.02.2022 |
|---|---|
| Übersetzer | Silvia Lutz |
| Sprache | deutsch |
| Original-Titel | An Awakened Heart |
| Maße | 125 x 187 mm |
| Themenwelt | Literatur ► Historische Romane |
| Schlagworte | Almosen • Auswanderer • Diakonie • Einwanderer • Glaube • Gott • Kleindeutschland • Liebe • Nähen • New York • praktische Nächstenliebe |
| ISBN-10 | 3-96362-253-9 / 3963622539 |
| ISBN-13 | 978-3-96362-253-3 / 9783963622533 |
| Zustand | Neuware |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
aus dem Bereich