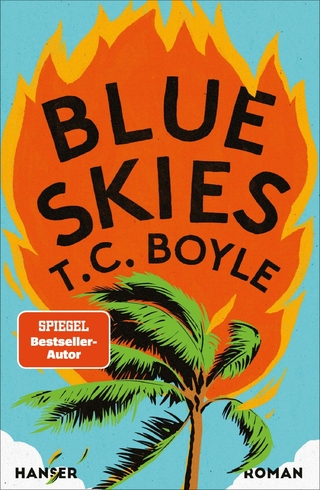Rastavati (eBook)

256 Seiten
Rowohlt Verlag GmbH
978-3-644-57181-5 (ISBN)
Jutta Weber, geboren 1964, ist Kinderärztin und lebt mit ihrer Familie in Krefeld.
Jutta Weber, geboren 1964, ist Kinderärztin und lebt mit ihrer Familie in Krefeld. Ella Carina Werner, geb. 1979, wuchs in Ostwestfalen als Tochter eines Psychologen und einer Bauchtänzerin auf. Bis 2021 war sie Redakteurin des Satiremagazins TITANIC, inzwischen ist sie dort Mitherausgeberin und schreibt die monatliche Kolumne «Rosen in Beton». Nebenher veröffentlicht sie Satiren u.a. in der taz, dem Missy Magazine oder der Frankfurter Rundschau. Außerdem ist sie Mitglied der Lesebühne «Dem Pöbel zur Freude» im Centralkomitee in Hamburg. 2020 erschien ihr gefeierter Geschichtenband «Der Untergang des Abendkleides», über den Spiegel Online schrieb: «Wie Kafka nach einem guten Joint».
Tschömeika
Wie die meisten Kinder in unserem Dorf ging ich nicht in den Kindergarten. Ich ging einfach vor die Tür. Für uns war das ganze Dorf ein einziger großer, verheißungsvoller Spielplatz, mit dem nahen Wald, den umliegenden Feldern und den vielen freien, unbebauten Flächen, auf denen Obstbäume wuchsen, meterhohes Gestrüpp und wilde Blumen.
Wir trafen uns ganz selbstverständlich an Orten, die allen bekannt waren, und brauchten uns nicht zu einer bestimmten Uhrzeit zu verabreden. Zwar gab es Zeiten, zu denen man nicht draußen spielen durfte – während der Mittagsruhe, abends ab 18 Uhr und am Sonntag –, ansonsten aber liefen wir einfach los und guckten, was sich ergab.
Es war ein brütend heißer Tag im Sommer, der letzte Sommer, bevor ich in die Schule kam. Gleich nach dem Frühstück eilte ich los in meiner kurzen Frottéhose, lief übers Kopfsteinpflaster, vorbei an den letzten Häusern und den verwilderten Wiesen bis zum nahegelegenen Wald. Dort trafen wir uns, acht, neun Kinder, spielten Verstecken, Fangen oder gruben tiefe Löcher in die Erde: Höhlen, in denen wir stundenlang hockten und uns vorstellten, dort zu wohnen, für immer, bis in alle Ewigkeit – oder wenigstens bis zum Mittagessen, dann liefen wir heim zu unseren Müttern wie von einer inneren Uhr getrieben.
Wie jeden Morgen galt es zuerst zu klären, wie wir den Tag verbringen sollten. Regina ergriff als Erste das Wort. Mit acht Jahren war sie die Älteste, hatte einen blonden Pferdeschwanz, Sommersprossen und eine große Klappe. Sie schlug vor, Wildblumen zu pflücken und an die alten Witwen im Dorf zu verscherbeln, die uns für drei Groschen jeden Blumenstrauß abkauften.
Ich hatte auch einen Vorschlag, ich wollte eine Hütte bauen aus herumliegenden Ästen und geheimnisvollem Müll, den man hier und da zwischen den Bäumen fand. Auch der dicke Jürgen meldete sich. Sein Plan war, einen Ameisenhaufen aufzustöbern und ihn dann ein bisschen anzukokeln. Stolz zog er ein Feuerzeug aus seiner Hosentasche, doch als er Reginas rollende Augen sah, nahm er den Vorschlag zurück.
Ich nicht. Ich konnte extrem stur sein und wusste genau, was ich wollte und was nicht. Ich wollte nicht schon wieder stinklangweilige Blumen pflücken.
Regina nannte meinen Vorschlag kindischen Pipikram. Ihre Augen blitzten mich an.
Ich wollte immer noch eine Hütte bauen.
Rasch bildeten sich zwei Lager. Die Diskussion wurde hitziger, die Stimmen lauter, die Wangen glühten mit der Sonne über den Baumkronen um die Wette. Kampfeslustig sah ich Regina in die Augen und zischte: «Du bist nicht der Bestimmer!»
Regina schaute mich an, hielt inne. Dann stemmte sie die Hände in die Hüften und fauchte: «Wer denn sonst? Etwa du? Du weißt ja nicht einmal, wer deine Eltern sind!»
Dann war es still. Regina, sich der triumphalen Bedeutung ihrer Worte sicher, schob ihr Kaugummi über die Zunge, ließ es zur Blase anwachsen und geräuschvoll knallen, ehe sie fortfuhr: «Denk mal nach! Deine Mutter ist weiß. Dein Vater ist weiß. Du bist braun. Wie soll das gehen? Hä?»
Ich wich einen Schritt zurück. Dann sah ich es aus den Augenwinkeln. Jürgen nickte. Auch andere Köpfe gerieten in Bewegung, erst zögernd, dann entschlossen. Selbst Maria, meine beste Freundin Maria, schwieg.
«Wusstest du’s nicht?», holte Regina zum finalen K.-o.-Schlag aus: «Du bist adoptiert!»
Ich wusste, was das war. Jeder wusste das. Adoptiert, das war der schüchterne, schmächtige Sohn der Bäckerin. Aber doch nicht ich! Mein Fäuste ballten sich in meinen Hosentaschen.
«Wer sagt das?», stieß ich hervor, bemüht, dass meine Stimme nicht zittrig klang.
«Meine Eltern», grinste Regina und machte noch eine Kaugummiblase. «Und Jürgens Eltern auch. Und deine Eltern sagen es dir erst, wenn du erwachsen bist.»
Jetzt gab es kein Halten mehr. Ich sprang auf Regina zu, nahm sie in den Schwitzkasten und schleuderte sie zu Boden. «Lügnerin! Lügnerin!», schrie ich ihr ins Gesicht, dann rannte ich nach Hause.
Ich stolperte über Baumwurzeln, Moosflechten und einen alten Autoreifen, aus dem meterhoch Brennnesseln wuchsen. In sicherer Entfernung kauerte ich mich neben ein paar Pilze, schlug ihnen vor Wut die Köpfe ab. Dann kam die erste Träne und dann noch eine. Bald waren es so viele, dass der Stoff meines T-Shirts durchweichte.
Regina hatte einen wunden Punkt getroffen – einen Punkt, von dem ich bisher nicht einmal gewusst hatte, dass es ihn gab. Dieses gemeine Klatschweib, diese falsche Schlange, dieses Lügenmaul … hatte am Ende vielleicht recht!
Weiße Eltern können unmöglich ein braunes Kind haben, klar, wie soll das auch gehen? Ich begutachtete meine nackten Arme. So braun waren sie mir nie vorgekommen. Ein bisschen hellbraun vielleicht, das schon. Jetzt sah ich, wie sattbraun sie waren, braun wie die Eicheln, die hier überall herumlagen. Ich dachte an die weißen Arme meiner Mutter mit den winzigen blonden Härchen darauf, ich dachte an ihre hellgrünen Augen, während ich aus dem Wald lief, wie aus dem Paradies vertrieben.
Einen Song von den Rolling Stones pfeifend, öffnete meine Mutter die Wohnungstür. In der linken Hand hielt sie ein Schneidemesser, in der rechten ein kunstvoll gezacktes Radieschen. Als sie meine verheulten Augen sah, verstummte ihr Pfeifen, und sie beugte sich zu mir herunter.
«Mama, ich bin jetzt sechs. Ich bin alt genug. Bitte, sag es mir!», flehte ich sie unter Tränen an.
«Himmel, was denn?», fragte meine Mutter.
«Dass du mich adoptiert hast. Ich komme damit klar!», schluchzte ich. Und ergänzte leiser, fast flüsternd: «Ich sag es auch niemandem weiter.»
«Was sagst du da? Wer erzählt denn so einen Käse?» Eine tiefe Falte bildete sich auf ihrer Stirn. «Oh warte, lass mich raten. Den Floh hat dir die alte Frau Kasnitz ins Ohr gesetzt. Nur weil sie sitzengelassen wurde und keine Kinder bekommen hat, diese vertrocknete Jungfer!»
Mutter zog mich auf ihren Schoß und schwor bei allem, was ihr heilig war, dass ich ihre leibliche Tochter sei, dass ich in ihrem Bauch gewachsen, ja ihrem Schoß entschlüpft sei – und unter welch Höllenqualen! Und wie die Hebamme dümmlich geglotzt habe, wie ihr die Kinnlade heruntergeklappt sei, als sie mich sah, klein und braun wie ein Karamellbonbon.
Sanft schob mich meine Mutter vom Schoß herunter. Sie ging ins Kinderzimmer, um nach meinem kleinen Bruder zu gucken, der gerade ein Mittagsschläfchen machte. Dann lief sie ins Wohnzimmer, riss die unterste Schublade der Kommode auf, kramte die Fotokiste hervor, angelte ein kleines schwarzweißes Bild heraus und legte es vor uns auf den Küchentisch, so vorsichtig, als wäre es ein beglaubigtes Dokument.
Auf dem Foto stillte sie ein Baby. Ganz klar, die blonde, stark geschminkte, lächelnde Frau unter dem Bill-Haley-Poster war meine Mutter. Aber das braune, unscharfe Baby in ihren Armen, war das wirklich ich?
Zufrieden sah meine Mutter mich an.
«Und was ist eigentlich mit Hans?», fragte ich, denn in ihrer flammenden Verteidigungsrede hatte sie ihren Ehemann kein einziges Mal erwähnt.
Mutters Gesichtsausdruck sah jetzt weniger zufrieden aus. Sie ging zum Küchenschrank, holte zwei Gläser heraus. In das eine goss sie Martini, in das andere Zitronensprudel – den gab es bei uns nur ausnahmsweise –, und stellte beide Gläser auf den Küchentisch. Sie lächelte schief, fast verlegen, ein Lächeln, das ich nicht an ihr kannte.
«Na, du weißt doch, dass wir nicht immer bei Hans waren und dass er nicht dein richtiger Vater ist», sagte sie. «Dein richtiger Vater … dein richtiger Vater ist ein Mann aus Jamaika.»
Ich verschluckte mich fast am Sprudel.
«Tschömeika?» Ein Wort, das sich in meinem Mund so fremd anfühlte wie eine neue Kaugummisorte.
«Das ist eine Insel, die ganz, ganz weit weg ist», präzisierte meine Mutter.
«Und wie heißt mein Vater?»
«Oin.»
Oin, Oin, Oin, Oin … mehrmals hintereinander gemurmelt, klang der Name wie ein hüpfender Flummi, irgendwie lustig.
«Und weiter?»
«Nichts weiter. Das heißt, ich weiß es nicht. Ich hab ihn nur einmal in einer Bar gesehen. Er hat Saxophon in einer Band gespielt. Ich habe ihm zugesehen, und so hab ich ihn kennengelernt.»
«Was ist ein Saxophon?»
«Das ist das schönste Instrument der Welt.» Mutter bekam leuchtende Augen, sah jetzt weniger verlegen aus. «Ich spiele dir gleich auf einer Platte vor, wie es klingt.»
Diese erstaunlichen Neuigkeiten hätte ich eigentlich erst mal verdauen müssen, dennoch ploppten in meinem Kopf immer neue Fragen auf, deshalb bohrte ich weiter: «Und wie sah mein Vater aus?»
«Groß. Na ja, so groß auch wieder nicht. Vielleicht eher mittelgroß. Na, eigentlich hab ich keine Ahnung …»
«Welche Augenfarbe hatte er?»
«Äh, also blau werden sie nicht gewesen sein. Eher dunkel. Schwarz vielleicht. Schwarz wie Brombeeren, wenn ich das jetzt nicht irgendwie verwechsle …»
Nachdenklich wickelte ich eine Locke um meinen Zeigefinger. «Und warum kommt er uns nie besuchen?»
«Ach, weißt du, er spielt mit seiner Band überall auf der Welt und weiß gar nicht, wo wir wohnen. Aber, Mäuschen, dein Papa ist ja jetzt Hans!»
«Hmmm …»
Dann sagte meine Mutter nichts mehr, sondern zog eine Schallplatte aus ihrer quietschbunten Hülle, legte sie auf den Plattenteller und setzte die winzige Nadel darauf. Erst kam das vertraute Knistern und dann ein dunkler, langgezogener, sehnsüchtiger Ton.
«Das ist es. Ein Saxophon», sagte meine Mutter, schloss die Augen und wiegte...
| Erscheint lt. Verlag | 24.3.2017 |
|---|---|
| Verlagsort | Hamburg |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Literatur ► Romane / Erzählungen |
| Schlagworte | Familiengeschichte • Jamaica • Rheinland • Sechziger Jahre • Spurensuche |
| ISBN-10 | 3-644-57181-3 / 3644571813 |
| ISBN-13 | 978-3-644-57181-5 / 9783644571815 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 889 KB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich