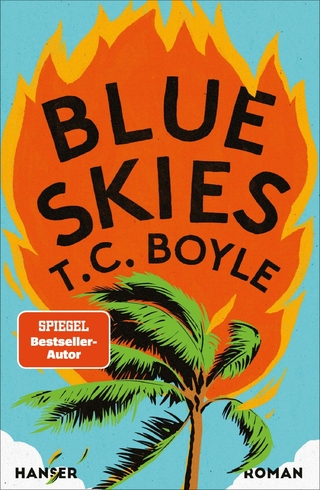Kürzere Tage (eBook)
223 Seiten
Suhrkamp (Verlag)
978-3-518-73570-1 (ISBN)
Anna Katharina Hahn, geboren 1970, lebt in Stuttgart. 2009 erschien ihr Longseller <em>Kürzere Tage</em>. Ihr zweiter Roman, <em>Am schwarzen Berg</em>, stand 2012 auf der Shortlist für den Preis der Leipziger Buchmesse und auf Platz 1 der SWR-Bestenliste. Mit <em>Das Kleid meiner Mutter</em> hat sie 2016, so Denis Scheck, »ein großes europäisches Tableau« entworfen. Ihr Roman <em>Aus und davon</em> erschien 2020 und stand mehrfach auf der Spiegel-Bestsellerliste.
Judith
Judith raucht hastig, mit dem Rücken gegen die Wohnungstür gelehnt. Sie läßt den Rauch tief in ihre Brust einströmen und atmet ihn durch die Nasenflügel wieder aus. Das Verlangen nach einer Zigarette, schlimmer als der Druck einer vollen Blase, beherrscht schon den ganzen Tag. Am Morgen waren die Kinder zu ihr ins Bett geschlüpft, bevor sie sich hinausschleichen konnte, um auf dem Küchenbalkon zu rauchen. Viel zu lange mußte sie auf eine günstige Gelegenheit warten. Das steinerne Gesicht, mit dem sie Tee gekocht, Müsli in Schalen gefüllt, Obst geschnitten und selbst nur an ihrer Tasse genippt hatte, kennt die Familie schon. »Die Mama ist manchmal ein Morgenmuffel«, bemerkte der fünfjährige Uli. Judith macht einen inbrünstigen Lungenzug und stellt sich vor, wie sich die bläulichen Schwaden mit ihrem Blut vermischen und zum Herzen ziehen, es einhüllen und ruhiger schlagen lassen. Die Gier ebbt langsam ab, sie hat wieder Augen und Ohren für ihre Umgebung und beginnt sich zu schämen. Im Treppenhaus flucht Klaus, wahrscheinlich hat er etwas vergessen, die Blockflöte, Ulis Mütze. Um vier fängt der Unterricht an. Sie betet in eine unbestimmte Richtung, daß die beiden nicht noch mal hochkommen. Dann hört sie Ulis helle, vorwurfsvolle Stimme: »Aber Papa, da ist sie doch!«, einen Seufzer von Klaus, Gepolter auf den Stufen, das Schlagen der Haustür. Schnell macht sie den letzten Zug, spürt schon die Glut an den Fingerspitzen, als sie den Stummel in den winzigen Aschenbecher quetscht. Sie schiebt den Deckel zu und schließt eine schmale Faust um das Döschen, das silbern funkelnd und gewärmt von der in seinem Inneren sterbenden Glut anmutet wie das Utensil zu einem besonders verfeinerten Laster – das Spritzbesteck eines Dandys, der Kokslöffel einer Bohemienne.
Sie geht durch den langen Flur ins Eßzimmer, öffnet die Fenster weit und läßt den Qualm abziehen. Seit langem hat sie sich nicht so gehenlassen. Normalerweise raucht sie auf dem Balkon oder unten im Hof. Das Wegbringen der Mülltüten hat sie deshalb an sich gerissen. Die Constantinstraße liegt still im Nachmittagslicht. Braungelbe Sandsteinhäuser wölben ihre verzierten Fassaden nach vorne wie frische Brote und Kuchen, die aus ihren Backformen quellen. Über den grauen Schieferdächern steht die Sonne und läßt Gerüche aufsteigen, die auch mitten in der Stadt zum Herbst gehören: das Nußaroma zerquetschter Blätter auf dem Gehweg und in den umliegenden Höfen, die Früchte von Eberesche, Holunder, Apfel und Zwetschge, teils überreif an den Ästen, teils als fauliges Fallobst auf der Wiese des kleinen Gartens hinter dem Haus. Dazu kommen die Dünste selten vorbeifahrender Autos und Heizungsrauch als Bote der ersten Nachtfröste.
Judith versteckt Aschenbecher, Feuerzeug und die Packung Rothändle im Flurschrank in der Tiefe ihrer häßlichsten Handtasche und steckt ein starkes Pfefferminzbonbon in den Mund. Dann tritt sie wieder ans Fenster und schüttelt das Tischtuch aus. Ein Mädchen in Ulis Alter wippt auf dem gegenüberliegenden Bordstein, unruhig wie ein Vogel. Ihr Gesicht ist weiß geschminkt, ein grelles Kopftuch verbirgt das Haar, in einer Hand hält sie einen kleinen Besen. Sie wendet den Kopf zur geöffneten Eingangstür des Nachbarhauses und brüllt: »Mama, Feli, schneller!« Halloween ist erst in einer Woche, aber Judith hat heute schon verkleidete Kinder gesehen. Sollte eines von ihnen klingeln, wird sie nicht öffnen. An mit grinsenden Kürbissen, Skeletten und Vampiren dekorierten Geschäften lotst sie ihre Söhne vorbei.
Der silberne ?Skoda ist bereits weg. Sie hat Uli und Klaus nicht gewinkt. Sicher hat der Junge enttäuscht hochgeschaut. Klaus weiß, warum sie nicht aufgetaucht ist. Wahrscheinlich hat er für sie gelogen: »Die Mama ist sicher in der Küche, oder sie muß sich um den Kilian kümmern.« Aber im Laufe des Abends würde er die Sache doch noch ansprechen: »Mal wieder unnötige Traurigkeit wegen deines Hackstraßenmists.«
Hackstraßenmist ist Klaus’ Codewort für verschiedene schlechte Gewohnheiten, die Judith aus ihren Jahren in der dunklen Einzimmerwohnung im Stuttgarter Osten mitgebracht hat. Aus dem Fenster konnte man den Gaskessel und die Anlagen der Schlachthöfe sehen, auch das Stadion mit seinem geschwungenen Rund und den Turm einer Kirche, deren Namen sie bis heute nicht kennt.
In der Hackstraße hatte sie sich schon morgens im Bett die erste angesteckt, mit halbgeschlossenen Augen und schlafwarmen Händen, deren Muskeln noch so abgeschlafft waren, daß sie kaum die Kraft hatten, das Feuerzeug aufschnappen zu lassen. Wenn sie sich dann langsam herausquälte, zum Klo, zur Kaffeemaschine und später ins Seminar oder zu einer ihrer Praktikumsstellen, folgte der Morgenzigarette die Frühstückszigarette und so weiter. Und hier in der Constantinstraße, weit weg vom dreckigen Osten, war sie selbst während ihrer Schwangerschaften manchmal nachts aufgestanden und hatte geraucht, lustvoll inhalierend und gleichzeitig gequält von dem Bild des hilflos im Fruchtwasser zukkenden Embryos, dessen Pulsschlag sich enorm beschleunigte, während sich seine Gefäße verengten. Klaus hatte das zum Glück nie mitbekommen, ebensowenig wie ihr Frauenarzt oder die Hebamme.
Doch Hackstraßenmist war auch der Wunsch, eine Mumie zu sein, reglos und starr, alle Glieder fest umwunden von harzgetränkten Binden, Finsternis vor den Augen, ein vertrocknetes Kräuterbüschel im Mund und das rasende, peinigende Herz, gegen alle Regeln dieser Bestattungsform, ausquartiert in einem Alabasterkrug mit Hieroglyphen in der hintersten Kammer der unterirdischen Behausung. Das unaufhörlich schwätzende Hirn mit seiner Dauerbeschallung »Ich kann nicht, ich kann nicht, ich habe Angst, ich schaffe es nicht« war sauber in Lauge aufgelöst und in Fetzen aus den Nasenlöchern hinausbefördert worden, ähnlich wie Rotz, ebenso unnütz und ekelerregend. Die knöcherne Wölbung war mit Stroh ausgestopft und beherbergte den reinen Frieden. Die Ohren hörten Stille. Keiner konnte diesen tauben Lazarus mehr zurücklocken in ein Leben voller Qualen. Judith, die in der Hackstraße an einer Magisterarbeit über Otto Dix’ altmeisterliche Tafelbilder verzweifelte, war in ihrem Wunsch, dem Zustand des Begrabenseins möglichst nahe zu kommen, an manchen Tagen gar nicht erst aufgestanden. Sie hatte sich die Decke über den Kopf gezogen und sich mit dem Rücken zum Schreibtisch gedreht, um die Bildbände aus der Landesbibliothek, die Stapel zusammengehefteter Kopien und das beleidigt verschlossene Maul ihres Notebooks nicht mehr sehen zu müssen. Erst gegen Abend stand sie auf, wenn Sören, ihre Daueraffäre, anrief und vorschlug, sich in irgendeiner Bar zu treffen. Dann schminkte sie sich sorgfältig, zog ihre Lederhose an und besprühte sich mit ›Opium‹.
Seit Beginn ihres Kunstgeschichtsstudiums war Judith eine eifrige und ehrgeizige Studentin, die nie kellnern mußte, sondern immer Hilfskraftstellen bekam. Sie saß oft bis zur Schließung der Seminarbibliothek in der Keplerstraße unter einer flackernden Neonröhre, exzerpierte Weisheiten von Panofsky bis Aby Warburg auf Karteikarten, besuchte Wochenende für Wochenende die Staatsgalerie und fuhr mit Billigbussen nach Berlin, Düsseldorf und Hamburg, um sich wichtige Ausstellungen anzusehen. Im Oberseminar kreuzte sie lässig die schmalen Knöchel in roten Riemchenschuhen. Das schwarze Haar trug sie aufgesteckt, dazu ein Make-up wie Frida Kahlo und große glänzende Ohrringe. Daß sie eigentlich Jutta hieß, ihre Eltern ein Küchenstudio in Kirchheim unter Teck besaßen und ihre zwei verheirateten Schwestern zusammen schon fünf Kinder hatten, sah man ihr nicht an. Sie sagte nicht viel, aber wenn sie sprach, war es unangreifbar. »Hier hat jemand wirklich nachgedacht. Sehr gut, Frau Seysollf.« Keine ihrer Kommilitoninnen ahnte, daß Judith vor jedem Referat nächtelang nicht schlafen konnte, daß sie weinend unter ihrem Schreibtisch saß und nichts aß, daß sie jeden Beitrag vor einer größeren Gruppe erst niederschreiben und auswendig lernen mußte, bis sie wagte, sich zu äußern. Auch die Abgabe von Hausarbeiten stürzte sie in Panikattacken. Sie verlor mehrere Semester durch die Zögerlichkeit, mit der sie ihre Arbeiten wieder und wieder korrigierte. An der Uni funktionierte dieses Verhalten, denn niemand hielt sie davon ab, niemand gab ihr Ratschläge. Zu Hause verstanden sie nichts davon. Den gelegentlichen Jammerrufen: »Mädle, was bringt dir des, du sottscht endlich au heirate« entging Judith, indem sie ihre Besuche auf die hohen Feiertage beschränkte, obwohl sie an ihrer Familie hing, die runde Kuppe der Teck, ihre Neffen und Nichten und sogar die Kochinseln und Hängeschränke im elterlichen Laden vermißte.
Der Betreuer ihrer Magisterarbeit war aufgrund seines guten Rufs viel im Ausland. Zu seinen seltenen Sprechstunden mußte man sich Monate vorher anmelden. Als Judith als Hilfskraft für ihn arbeitete, bekam sie ihn innerhalb eines Semesters vielleicht dreimal zu Gesicht. Sie geriet an Professor Baumeister, der zu allem Überfluß Canetti zum Verwechseln ähnlich sah, wie eine Masochistin, die sich auf die Anzeige eines strengen Dompteurs meldet. Er galt als unberechenbar. Seine Streitigkeiten mit den Kollegen im Seminar waren legendär. Man tuschelte, daß er seinem eigenen Assistenten die Diss vor die Füße geschmissen hätte. Judith zitterte am ganzen Körper, wenn sie mit Baumeister telefonierte und mit kühler Stimme ihre Thesen darlegte. Schriftliche Äußerungen vermied sie. Es schien ihr zu gefährlich, ihm etwas in die Hand zu geben, was er zerreißen oder rot anstreichen konnte.
»Die...
| Erscheint lt. Verlag | 16.11.2010 |
|---|---|
| Verlagsort | Berlin |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Literatur ► Romane / Erzählungen |
| Schlagworte | Buchpreis der Stiftung Ravensburger Verlag 2020 • Ehrengabe der Kester-Haeusler-Stiftung 2018 • Erzählungen • Romane • ST 4158 • ST4158 • Stuttgart • suhrkamp taschenbuch 4158 • Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg 2021 |
| ISBN-10 | 3-518-73570-5 / 3518735705 |
| ISBN-13 | 978-3-518-73570-1 / 9783518735701 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 1,8 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Zusätzliches Feature: Online Lesen
Dieses eBook können Sie zusätzlich zum Download auch online im Webbrowser lesen.
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich