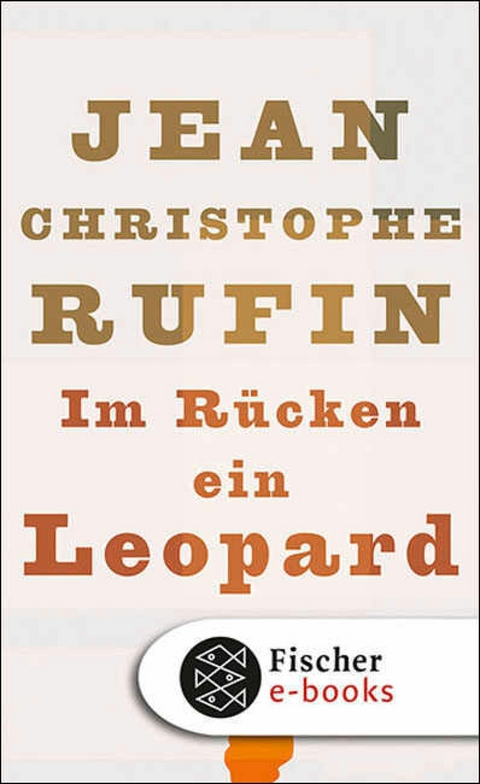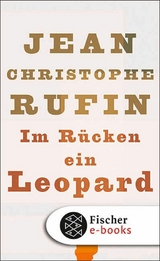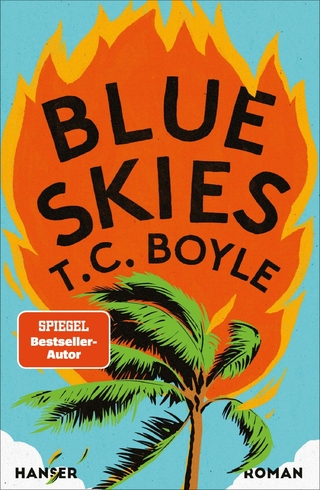Im Rücken ein Leopard (eBook)
288 Seiten
S. Fischer Verlag GmbH
978-3-10-400978-0 (ISBN)
Jean-Christophe Rufin, 1952 in Bourges geboren, studierte Medizin und Politik, war Vize-Präsident von »Ärzte ohne Grenzen«, Berater im französischen Verteidigungsministerium und beim Roten Kreuz. Er ist einer der erfolgreichsten und renommiertesten Autoren Frankreichs. 2001 gewann er den Prix Goncourt. Er arbeitete als Entwicklungshelfer und engagiert sich gegen Antisemitismus und Rassismus. Von 2007 bis 2010 war er französischer Botschafter in Senegal. Er ist das jüngste Mitglied der Académie Francaise. Literaturpreise: Prix Goncourt 2001
Jean-Christophe Rufin, 1952 in Bourges geboren, studierte Medizin und Politik, war Vize-Präsident von »Ärzte ohne Grenzen«, Berater im französischen Verteidigungsministerium und beim Roten Kreuz. Er ist einer der erfolgreichsten und renommiertesten Autoren Frankreichs. 2001 gewann er den Prix Goncourt. Er arbeitete als Entwicklungshelfer und engagiert sich gegen Antisemitismus und Rassismus. Von 2007 bis 2010 war er französischer Botschafter in Senegal. Er ist das jüngste Mitglied der Académie Francaise. Literaturpreise: Prix Goncourt 2001 Anne Braun lebt in Freiburg und übersetzt Literatur und Sachbücher aus dem Französischen, Englischen und Italienischen. Für ihre Arbeiten wurde sie mehrfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis.
1.
Ich wurde in die Medizin hineingeboren, so wie andere das Licht der Welt an einer Küste, am Fuße eines Bergs oder auf dem Lande erblicken. So weit ich mich zurückerinnere, war die Medizin für mich ein Ort, ein Zustand, ein Umfeld, lange bevor ich sie erlernte und sie mein Beruf wurde.
Am Anfang stand, aber das hätte natürlich nicht genügt, in meinem Fall das Skalpell des Chirurgen, der mich aus dem Leib meiner Mutter schnitt. Das geheimnisvolle Wort »Kaiserschnitt«, das ich in meiner Kindheit so häufig hörte, war die einzige Spur, an die ich mich bezüglich meines Eintritts in diese Welt, umgeben von weißen Kitteln, halten konnte. Das war an einem erstickend heißen Hundstag Ende Juni, ein Monat, der ohnehin heißer war als sonst. Mit Hinweis auf die Risiken, die mir drohten, brachte man mich fürs Erste in dem kühlen Haus meiner Großeltern unter, aus dem ich erst im Alter von zehn Jahren wieder ausziehen sollte. Meine Mutter ging nach ihrer Scheidung allein nach Paris, um dort ihr Glück zu versuchen, und mein Vater legte offenbar keinen Wert darauf, mich zu sich zu holen. So landete ich umständehalber in diesem seltsamen Haus, in dem man mit nichts weniger gerechnet hatte als mit einem Kind und in dem eine einzige unausgesprochene Leidenschaft herrschte: die Medizin.
Das große Haus war weder das, was man heute als Arztpraxis bezeichnen würde, noch lediglich der Wohnsitz eines in die Jahre gekommenen praktischen Arztes. Es war ein Tempel, ausschließlich erbaut zum Zelebrieren eines Mysteriums und ihm geweiht. Die in der Nähe gelegene Kathedrale bildete eine Art religiöses Gegenstück dazu. Das majestätische, steinerne Kirchenschiff war einem Gott geweiht, der gleichzeitig lebendig und verstorben war; das Haus meiner Großeltern hingegen war der längst vergangenen und dennoch allgegenwärtigen Verehrung eines nicht weniger aufregenden Götzen gewidmet, den man in Ermangelung eines geeigneteren Ausdrucks als Medizin bezeichnete.
Mein Großvater praktizierte damals schon nicht mehr offiziell. Dennoch behielt er seinen Praxisraum, eine Bibliothek und einen Patientenstamm bei, den er nicht im Stich lassen wollte – aber vielleicht verhielt es sich auch umgekehrt. Den Mittelpunkt des Hauses bildete sein Arbeitszimmer, ein großer, stiller Raum, den zu betreten mir lange Zeit untersagt war. Alles übrige, die Schlafzimmer, Flure und Treppenabsätze, Mansardenzimmer und die Küche waren lediglich die Vorzimmer dieses Heiligtums, ohne das diese Räume jede Bedeutung verloren hätten. Im Übrigen wurde das Haus nach seinem Tod unverzüglich verkauft.
Jedes Mal, wenn es am Nachmittag läutete, hatte ich die Anweisung, mich zu verkrümeln, während gebeugte Schattengestalten über die Schwelle traten und sich durch den Garten auf die Veranda zubewegten. Dieser längliche, schmale, verglaste Raum voller Topfpflanzen sah eigentlich wie ein Wintergarten aus. Erst durch die Patienten, die nachmittags darin Platz nahmen, enthüllte sich seine wahre Bestimmung: Es handelte sich um ein Wartezimmer, eine obligatorische Zwischenstation, in der jeder Halt machen musste, ehe er das Allerheiligste betreten durfte.
Am anderen Ende des Gartens gab es ein recht hässliches, viereckiges Backsteingebäude. Darin stank es nach Öl und Reifen, und wegen der Metallfelgen an der Wand und der auf dem Boden aufgereihten Kanister sah es wie eine Garage aus. In Wirklichkeit handelte es sich um eine etwas unbedeutendere heilige Stätte, die der Aufbewahrung einer weiteren Reliquie diente, nämlich des »Wagens des Doktors«. Sie hatte in der Vergangenheit ansehnliche Fahrzeuge beherbergt, an die immer andächtig erinnert wurde, besonders ein gewisses Modell namens Hodgkiss, das meine Großmutter nie ohne ein wehmütiges Seufzen erwähnte. Angesichts dieser glorreichen Vergangenheit konnte man fast vergessen, dass »der Wagen des Doktors« im Laufe der Zeit immer bescheidener geworden war. Für mich bedeutete es den eher nüchternen Anblick eines Simca Aronde, zuerst grau, dann blau. Mit seinen hervorstehenden Kotflügeln, dem Lenkrad aus hellem Bakelit und den Kunstledersitzen hatte dieser Wagen absolut nichts Majestätisches. Doch mein Großvater brauchte ihn. Mit ihm unternahm er geheimnisvolle Reisen, die ihn außerhalb der Stadt führten, an Orte, die in meinen Augen fast märchenhaft und exotisch weit weg klangen, obschon sie – wie ich später erfahren sollte – höchstens zwanzig Kilometer entfernt lagen. Das Ziel dieser Fahrten war ganz eindeutig medizinischer Art, und das verlieh ihnen eine zusätzliche Bedeutung. Es handelte sich um Besuche bei der Mutuelle agricole oder bei der Staatlichen Sozial- und Krankenversicherung des Departements Cher; Namen, deren Auswirkung man kaum ermessen kann auf ein einsames Kind, das nur selten aus dem Haus, recht selten aus seinem Stadtviertel und noch gar nie aus seinem Geburtsort herausgekommen war. So wie mein Großvater es von seinen früheren, empfindlicheren Wagen gewohnt war, ließ er den Motor vor jeder Abreise fast eine halbe Stunde lang warmlaufen. Die Abgase in der Garage brannten einem in den Augen, und das Tuckern im Leerlauf hallte von den im Halbdunkel liegenden Backsteinwänden wider. Diese feierlichen Vorbereitungen verstärkten in mir den Eindruck, dass es sich nur um eine höchst bedeutende Fahrt handeln konnte.
Lange Zeit war dieser Wagen tabu für mich. Als mir dann endlich einmal die Ehre zuteil wurde, mitfahren zu dürfen, stellte ich fest, dass mein Großvater ein sehr langsamer Fahrer war, der sehr großzügig mit den Verkehrsregeln umging. Doch das hat meine Bewunderung für ihn nicht etwa geschmälert, sondern noch verstärkt. Denn ungefähr zur selben Zeit klärte mich meine Großmutter darüber auf, dass »der Doktor« eines der allerersten Automobile des Departements besessen hatte. In diesen längst vergangenen Zeiten gehörten Autofahrer einer Elite an, der man respektvoll Platz machte. Dass Autofahrer Rücksicht nahmen, lag allein an ihrer Höflichkeit und keineswegs an Verkehrsregeln, die es damals im Übrigen noch gar nicht gab. Wenn sich mein Großvater gewisse Freiheiten im Umgang mit der Straßenverkehrsordnung herausnahm, dann nur deshalb, weil er sie nie erlernt hatte. Er war in gewisser Weise ihr Urahn. Deshalb hätte ich es vertretbar gefunden, wenn er, kraft des Privilegs, das ihm sein Alter verlieh, einfach von ihnen befreit gewesen wäre.
Als mein Großvater eines Tages in aller Arglosigkeit eine rote Ampel überfahren hatte, wurde ich Zeuge, wie er von einem Gendarmen zur Rede gestellt wurde. Dieser Zwischenfall rief in mir zuerst Entsetzen, dann Entrüstung hervor. Das Ganze endete zum Glück aber damit, dass sich der Vertreter der Staatsgewalt der – dreimal gelobten – Autorität des Vertreters der Medizin unterwarf. Der anfangs strenge Polizist starrte verblüfft auf den Führerschein, den ihm mein Großvater wunschgemäß überreicht hatte. Es war ein schlichtes, doppelt gefaltetes Stück Papier mit einer zweistelligen Nummer. Auch die Berufsbezeichnung »Arzt« war aufgeführt. Mit einer respektvollen Verbeugung gab der Gendarm meinem Großvater das Dokument zurück und sagte mit sanfter Stimme: »Herr Doktor, in Anbetracht Ihres Alters und Ihres Berufs werde ich auf eine gebührenpflichtige Verwarnung verzichten. Aber seien Sie in Zukunft etwas vorsichtiger.«
Es war das erste Mal, dass mir die Medizin wie eine Salbung vorkam, als ein ganz besonderer Stand, der jene, die seiner würdig waren, ein bisschen vom Rest der Menschheit abgrenzte.
Wodurch zeichnete sich dieser Stand aus, und wie bekam man Zutritt zu ihm? Wie wurde man Arzt? Das wusste ich nicht. Doch wegen seines elitären Charakters hätte ich es nur als natürlich empfunden, wenn sich diese Eigenschaft vererbt hätte. Dem aber widersprachen die Fakten: Mein Großvater hatte diesen Titel nicht von seinen Eltern erhalten und ihn seinerseits auch nicht an seine Tochter, meine Mutter, weitergegeben. Der Gedanke, dass man als Arzt eine bestimmte Ausbildung brauchte, kam mir erst sehr viel später in den Sinn.
Kinder glauben, die Zauberkräfte eines Zauberkünstlers steckten in seinem Zauberstab, und auf ähnliche Weise suchte ich die geheimnisvolle Macht der Medizin in ihren Instrumenten. Und ich hatte das große Glück, dass das Haus voll davon war.
In einem kleinen Anbau hinter dem Haus, der zugleich mein Schlupfwinkel war, wurde bunt durcheinander alles aufbewahrt, was mein Großvater im Laufe seiner Berufstätigkeit angehäuft hatte. Die Funktion dieser Gegenstände war mir unbekannt, doch die bizarren Formen faszinierten mich und mehr noch die Materialien, aus denen sie gefertigt waren. Emaille, Glas, gebürsteter Stahl, rissiger Gummi, das raue Gewebe der Riemen und Gurte stellten für mich die Wörter einer Sprache dar, deren Grammatik mir unbekannt war, die aber bereits zu mir sprach. Dinge, die besser Informierte als Spritzen, altmodische Blutdruckmessgeräte, Klistiere oder Päckchen mit Kompressen bezeichnet hätten, hatten in meinen Augen eine fast liturgisch anmutende Bedeutung.
Für mich gab es keinen Zweifel, dass diese Gegenstände als Requisiten für Anrufungen, Zeremonien und das Hervorrufen von Trancezuständen dienten. Sie mochten vielleicht am Körper appliziert werden, aber gewiss nur, um die Geister herbeizurufen, die das weitere Schicksal der betreffenden Personen bestimmten.
Leider habe ich nie gesehen, wie mein Großvater sie einsetzte. Das höchste der Gefühle war, dass er mir, als ich einmal eine Bronchitis hatte, ein weißes Taschentuch auf die Brust legte und sein Ohr darauf presste, um meine rasselnden Bronchien abzuhören. Er erwies mir nicht einmal die Ehre, ein Stethoskop zu verwenden … Wenn es mir nicht vergönnt war, den...
| Erscheint lt. Verlag | 13.8.2010 |
|---|---|
| Übersetzer | Anne Braun |
| Verlagsort | Frankfurt am Main |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Literatur ► Romane / Erzählungen |
| Sachbuch/Ratgeber ► Gesundheit / Leben / Psychologie | |
| Schlagworte | Afrika • Äthiopien • Autobiographie • Bernard Kouchner • Brasilien • Christiaan Barnard • Flüchtling • Françoise Xenakis • Frankreich • Goré • Gorée • Hungersnot • Krankenhaus • Medizinstudium • NGO • Paris • Prix Goncourt • Raymond Borel • Tunesien |
| ISBN-10 | 3-10-400978-3 / 3104009783 |
| ISBN-13 | 978-3-10-400978-0 / 9783104009780 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 814 KB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich