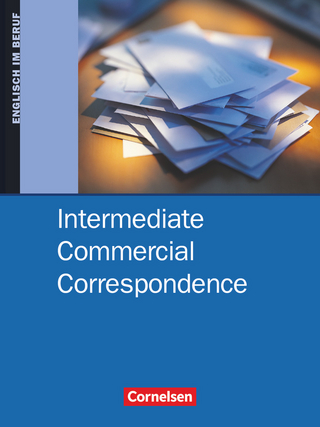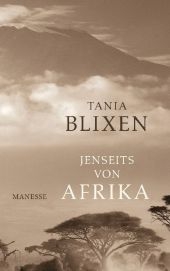
Jenseits von Afrika
Manesse Verlag
978-3-7175-2202-7 (ISBN)
- Titel erscheint in neuer Auflage
- Artikel merken
Kaum ein Klassiker des 20. Jahrhunderts strahlt eine ähnlich ungebrochene Faszination aus wie Jenseits von Afrika. Mit ihrer melancholischen Liebeserklärung an Natur und Ureinwohner Ostafrikas schuf Tania Blixen ein bewegendes Stück Weltliteratur. In dieser verbesserten, erstmals kommentierten und ergänzten Neuausgabe, die auf der dänischen Fassung des Werkes beruht, lässt sich der poetische Zauber ihrer Erinnerungen ganz neu entdecken.
Die Majestät der Berge, die unendliche Weite der Savannen und ihre Bewohner zogen Tania Blixen augenblicklich in ihren Bann, als sie 1914 ins koloniale Britisch-Ostafrika reiste, um dort zu heiraten und eine Kaffeeplantage zu betreiben. In farbigen Bildern beschreibt sie die märchenhaft-mystische Atmosphäre der Natur, erzählt von der Jagd, den ihr fremden Bräuchen der Einheimischen und von so mancher bewegenden Begegnung: mit Kamante, einem kranken Kikuyujungen, den sie zum Koch ausbildet, mit Häuptling Kinanjui, mit Berkeley Cole, der ihr zum Freund, und Denys Finch-Hatton, der zu ihrem Geliebten wird. Vor allem letztere Episode wurde durch den mehrfach preisgekrönten Hollywood-Film mit Meryl Streep und Robert Redford in den Hauptrollen unvergesslich.
Tania Blixen selbst bekannte in einem Brief an ihren Verleger: «Ich hatte in meinem Leben eine wirklich wilde, verzehrende Leidenschaft, nämlich meine Liebe für die Eingeborenen von Ostafrika – auch für ihr Land, jedoch besonders für die Menschen.» Mit Jenseits von Afrika schuf sie eine Liebeserklärung an ein schon damals vom Untergang bedrohtes Paradies. «Tania Blixen gehörte zu den ersten Weißen, die Afrikas schwarze Bewohner nicht als zu zivilisierende Wilde betrachteten, sondern als Menschen, die im Einklang mit der Natur nach ihren eigenen Gesetzen leben», schrieb Der Spiegel.
1937 erschienen, ist Blixens Afrikabuch seit Jahrzehnten ein Welterfolg. Die vorliegende Übersetzung beruht auf der dänischen Fassung letzter Hand. Diese weist unzählige inhaltliche wie sprachliche Abweichungen gegenüber der englischen Fassung auf, die 1938 Grundlage für die deutsche Ausgabe unter dem Titel Afrika – Dunkel lockende Welt war. Der vorliegende Band hält daher auch für all diejenigen eine Überraschung bereit, die ihn in alter Übersetzung bereits gut zu kennen glauben.
Die Dänin Tania Blixen, 1885 in Rungstedlund bei Kopenhagen geboren, wanderte nach dem Studium der Malerei in Kopenhagen, Paris und Rom mit ihrem Ehemann, dem schwedischen Baron Blixen-Finecke, 1914 nach Kenia aus, wo sie zu schreiben begann. Die gemeinsa
Kamante und Lullu Die Farm am Ngong Ich hatte eine Farm in Afrika am Fuß des Ngong-Gebirges2. Die Äquatorlinie zog sich fünfundzwanzig Meilen weiter nördlich durchs Hochland, doch meine Farm lag zweitausend Meter über dem Meer. Mitten am Tag konnte man diese Höhe und die Nähe der Sonne wohl empfinden, aber nachmittags und abends war es klar und kühl, und die Nächte waren kalt. Geographische Lage und Höhe über dem Meeresspiegel hatten hier vereint eine Landschaft hervorgebracht, die auf der ganzen Welt nicht ihresgleichen kannte. Sie war herb, ihre Linien waren langgezogen, nirgendwo gab es Überfluss, weder prächtige Farben noch üppige Vegetation wie in tiefgelegenen Tropenländern. Ihre Farben waren trocken und gebrannt wie die von Töpferwaren. Die Bäume trugen zarte, gefiederte Blätter, die anders angeordnet waren als die Blätter der europäischen Bäume, nicht in Kuppeln, sondern in breiten, waagerechten Schichten und Parabeln. Diese besondere Struktur des Laubs verlieh den frei stehenden Bäumen eine palmenähnliche, beschwingte Silhouette oder auch eine romantische, heroische Haltung, wie sie ein Schiff mit vollen Segeln zeigt. Und die langen Waldsäume nahmen sich dadurch so merkwürdig aus, als ob der ganze Wald bebte. In den Savannen standen die alten krummen Dornbäume einzeln und für sich, und das Gras duftete würzig nach Thymian und Porst, manchmal so heftig, dass es in den Nasenlöchern brannte. Die Blumen, die man in der Steppe oder an den Schlingpflanzen der jungfräulichen Wälder fand, waren so winzig wie Dünengewächse, doch wenn die lange Regenzeit begann, erblühten viele verschiedene Arten von üppigen, schweren Lilien und verströmten einen betäubenden Duft. Nach allen Seiten war die Aussicht weit und unendlich. Alles in dieser Natur strebte nach Größe, Freiheit und hohem Adel. Das wichtigste Element dieser Landschaft und des Lebens hier war die Luft. Blickt man auf einen mehrjährigen Aufenthalt im afrikanischen Hochland zurück, dann überkommt einen überraschend das Gefühl, als hätte man lange Zeit in der Luft gelebt. Der Himmel war niemals tiefblau, sondern zumeist sehr blass und so hell, dass man kaum zu ihm aufschauen konnte, mit einem Reichtum an riesigen, schwerelosen, wechselnden Wolken, die sich am Horizont auftürmten und über ihn hinwegsegelten. Doch eine blaue Kraftquelle lag darin verborgen und verlieh dem Höhenzug ganz in der Nähe eine tiefe, frische, himmelblaue Farbe. In der Mittagshitze wurde die Luft über der Ebene lebendig wie eine brennende Flamme, sie funkelte, wogte und strömte wie Wasser und formte große Phantasmagorien. In dieser hohen Luft fiel das Atmen leicht, und man atmete eine wilde Hoffnung ein, die Flügeln glich. Wenn man im Hochland morgens erwachte, dachte man: Jetzt bin ich da, wo mein Platz ist. Das Ngong-Gebirge zog sich als langer Höhenzug von Norden nach Süden und wurde von vier edlen Gipfeln gekrönt, die wie erstarrte Wellen aus dunklerem Blau zum Himmel aufragten. Sein höchster Punkt lag zweitausendsiebenhundert Meter über dem Meeresspiegel, und seine Ostseite erhob sich siebenhundert Meter über das angrenzende Land. Doch nach Westen fiel es viel schroffer und steiler ab, die Hänge stürzten sich fast senkrecht in das riesige Tal Rift Valley. Im Hochland wehte der Wind ständig von Nordnordost. Es war der gleiche Wind, den man an den Küsten Afrikas und Arabiens als Monsun bezeichnet, der Ostwind, das Lieblingspferd König Salomos3. In dieser Höhe empfand man ihn als den leichten Widerstand des Äthers, wenn sich die Erde dem Raum entgegenwarf. Der Wind wanderte direkt auf die Ngong-Berge zu, deren Hänge ein idealer Startplatz für ein Segelflugzeug gewesen wären - die Luftströmung hätte es vom Fuß des Gebirges bis über den Kamm getragen. Die Wolken, die mit dem Wind reisten, stießen gegen die Berge und blieben hängen, oder sie wurden von den Gipfeln aufgespießt und entluden sich in Regenschauern, während jene, die eine größere Höhe erreichten, die Klippe umschifften und unmittelbar westlich davon über den glühenden Wüsten von Rift Valley verdampften. Oft habe ich von meinem Haus den Flug der Wolken übers Gebirge verfolgt und mit Staunen beobachtet, wie sich die stolzen Massen, sowie sie über den Kamm gelangten, in Luft auflösten und verschwanden. Von der Farm aus betrachtet, änderte das Gebirge mehrmals am Tag sein Aussehen. Es gab Zeiten, da schien es ganz nah zu sein, zu anderen Zeiten war es unendlich fern. Sah man es abends in der Dämmerung, wirkten die Konturen der finsteren Berge wie mit einer zarten, feinen Silberlinie auf den dunkelnden Himmel gemalt, und wenn dann die Nacht hereinbrach, war es, als würden die vier Gipfel flacher und niedriger, als reckte und streckte sich das Gebirge, um sich zur Ruhe zu begeben. Man hatte von Ngong Hills eine einzigartige Aussicht. Im Südosten sah man die weiten Steppen, die großen Jagdgebiete, die sich bis zum Kilimandscharo erstreckten, im Nordosten die parkähnliche Landschaft der flacheren Hügel und dahinter die Wälder und noch weiter entfernt die wellige Landschaft des Kikuyureservats, das sich hundertundfünfzig Kilometer weit bis zum schneebedeckten Mount Kenya ausdehnte. Das gesamte Kikuyuland glich einem Mosaik, bestehend aus kleinen viereckigen und dreieckigen Maisfeldern, Bananenpflanzungen und Weiden, und mitten darin stieg hier und da blauer Rauch aus einem Negerdorf auf, das an ein Häuflein von kleinen, spitzen grauen Pilzen erinnerte. Im Westen aber, ganz in der Tiefe, lag eine Mondlandschaft, das afrikanische Tiefland. Die braungraue Wüste war mit winzigen Dornbäumen gesprenkelt, die gewundenen Flussläufe wurden von breiten, unregelmäßigen grünen Linien eingefasst, den riesigen, weitverzweigten Mimosenbäumen, deren Dornen so dick wie sechszöllige Nägel waren. Hier wuchsen Kakteen, hier lebten Giraffen und Nashörner. Aus der Nähe gesehen, war das Gebirge Ngong Hills riesig, abwechslungsreich und geheimnisvoll, mit langen Tälern, Dickicht und Gebüsch, grünen Hängen und steinigen Klüften. Hoch oben unter einem der Gipfel wuchs sogar ein Bambuswald. In den Bergen gab es Quellen und Wasserläufe, ich hatte mein Zelt neben ihnen aufgeschlagen. Zu meiner Zeit lebten in den Ngong-Bergen Büffel, Elenantilopen und Nashörner; sehr alte Eingeborene erinnerten sich noch daran, dass es dort Elefanten gegeben hatte, und ich bedauerte, dass nicht das gesamte Gebirge zum Wildreservat erklärt worden war. Nur in einem kleinen Bereich war das Wild geschützt, der Steinhaufen auf dem südlichen Gipfel markierte die Grenze. Wenn sich die Kolonie Kenia weiterentwickelt und die Hauptstadt Nairobi zur Großstadt heranwächst, könnte man hier einen Wildpark haben, der in der Welt einmalig wäre. Doch in den letzten Jahren meines Afrikaaufenthalts fuhren die jungen Geschäftsleute und Büroangestellten aus Nairobi mit ihren Motorrädern sonntags in die Berge und schossen auf alles, was ihnen unter die Augen kam, und ich glaube, das Großwild hat das Gebirge verlassen und sich nach Süden in den dichteren Wald und in die Felsengegenden verzogen. Das Gebirge war rau und unwegsam, wenn man jedoch den Kamm erreicht hatte, ging es sich leicht dort. Das Gras war kurz und wie geschoren, hier und da brach durch die Grünfläche das graue Gestein. Auf dem schmalen Grat, der wie eine meilenlange, geräuschlose Achterbahn über die vier Gipfel führte, verlief ein Wildwechsel. Als ich einmal mein Lager in den Bergen aufgeschlagen hatte, kletterte ich eines Morgens zu diesem Pfad hinauf und folgte ihm, und da fand ich frische Spuren und Losung einer Herde von Elenantilopen. Die großen, anmutigen, friedlichen Tiere hatten gewiss bei Sonnenaufgang den Gipfel besucht und waren dann in einer langen Reihe, eins hinter dem andern, auf dem Pfad gewandert, sie waren hergekommen, um zu beiden Seiten auf das Land hinabzuschauen - aus welchem Grund sonst? Wir bauten auf meiner Farm Kaffee an. Tatsächlich lag die Gegend für Kaffee etwas zu hoch, und die Bewirtschaftung machte große Mühe. Wir waren niemals reich. Doch eine Kaffeeplantage ist ein Unternehmen, das die Leute packt, die sich damit befassen, und sie nicht wieder loslässt. Da gibt es stets viel zu tun, ja fast immer sitzt einem die Zeit im Nacken. Inmitten der wilden Landschaft nimmt sich ein ebenmäßiges und bepflanztes Stück Land gut aus. Später, als ich über Afrika flog und meine Farm aus der Luft kennenlernte, erfüllte mich der Anblick meiner eigenen Plantage, die so ordentlich und frisch grün dalag, umgeben von Wildnis, Steppe und Urwald, immer wieder mit Bewunderung, und mir ging auf, wie sehr das menschliche Herz geometrische Figuren liebt und sich nach ihnen sehnt. Die gesamte Umgebung Nairobis, vor allem im Norden, war in der gleichen Weise bebaut; hier wohnten Leute, deren Gedanken ständig um Kaffee kreisten - wie man ihn pflanzt, beschneidet und pflückt - und die nachts nicht schlafen konnten, weil sie über Verbesserungen für ihre Kaffeeanlagen grübelten. Kaffeeanbau ist eine langwierige Arbeit. Sie ist schwieriger, als man sich vorstellt, wenn man im strömenden Regen seine Setzkästen mit glänzenden jungen Pflanzen aus der Baumschule holt und alle Arbeitskräfte der Farm auf dem Feld sind. Man achtet darauf, dass die Löcher in der feuchten Erde, in denen sie wachsen sollen, tief und gleichmäßig sind, im dichten Schatten abgebrochener Zweige aus dem Unterholz - denn Verborgenheit ist ja das Privileg junger Wesen -, doch die Hoffnungen, die man damit verbindet, erfüllen sich nicht. Es dauert drei oder vier Jahre, bis die kleinen Bäume tragen, und in der Zwischenzeit kommt Dürre über das Land, oder Pflanzenkrankheiten brechen aus, und zwischen den Kaffeebäumchen sprießt das freche einheimische Unkraut, Macdonaldia und Black-Jack, dessen lange, scharfe Samenhülsen sich in die Strümpfe bohren und wie Feuer brennen. Einige Bäumchen wurden zu nachlässig gepflanzt, so dass sich ihre Hauptwurzel verkrümmte, sie gehen kurz vor der Blüte ein. Man pflanzt auf einem Acre Land etwas mehr als sechshundert Bäume, und ich hatte sechshundert Acres mit Kaffee auf meiner Farm. Meine Ochsen zogen die Kultivatoren5 geduldig viele tausend Meilen zwischen den Baumreihen hin und her, und wir warteten auf die großen Erträge. Oft war es in der Kaffeeplantage wunderbar. Es sah prachtvoll aus, wenn zu Beginn der langen Regenzeit die Pflanzen blühten und über meinen sechshundert Acres in Nebel und Nieselregen gleichsam eine Wolke aus Kreide schwebte. Kaffeeblüten duften fein und bitter wie Schlehenblüten. Wenn das Feld überall von reifen Kaffeekirschen errötete, riefen wir Frauen und Kinder, die in der Negersprache Totos heißen, um zusammen mit den Männern die Früchte von den Bäumen zu pflücken. Wagen und Karren fuhren die Kaffeekirschen zur Aufbereitung in die Mühle am Fluss. Unsere Maschinerie war nie ganz so, wie sie sein sollte, doch wir hatten die Anlage selbst entworfen und gebaut und waren auf sie stolz. Einmal brannte sie völlig ab und musste wieder aufgebaut werden. Die große Trockentrommel drehte sich unablässig und rüttelte und schüttelte den Kaffee in ihrem schweren Eisenbauch, mit einem Geräusch, als spülten Wellen Kies und Geröll ans Ufer. Es kam vor, dass der Kaffee mitten in der Nacht fertig wurde und die Trommel geleert werden musste. Das war ein malerischer Augenblick: Stalllaternen in den großen dunklen Räumen, wo Spinnweben und Kaffeeschalen wie Festons an Decke und Wänden saßen, und im Laternenschein rund um die Trockentrommel viele glühende, eifrige Gesichter. Man hatte ein Gefühl, als hinge die Kaffeeanlage in der riesigen Tropennacht wie ein Juwel im Ohr eines Negermädchens. Danach wurde der Kaffee geschält, sortiert und in Säcke gepackt - zwölf Säcke ergaben eine Tonne -, die mit einer Sattlernadel zugenäht wurden. Endlich hörte ich in aller Herrgottsfrühe - es war noch dunkel, und ich lag im Bett -, wie sich unsere schweren Wagen, jeder mit sechzehn Ochsen bespannt und jetzt haushoch mit Kaffeesäcken beladen, pro Wagen fünf Tonnen, zum Bahnhof von Nairobi in Bewegung setzten. Rasselnd, krachend und unter dem Peitschenknallen und Rufen der Kutscher, die nebenherliefen, verließen sie die Kaffeeanlage und fuhren den langen Hügel hinauf. Ich war bei dem Gedanken froh, dass dies der einzige Hügel war, den sie auf ihrem Weg in die Stadt überwinden mussten, denn die Farm lag vierhundert Meter höher als Nairobi. Am Abend ging ich hinaus, um den zurückkehrenden Zug zu empfangen. Die müden Ochsen trotteten ganz langsam mit hängenden Köpfen vor den leeren Wagen, die müden kleinen Totos, die sie führten, waren vollkommen stumm, und die erschöpften Kutscher ließen ihre langen Peitschen im Staub des Weges schleifen. Nun hatten wir getan, was wir tun konnten. In ein paar Tagen würde der Kaffee unsrer Farm auf See sein, und dann mussten wir auf gute Preise auf den großen Londoner Märkten hoffen. Meine Farm umfasste sechstausend Acres, ich besaß also neben der Kaffeeplantage noch weit mehr Land. Ein Teil davon war Urwald, und etwa tausend Acres wurden von meinen Squattern genutzt und ihre Shambas6 genannt. Squatter sind Eingeborene, die mit ihren Familien auf dem Grundstück eines weißen Mannes einige wenige Acres für sich bewirtschaften dürfen und als Entgelt eine bestimmte Anzahl von Tagen im Jahr für ihn arbeiten müssen. Vielleicht sahen meine Squatter diese Beziehung in einem andern Licht, denn viele von ihnen, und vor ihnen ihre Väter, waren auf der Farm geboren, und es ist möglich, dass ich in ihren Augen nur ein sehr mächtiger Squatter auf ihrem eigenen Grundstück war. Auf dem Squatterland ging es viel munterer, lebendiger und bewegter zu als auf der übrigen Farm. Hier veränderte sich die ganze Landschaft mit den wechselnden Jahreszeiten. Der Mais wuchs empor - wuchs einem über den Kopf, so dass man auf den schmalen Pfaden zwischen raschelnden grünen Wänden wie eine Ameise im hohen Gras ging - und wurde danach geerntet. Die Bohnen wurden von den Frauen gepflückt und mit Flegeln gedroschen, Stängel und Hülsen wurden zusammengelesen und verbrannt, und zu manchen Zeiten des Jahres stiegen überall von den Feldern dünne blaue Rauchsäulen auf. Die Kikuyu bauten auch Süßkartoffeln an, deren weinlaubähnliche Blätter den Boden wie eine dicke, verfilzte Matte bedeckten, dazu verschiedene Arten von großen gelb- und grüngesprenkelten Kürbissen. Wo immer man durch die Shambas ging, erblickte man als erstes das Hinterteil einer kleinen alten Frau, die in der Erde kratzte und stocherte, wie ein Strauß, der den Kopf in den Sand steckt. Jede Kikuyufamilie verfügte über mehrere spitze Grashütten und ein paar kleine Vorratshütten auf Pfählen. Der Platz zwischen den Hütten war ein belebter Sammelpunkt für die ganze Familie und so hart wie Zement. Hier wurde der Mais gemahlen, die Ziegen wurden gemolken, und überall liefen Kinder und Hühner herum. Am blauen Spätnachmittag ging ich oft in die Kartoffelfelder, die sich um die Häuser der Squatter erstreckten, um Rebhühner zu schießen. Zu dieser Tageszeit gurrten die Waldtauben himmelhoch in den großen zerzausten Bäumen, die an manchen Stellen noch von jenem Urwald übriggeblieben waren, der einst das ganze Land bedeckt hatte. Ich besaß auf meiner Farm auch ein paar tausend Acres Weideland. Hier lief und floh das hohe Gras in Wellen vor dem Wind, und die kleinen Kikuyujungen hüteten die Kühe ihrer Väter. Während der kalten Jahreszeit nahmen sie von zu Hause glühende Holzkohle in Drahtkörben mit und entfachten häufig schlimme Steppenbrände, die für den Weidebetrieb der Farm verhängnisvoll waren. In jenen Jahren, als Dürre im Land herrschte, kamen große Scharen von Zebras und Gnus auf unsere Weiden. Nairobi, unsere Hauptstadt, lag zwanzig Kilometer entfernt auf einem flachen Landstrich zwischen den Bergen. Hier befanden sich das Haus des Gouverneurs und die wichtigen Regierungsämter. Von hier aus wurde das Land verwaltet. Die Nähe einer Stadt ist für unser Leben zwangsläufig von Einfluss. Dabei spielt es nicht einmal eine Rolle, ob einem diese Stadt gefällt oder nicht, sie zieht die Gedanken nach einem geistigen Gravitationsgesetz an. Der Lichternebel, der nachts am Himmel über Nairobi stand und den ich von den Wegen der Farm sehen konnte, versetzte mein Gemüt in heftige Bewegung und rief Bilder von den großen Städten Europas wach. Zu Beginn meines Aufenthalts gab es in Afrika noch keine Automobile. Wenn wir nach Nairobi wollten, ritten wir oder fuhren mit einem Wagen, vor den sechs Maultiere gespannt waren, und stellten unsere Tiere im Stall für Reisende von «The Highland Transport» unter. Nairobi war, solange ich es kannte, eine verworrene Stadt voller Widersprüche, mit einzelnen stattlichen Gebäuden aus behauenen Steinen und ausgedehnten Vierteln mit Wellblechbuden, Büros, Lagern und Wohnhäusern, alles aus Blech. An die langen, staubigen Straßen hatte man Eukalyptusbäume gepflanzt. Das Oberste Gericht, das Landdepartement, das Departement für die Angelegenheiten der Eingeborenen und das Veterinärdepartement waren allesamt jämmerlich untergebracht, und wenn ich die Beamten dort besuchte, flößte es mir Respekt ein, dass sie in diesen kleinen, glühend heißen Blechbuden überhaupt einen Gedanken fassen und irgendwie arbeiten konnten. Trotz alledem war Nairobi eine Stadt. Hier konnte man einkaufen, Neuigkeiten hören, im Restaurant essen und im Club tanzen. Und es war ein Ort voller Leben, beweglich wie ein Fluss, der sich von Jahr zu Jahr veränderte, und sich entwickelnd wie ein Kind, ja schon in der kurzen Zeit, die man auf einer Jagdexpedition verbrachte. Das neue Regierungsgebäude wurde gebaut, stolz erhob es sich über der Stadt, war geräumig und kühl, mit einem großen, prächtigen Ballsaal und einem hübsch angelegten Garten. Neue geräuschvolle Hotels wuchsen empor, große, bedeutende Tier- und Gartenausstellungen fanden statt. Die Pseudoschickeria der Kolonie erheiterte uns von Zeit zu Zeit mit einer Reihe von kurzen, stürmischen Melodramen. Nairobi sagte einem: Mach aus der Zeit und aus mir das Beste! Wir kommen nicht wieder so jung - so lebenslustig und unbesiegt - zusammen. Es gab auch eine Zeit, da fuhr ich durch seine Straßen und dachte: Die Welt ist nirgends außerhalb Nairobis. In Nairobi dehnten sich die Wohnviertel der Eingeborenen und der farbigen Einwanderer viel weiter aus als die der Europäer. Die Swahilisiedlung, die an der Straße zum «Muthaiga Club» lag, hatte in jeder Hinsicht einen schlechten Ruf und war doch eine Vorstadt voller Leben und Bewegung, in der zu allen Tagesund Nachtzeiten viele Dinge geschahen. Zum größten Teil aus alten flachgeklopften Benzinkanistern errichtet, die mehr oder weniger verrostet waren, stellte sie ein natürliches Denkmal dar, ähnlich wie Korallenriffe: die verlassenen, leeren Hüllen einer vorwärtsschreitenden Zivilisation. Die Somalistadt lag weit außerhalb des Zentrums, vermutlich weil die mohammedanischen Somali ihre Frauen von der Umwelt unbehelligt wünschten. Zu meiner Zeit gab es in Nairobi eine oder zwei schöne junge Somalifrauen, namentlich bekannt in der ganzen Stadt, die sich auf dem Basar niederließen und die Polizei lustig an der Nase herumführten. Es waren aufgeweckte, prächtige Mädchen und außerdem stolz, wie es die Somali in jeder Beziehung sind. Doch die achtbaren Somalifrauen gingen nicht auf die Straße. Die Somalistadt war allen Winden ausgesetzt, nackt, schattenlos und staubig, und muss die Bewohner an die Wüsten ihres Heimatlands erinnert haben. Europäer, die lange Zeit oder seit mehreren Generationen an ein und demselben Ort ansässig sind, gewöhnen sich nur schwer daran, wie vollkommen gleichgültig den Nomadenvölkern die nähere Umgebung ihrer Wohnung ist. Die Häuser der Somali lagen wahllos über die bloße Erde verstreut und sahen aus, als wären sie mit einem Paket vierzölliger Nägel zusammengezimmert, um eine Woche lang zu halten. Wenn man jedoch eins der Häuser betrat, überraschte es einen, wie ordentlich und fein es eingerichtet war, duftend nach arabischem Weihrauch, mit herrlichen alten Teppichen und Wandbehängen, Schalen und Gefäßen aus Messing und Silber und Schwertern mit Elfenbeinknauf und schöner Klinge. Die Somalifrauen treten mit Anstand und Würde auf, sie sind gastfrei und heiter, und ihr Gelächter klingt wie ein ganzes Glockenspiel aus purem Silber. Durch meinen Somalidiener Farah Aden, der während meines gesamten Afrikaaufenthalts in meinem Dienst stand, war ich in der Somalistadt gut bekannt und nahm dort im Laufe der Zeit an vielen ihrer Feste teil. Eine vornehme Somalihochzeit ist eine prunkvolle, ehrwürdige Festlichkeit. Ich wurde sogar in die Brautkammer geführt, deren Wände ebenso wie das Bett prächtig mit alten verblassten, zart leuchtenden Stoffen und Stickereien geschmückt waren, und die junge dunkeläugige Braut selbst war vor lauter Gold und Silber, dicker Seide und Bernstein so steif wie ein Marschallstab. Die Somali waren Viehhändler und Kaufleute und machten Geschäfte im ganzen Land. Für den Transport ihrer Waren hielten sie eine Menge kleiner grauer Esel, die, wenn sie nicht unterwegs waren, frei zwischen den Häusern herumliefen. Auch Kamele habe ich in der Somalistadt gesehen, hochmütige, abgehärtete Wüstenprodukte, die über alle irdischen Dinge erhaben waren, wie Kakteen und wie Somali. Durch ihre entsetzlichen Stammesstreitigkeiten brachten die Somali über sich selbst und andere Völker Unglück. In dieser Beziehung fühlten und dachten sie nicht wie andere Menschen. Farah gehörte zu einem Stamm, der Habr Yunis hieß, also pflegte ich für diesen Stamm Partei zu ergreifen. Einmal gab es in der Somalistadt einen großen, ernsthaften Krieg zwischen den beiden Stämmen Dulba Hantis - dem Stamm von «The mad Mullah» - und Habr Chaolo, mit Gewehrschüssen, Brandschatzung und vielen Toten auf beiden Seiten, bis sich die Regierung zum Eingreifen genötigt sah. Farah hatte zu jener Zeit einen Freund aus seinem eigenen Stamm, der Sayid hieß und ihn häufig auf der Farm besuchte. Es war ein kecker, klaräugiger junger Mann, und als ich von meinen Leuten die traurige Geschichte hörte, dass ihm während eines zufälligen Besuchs bei einer Familie des Stammes Habr Chaolo ein wütender Dulba Hantis, der gerade vorbeikam und aufs Geratewohl zwei Schüsse auf das Haus abgab, die Beine zerschmettert hatte, war ich sehr betroffen. Ich sagte Farah, dass mir das Unglück seines Freundes leidtue. «Was, Sayid?», rief er ärgerlich aus. «Das ist ihm ganz recht geschehen. Warum musste er auch im Haus eines Habr Chaolo Tee trinken!» In dem großen Geschäftsviertel der Eingeborenen, das Basar genannt wurde, regierten die Inder, und die wohlhabendsten dieser indischen Kaufleute, Jevanjee, Suleiman Virjee, Allidina Visram, wohnten in kleinen Villen gleich vor der Stadt. Sie hatten allesamt eine ausgesprochene Vorliebe für Steinmetzarbeiten, die Gärten ihrer Villen waren mit Treppen, Balustraden und Vasen aus weichem afrikanischen Gestein geschmückt - höchst mittelmäßigen Werken und den Bauten ähnlich, die Kinder aus hellroten, verzierten Steinbauklötzen errichten. Sie veranstalteten in ihren Gärten Teegesellschaften mit indischem Gebäck im Stil ihrer Villen und erwiesen sich als scharfsinnige, weitgereiste und ausnehmend höfliche Menschen. Doch als Geschäftsleute waren die Inder in Afrika derart gerissen, dass man bei ihnen nie wusste, ob man eine menschliche Persönlichkeit oder den Chef einer Firma vor sich hatte. Ich war bei Allidina Visram zum Tee gewesen, und als ich eines Tages die Fahne über dem ausgedehnten Komplex seiner Warenhäuser auf halbmast sah, fragte ich Farah: «Ist Allidina Visram gestorben?» «Halb gestorben», sagte Farah. «Flaggt man dort halbmast, weil er halbtot ist?», fragte ich. «Allidina ist tot», entgegnete Farah, «Visram lebt.» Bevor ich selbst die Leitung der Farm übernahm, hatte ich eifrig gejagt und die meiste Zeit auf Safaris verbracht, doch als ich dann Farmerin wurde, stellte ich meine Flinten in die Ecke. Die Massai, die Nomaden und Viehzüchter waren und als meine Nachbarn am anderen Flussufer wohnten, kamen von Zeit zu Zeit an mein Haus, um sich über einen Löwen zu beklagen, der ihre großen Herden verfolgte und ihre Kühe riss, und baten mich, ihn zu erlegen, und wenn ich konnte, tat ich es. Manchmal ging ich samstags auch auf die Orungi-Ebene, um für meine Leute ein oder zwei Zebras als Sonntagsmahl zu schießen, und ein ganzer Schwanz von munteren, erwartungsfrohen jungen Kikuyu folgte mir. Auf der Farm schoss ich Geflügel: Rebhühner, Wachteln und weiße Perlhühner, die sehr schmackhaft waren. Jagdexpeditionen konnte ich viele Jahre lang nicht unternehmen. Dennoch sprachen wir auf der Farm oft von unseren früheren Safaris. Lagerplätze prägen sich einem auf besondere Art ins Gedächtnis ein, als hätte man große Zeiträume dort verbracht, und manchmal denkt man noch lange an eine einzige Kurve der Wagenspur im Steppengras zurück, wie an ein Zeichen, das für das eigene Leben bedeutungsvoll war. Während einer Safari habe ich gesehen, wie eine Herde von hundertneunundzwanzig Büffeln unter einem kupferfarbenen Himmel aus dem Morgennebel tauchte, und es kam mir vor, als würden die dunklen, massigen, eisenfarbenen Tiere mit den riesigen seitwärts gebogenen Hörnern nicht heranziehen, sondern vor meinen Augen erst erschaffen und dann eins nach dem andern hinaus in die Welt gesandt. Ich habe eine Elefantenherde durch den dichten Urwald wandern sehen, wo das Sonnenlicht zwischen dicken Zweigen und Schlingpflanzen nur in kleinen Flecken und Sprenkeln hindurchsickerte, sie schritten aus, als wollten sie zu einem Stelldichein am Ende der Welt. Es war, vergrößert ins Riesenhafte, die Borte eines uralten, unermesslich kostbaren persischen Teppichs mit grünen, goldenen und schwarzbraunen Farben. Ich habe viele Male beobachtet, wie sich die Giraffen mit ihrer eigentümlichen, unvergleichlichen vegetativen Anmut über die Steppe bewegten, als wären sie nicht eine Schar von Tieren, sondern eine Familie seltener langstieliger, gefleckter Riesenblumen. Ich bin zwei Nashörnern bei ihrem Morgenspaziergang gefolgt, sie schnauften und prusteten in der klaren, kalten Luft und glichen zwei kantigen, zum Leben erwachten Felsblöcken, die sich gemeinsam im hohen Gras des Tals vergnügten. Ich habe den königlichen Löwen gesehen, wie er von seiner halbverzehrten Beute kam und unter einem kleinen abnehmenden Mond vor Sonnenaufgang über die graue Steppe heimwärts zog. Er ließ im silberglänzenden Gras einen dunklen Streifen Kielwasser hinter sich zurück, sein Gesicht war bis zu den Ohren noch rot von Blut. Und ich habe ihn auch angetroffen, als er im Schoß der Familie auf dem kurzen Rasen und im zarten, frühlingshaften Schatten der Akazien, mitten in seinem eigenen afrikanischen Lustpark, Mittagsruhe hielt. An alles dies dachte ich gern zurück und fand Trost darin, wenn die Zeiten auf der Farm schwierig waren. Das Großwild war noch in seinem eigenen Land, und wenn ich nur wollte, konnte ich ausziehen und es wieder besuchen. Farah, der im Laufe der Zeit an allen Angelegenheiten der Farm immer mehr Anteil nahm, und meine übrige alte eingeborene Mannschaft lebten in ständiger Hoffnung auf neue, künftige Safaris. In dieser Wildnis habe ich gelernt, plötzliche Bewegungen zu vermeiden. Alle Lebewesen, mit denen man hier zu tun hat, sind ungemein scheu und auf der Hut, sie besitzen eine besondere Fähigkeit, uns zu entkommen und zu entschwinden, wenn wir es am wenigsten erwarten. Kein zahmes Tier kann sich so vollkommen still verhalten wie ein wildes. Wir zivilisierten Völker haben diese Begabung eingebüßt und müssen uns von der Wildnis im Schweigen unterrichten lassen, bevor sie bereit ist, uns in sich aufzunehmen. Die Kunst, leise zu gehen, ohne schroffe Bewegungen und ohne Lärm, muss sich der Jäger, und vor allem der Jäger mit der Kamera, zuerst aneignen. Jäger dürfen nicht eigenmächtig handeln, sondern müssen Farben, Geruch und Wind einer Landschaft kennenlernen und sich dem Tempo des großen Orchesters anpassen. Manchmal spielt es einen Takt immer wieder, und darin muss man ihm dann folgen. Hat man während der Jagd den Rhythmus Afrikas in sich aufgenommen, dann erkennt man, dass er in jeder Form des Lebens hier draußen wiederkehrt. Was ich vom Wild gelernt hatte, konnte ich im Umgang mit den Eingeborenen anwenden. Liebe zu Frauen und Weiblichkeit ist eine männliche Eigenschaft, Liebe zu Männern und Männlichkeit ist eine weibliche Eigenschaft, und es gibt eine Verliebtheit in den Süden und in die südlichen Völkerschaften, die für die Nordländer kennzeichnend ist. Die Normannen müssen sich in die fremden Länder verliebt haben, zuerst in Frankreich und später in England. Die alten Mylords, die in Geschichte und Romanliteratur des achtzehnten Jahrhunderts auftreten - ewig auf Reisen in Italien, Griechenland und Spanien -, besaßen in ihrer Persönlichkeit nicht einen einzigen südländischen Zug, sondern wurden von einer Natur angezogen und verzaubert, die von ihrer eigenen in jeder Hinsicht wesensverschieden war. Als die Maler, Philosophen und Dichter aus Deutschland und Skandinavien zum ersten Mal Florenz und Rom erblickten, fielen sie in Anbetung des Südens geradezu auf die Knie. In dieser Beziehung bewiesen die ungeduldigen Nordländer eine besondere Geduld. So wie es einer Frau fast unmöglich ist, einen richtigen Mann wirklich zu ärgern, und wie ein Mann für die Frauen nie ganz verachtenswert, niemals ganz unbrauchbar wird, solange er Mann bleibt, so wurden die harten, herrschsüchtigen, leicht aufbrausenden nordischen Männer von Sanftmut erfüllt, als sie der Natur des Südens und der Südländer gegenüberstanden. Was ihr eigenes Klima und ihre eigene Familie betraf, waren sie barsch und rau, doch afrikanische Dürre, gefährliche, quälende Sonnenstiche, Rinderpest bei ihren Herden und die Unerfahrenheit ihrer eingeborenen Diener ertrugen sie mit Demut und Resignation. Sogar ihr Gefühl von Individualität ging verloren, weil sie die unendlichen Möglichkeiten im Zusammenspiel von Menschen verstanden, die gerade durch ihre Wesensunterschiede eins werden können. Den südlichen Völkern und ebenso Menschen mit sehr gemischtem Blut geht diese Eigenschaft ab. Sie tadeln oder verspotten sie, wo sie ihr begegnen, so wie Männer, die sich in besonderem Grad für Männlichkeit begeistern und selbst ein wenig zum Exhibitionismus neigen, einen schmachtenden Liebhaber verspotten, und wie sich die vernünftigen Frauen, die keine Geduld mit ihren Männern hatten, über die geduldige Griselda13 empörten. Was mich betrifft, so habe ich die Eingeborenen, die ich in Afrika antraf, vom ersten Tage an geliebt. Es war ein starkes, unbezwingbares Gefühl, das beiden Geschlechtern und jedem Alter galt. Die Begegnung mit den dunklen Leuten war für mich ein Erlebnis wie für Kolumbus die Entdeckung Amerikas und in gleicher Weise eine Erweiterung meiner gesamten Welt. Wenn man sich vorstellt, dass ein Mensch mit einem angeborenen Gefühl für Tiere in einer Umgebung ohne jedes Tier aufwächst und erst nach vielen Jahren ihre Bekanntschaft macht oder dass jemand im Alter von zwanzig Jahren zum allerersten Mal einen Wald betritt oder dass ein musikalisch veranlagter Mensch durch einen Zufall Musik erst als Erwachsener hört - dann wäre das meiner eigenen Situation vergleichbar. Als ich den Eingeborenen Afrikas begegnete, richtete ich meinen gewohnten Arbeitsablauf - was man als das tägliche Einerlei bezeichnet - für Orchester ein. Mein Vater, der als Offizier in der dänischen und der französischen Armee diente, schrieb als junger Leutnant nach Hause: «Von Graasten bis Dybbol war ich schließender Offizier einer langen Kolonne; das war nicht leicht, das war schwer; und doch: wie verlockend, wie herrlich! Die Lust am Krieg ist eine Lust wie jede andere, man liebt Soldaten, wie man junge Frauenzimmer liebt: blind, unbändig - und das eine schließt das andere nicht aus, was die Mädchen wohl wissen. Aber die Liebe zu den Mädchen hat jeweils nur Platz für eine, die zu den Soldaten umfasst die ganze Schar, die man sich immer noch größer wünscht.» Die gleiche Beziehung bestand zwischen den Eingeborenen und mir. Es war nicht leicht, die Eingeborenen kennenzulernen. Sie waren sehr hellhörig und scheu. Wenn man sie erschreckte, konnten sie sich blitzschnell in ihre eigene Welt zurückziehen, wie das Wild verschwunden und ganz einfach nicht mehr da ist, sobald wir eine plötzliche Bewegung machen. Bevor man einen Eingeborenen nicht genauer kannte, war er kaum zu einer direkten Antwort zu bewegen. Selbst auf so simple Fragen wie die, wie viele Kühe er besitze, antwortete er nur ausweichend: «So viele, wie ich dir gestern gesagt habe.» Eine solche Antwort missfiel den Europäern im höchsten Grad, vielleicht missfiel es den Eingeborenen genauso sehr, auf solche Art gefragt zu werden. Wenn wir nachhakten und sie bedrängten, um eine Erklärung aus ihnen herauszubekommen, zogen sie sich zurück, so weit wie möglich, und bedienten sich einer barocken, lustigen Phantasie, um uns in die Irre zu führen. Selbst ganz kleine Kinder verhielten sich in einer entsprechenden Situation wie alte ausgebuffte Pokerspieler, denen es ziemlich egal ist, ob der Gegenspieler ihre Karten über- oder unterschätzt, solange es ihnen nur gelingt, ihren genauen Wert vor ihm zu verbergen. Dort, wo wir tatsächlich in das Dasein der Eingeborenen einbrachen, führten sie sich wie Ameisen auf, wenn man in ihrem Haufen herumstochert. Sie besserten den Schaden mit unverdrossenem, rastlosem Eifer und vollkommen schweigend wieder aus, als müssten sie eine unschickliche Handlung auslöschen und vertuschen. Welche Gefahren es waren, die sie im Umgang mit uns befürchteten, das konnten wir nicht wissen und uns sicher nicht vorstellen. Persönlich glaube ich, dass ihre Angst vor uns eher der vor einem plötzlichen, entsetzlichen Lärm entsprach und nicht der Furcht vor Leiden, Unrecht oder Tod. Und doch - das war schwer zu entscheiden, denn die Eingeborenen waren Meister in der Kunst der Verstellung. In den Shambas oder in der Steppe sah man manchmal frühmorgens ein Rebhuhn, das plötzlich vor dem Pferd herumlief, als wären seine Flügel gebrochen oder als hätte es tödliche Angst vor den Hunden. Aber es hatte sich nichts gebrochen und fürchtete sich auch nicht vor den Hunden, es konnte direkt vor ihrer Nase aufflattern, wann immer es wollte. In Wirklichkeit verhielt es sich so, dass der Vogel irgendwo in der Nähe seine kleinen Küken hatte und mit aller Kraft versuchte, die Aufmerksamkeit von ihnen abzulenken.
| Erscheint lt. Verlag | 17.3.2010 |
|---|---|
| Nachwort | Ulrike Draesner |
| Übersetzer | Gisela Perlet |
| Sprache | deutsch |
| Original-Titel | Den afrikanske Farm |
| Maße | 135 x 215 mm |
| Gewicht | 602 g |
| Einbandart | gebunden |
| Themenwelt | Literatur |
| ISBN-10 | 3-7175-2202-7 / 3717522027 |
| ISBN-13 | 978-3-7175-2202-7 / 9783717522027 |
| Zustand | Neuware |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
aus dem Bereich