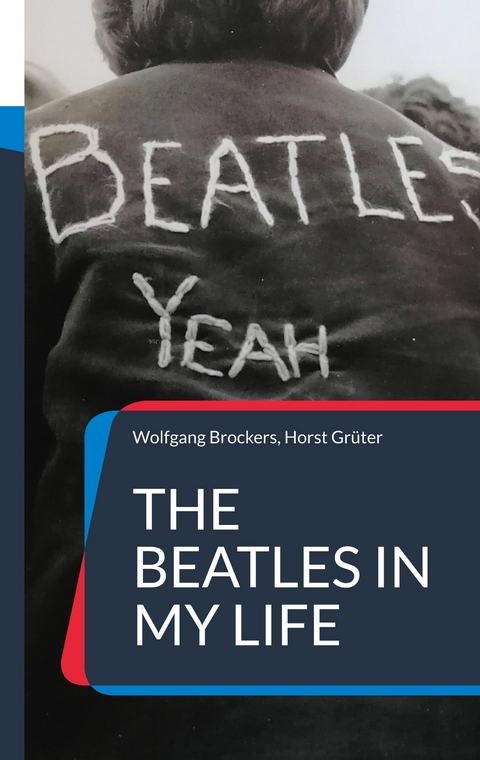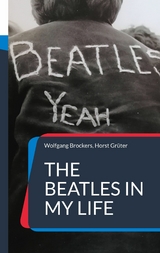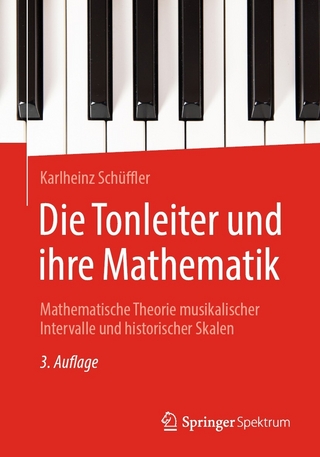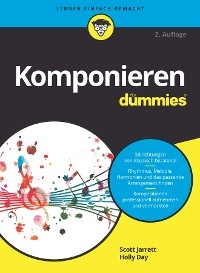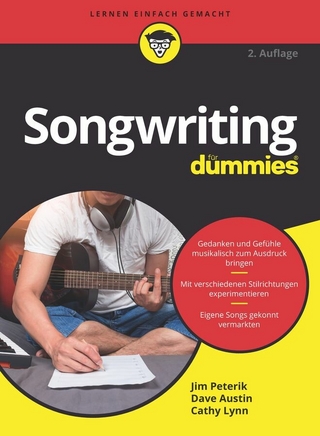The Beatles in my Life (eBook)
228 Seiten
Books on Demand (Verlag)
978-3-7583-3374-3 (ISBN)
Wolfgang Brockers, geboren 1950, studierte Geschichte, Philosophie und Sport in Neuß und Wuppertal. Von 1980 bis 2014 unterrichtete er an einem Mönchengladbacher Gymnasium. Seit den frühen 1960er Jahren ist er bekennender Beatles-Fan und setzt sich nun im vorgerückten Alter intensiv mit der Historie und kulturellen Bedeutung der Beatles auseinander.
II. Ein junger Beatles-Fan in der niederrheinischen Provinz
von Horst Grüter
1. Vor den Beatles - als die Welt noch in Ordnung war
Die Welt war noch in Ordnung zu Anfang der 60er Jahre in meiner Heimatstadt Viersen am linken Niederrhein. Die Spuren des Krieges in Form von brach liegenden Trümmergrundstücken und zugewachsenen Bunkern waren noch sichtbar und die “schlimme Zeit“ war allgegenwärtig in den Erzählungen unserer Eltern und Großeltern. Da hatten wir es als Kinder ja gut. Wenn man wie ich 1952 geboren wurde, dann musste man im Winter nicht frieren, man hatte ein warmes Bett und ein Dach über dem Kopf und immer genug zu essen. Der Garten war gleich hinter den Haus und jeden Winter wurden mindestens 5 Zentner Kartoffeln eingekellert...
Viersen war eine kreisfreie Stadt mit ca. 45.000 Einwohnern, und das Stadtbild wurde dominiert von zahlreichen Textilfabriken und natürlich von dem größten Arbeitgeber der Stadt – der Kaiser's Kaffee-Geschäft AG. Man sah, dass unsere Stadt ziemlich wohlhabend war, denn es gab viele schöne und große Häuser, die Festhalle, mehrere große Kirchen, ein eigenes Gas- und Elektrizitätswerk, einen Oberbürgermeister, einen schönen Bahnhof, einen überhaupt nicht schönen riesigen Güterbahnhof, und es verkehrten auf den Straßen beigefarbene Busse der Viersener Verkehrsgesellschaft VVG. Die Straßenbahn war mittlerweile abgeschafft, dafür gab es jetzt einen knallblauen Gelenkbus, der in die Nachbarstadt Dülken fuhr - genannt „der Lindwurm“. Jedes Jahr gab es auch zweimal eine große Kirmes und eine Sankt-Martins-Tüte für jedes Kind nach dem großen Feuerwerk – bezahlt von Kaiser's. Und es gab -sehr wichtig für uns Kinder - auch ein großes Freibad, das „Kaiser-Bad“. Wer das wohl der Stadt geschenkt hatte?
Meine Eltern waren einfache Leute mit vielen Geschwistern und einer großen Familie. Ich war allerdings ein Einzelkind, ein Nachzügler. Denn mein Vater war erst spät aus der Kriegsgefangenschaft heimgekehrt. Er arbeitete in einer großen Textilfabrik als Stoffdrucker und meine Mutter ging abends mit meiner Tante bei der Stadtsparkasse putzen. Wir wohnten in einer kleinen Mietwohnung, die der Firma, in der mein Vater arbeitete, gehörte, wie fast alle anderen Wohnungen in der Nachbarschaft. Es gab in unmittelbarer Nähe zwei Kneipen, zwei Bäcker und zwei Metzger sowie zwei Lebensmittelgeschäfte. Dort konnte man jeden Tag frisch einkaufen. Das war auch nötig, denn einen Kühlschrank hatten wir nicht. Ebenso wenig hatten wir eine Waschmaschine, einen Fernseher oder ein Badezimmer. Gebadet wurde einmal die Woche in der Zinkbadewanne. Und wenn man es ganz luxuriös haben wollte, dann ging man in die städtische Badeanstalt, ins „Stadtbad“.
Ach ja, dann war da gegenüber von unserem Haus noch die alte Lederfabrik. Die stank auch nicht schlecht, und der Bach, in den das Abwasser geleitet wurde, hatte jeden Tag eine andere Farbe und einen anderen Geruch. Darum hieß der Bach auch „Mottebäek“. Das kann man nicht so gut übersetzen, aber dieses Wort hatte keine positive Bedeutung. Viele Leute sprachen damals noch Dialekt, nämlich „Vierscher Platt“. Einige Leute konnten gar kein Hochdeutsch sprechen, oder nur, wie man sagte „mit Knubbeln“. Das war schwierig, wenn deren Kinder in die Schule kamen.
Wie gesagt – die Welt war noch in Ordnung Anfang der 60er Jahre in Viersen. Ich ging zur Volksschule, und der Schulweg führte über die Bundesstraße, die sehr stark befahren war. Da es damals natürlich noch keine A 52 gab, war diese Straße die Hauptverbindung zwischen Düsseldorf und der holländischen Grenze. Deswegen standen vor unserer Schule auch stets Schülerlotsen und hielten den Verkehr an. Das fand ich ganz toll, ich wollte auch Schülerlotse werden. Aber dafür war ich noch zu klein. Und als ich endlich alt genug war, ging ich schon zur Realschule und fuhr mit dem Bus. Denn die Realschule war in der Nachbarstadt Süchteln.
Mit Ausländern kam man in Viersen nicht erst in Berührung, als die ersten Gastarbeiter eintrafen. Denn vorher gab es schon jede Menge britische Besatzungssoldaten, die „Tommys“. Die Tommys unterhielten in Viersen mehrere Kasernen und große Lagerhallen, sogenannte „Supply Depots“. Und den ganzen Tag fuhren die olivgrünen LKW von einem Lager zum anderen, immer schön an unserem Garten vorbei zu dem dahinter befindlichen Militärgelände. Dazwischen war noch ein Spielplatz, auf dem wir manchmal Fußball spielten. Und leider flog auch schon mal ein Ball über den Zaun. Wir riefen „Tommy, Tommy“ bis uns einer hörte, und dann kam ein Soldat und schoss und den Ball zurück. Meistens jedenfalls. Eigentlich ganz nett, diese Engländer. Bei einem der Offiziere, der mit seiner Familie ein eigenes Haus bewohnte, arbeitete meine Mutter vormittags als Haushaltshilfe, und sie war dort auch sehr zufrieden. Ich war auch zufrieden, denn manchmal brachte sie mir Cadbury-Schokolade mit, und die schmeckte deutlich besser als die Schokolade von Kaiser's. Aber es gab ja zum Glück auch noch „Novesia-Goldnuss“, eine gute Alternative aus Neuss.
Natürlich wussten wir, wo England lag. Wir hatten ja schließlich den Dierke Weltatlas. Und wir wussten auch, dass es dort eine Königin gab, die schon ganz lange (nämlich seitdem ich auf der Welt war) regierte, und dass es sehr viele vornehme und adelige Leute gab. Es gab auch sehr viele arme Leute, aber das wussten wir nicht. Und besonders viele arme Leute gab es in der Gegend um Liverpool und Manchester. Die arbeiteten entweder in der Textilindustrie oder, weil Liverpool eine bedeutende Hafenstadt war, an den Docks und in den Lagerhallen. Aber auch das wussten wir nicht. Insbesondere wussten wir aber nicht, dass sich hier vier junge Männer zusammengefunden hatten, um gemeinsam Musik zu machen. Und sie machten sich auf nach Hamburg, um die Welt zu verändern. Aber das konnte damals wirklich noch niemand auch nur ahnen! Eine ungeheuer aufregende und spannende Zeit stand uns bevor. Und danach – zum Leidwesen vieler Lehrer, Kapläne, Eltern und sonstiger Erziehungsberechtigten - war nichts mehr, wie es einmal war.
Wie gesagt, die Welt war noch in Ordnung in Viersen Anfang der 60er Jahre...
2. Mein erster Auftritt
Meine musikalische Betätigung als Kind erschöpfte sich im Musikunterricht in der Volksschule und dem Singen frommer Lieder in der Kirche. Und ansonsten gab es ab und zu ja auch mal Gelegenheit zum Absingen der altbekannten Fahrten-, Wander- und Weihnachtslieder. Als Literatur standen uns Kindern das Gebetbuch, der Adventskalender sowie die Mundorgel und -nicht zu vergessen- das pädagogisch besonders wertvolle Werk „Gar fröhlich zu singen“ zur Verfügung. Vom Notenlesen und Erlernen eines Instrumentes war ich zunächst einmal meilenweit entfernt, und das obwohl mein Patenonkel, der Organist in einer katholischen Kirche war, zu Hause auf seinem Klavier fremden Kindern gegen Zahlung einer geringen Gebühr Klavierunterricht erteilte. Meine Eltern waren allerdings der Ansicht, dass es einer derartigen Bereicherung meines kulturellen Horizontes nicht bedurfte. Ich sollte lieber draußen spielen, weil ich immer so blass war.
Aber das Schicksal wollte es, dass ich den Schlager für mich entdeckte. Bereits in der Schule war ich durch ebenso lautes wie falsches Singen aufgefallen. Das brachte mir dann eine Kopfnuss vom Lehrer ein, und so habe ich hart an mir gearbeitet, um mich zu verbessern. Unentwegt trällerte ich vor mich hin, aber nicht das vom Lehrer geforderte „Hinter'm Lusen leuchtet das Eis“, sondern die Schlager, die ich mir gemerkt hatte, obwohl unser Radio nur selten lief. Doch es blieb immer etwas hängen. „Sugar, Sugar Baby“ von Peter Kraus (ich wusste nicht, dass ich schon englisch singen konnte), „Pepe“ von Willy Hagara und ähnliche Werke waren mir bereits vertraut. Auch Namen wie Katharina Valente oder Gerhard Wendland waren mir durchaus geläufig. Meinen Durchbruch hatte ich mit acht Jahren, als meine Mutter im Kreise der Familie ihren 50. Geburtstag feierte. Mit meinem Federballschläger als Ersatzgitarre bewaffnet, stand ich vor der staunenden Gästeschar und sang voller Inbrunst „Little Banjo Boy“, der neueste Hit der dänischen Boy Band „Jan und Kjeld“. Das war so wie Heintje als doppeltes Lottchen. Die beiden spielten zwar Banjo, aber das war mir noch nicht aufgefallen und deshalb egal. Ich wurde höflich mit Beifall bedacht. Die Begeisterung meiner Mutter hielt sich allerdings in Grenzen, weil ich mit meinen Schuhen auf den Tisch geklettert war, und das ging gar nicht. Die Ansage lautete: „Runter da, wir sind doch nich' in de Masuren“. Dabei waren die Schuhe ganz neu, ich hatte sie gerade drei Wochen vorher zum Geburtstag bekommen. Und ich hatte auch keine Ahnung, wer oder was die Masuren waren.
Mein Interesse an weiteren Live-Auftritten war geweckt, zumal für mich feststand, dass ich später mal Schlagersänger werde. Ich wurde dann mit der spöttischen Bemerkung bedacht: „Dann kommse in dä Fernseher, dann...
| Erscheint lt. Verlag | 6.2.2024 |
|---|---|
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Kunst / Musik / Theater ► Musik |
| Schlagworte | Beatles • Dialekt • Fans • Niederrhein • Recherchen |
| ISBN-10 | 3-7583-3374-1 / 3758333741 |
| ISBN-13 | 978-3-7583-3374-3 / 9783758333743 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 2,7 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich