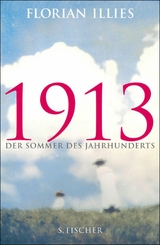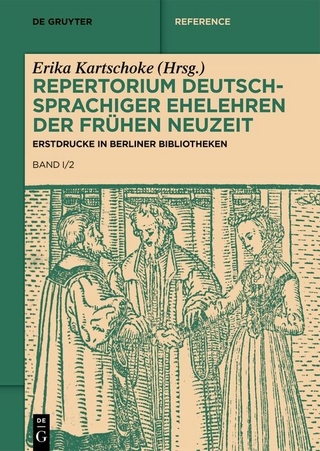1913 (eBook)
320 Seiten
S. Fischer Verlag GmbH
978-3-10-401420-3 (ISBN)
Florian Illies, der »große Geschichtenerzähler« (»Süddeutsche Zeitung«), verwandelt die Vergangenheit in seinen Büchern in lebendige Gegenwart. Er verwebt in seinem mitreißenden und humorvollen Stil kurze Miniaturen zu großen historischen Panoramen und Epochenporträts. Mit seinem Welterfolg »1913. Der Sommer des Jahrhunderts« begründete Illies ein neues Genre. Illies, geboren 1971, studierte Kunstgeschichte in Bonn und Oxford. Er war Feuilletonchef der »Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung«, leitete das Auktionshaus Grisebach und ist jetzt Mitherausgeber der »ZEIT«. Bei S. FISCHER erschien zuletzt das inzwischen in 18 Sprachen übersetzte Buch über die 1920er und 1930er Jahre »Liebe in Zeiten des Hasses«. Sein Kunst-Podcast »Augen zu« (gemeinsam mit Giovanni di Lorenzo) gehört zu den meistgehörten Podcasts deutscher Sprache.
Florian Illies, der »große Geschichtenerzähler« (»Süddeutsche Zeitung«), verwandelt die Vergangenheit in seinen Büchern in lebendige Gegenwart. Er verwebt in seinem mitreißenden und humorvollen Stil kurze Miniaturen zu großen historischen Panoramen und Epochenporträts. Mit seinem Welterfolg »1913. Der Sommer des Jahrhunderts« begründete Illies ein neues Genre. Illies, geboren 1971, studierte Kunstgeschichte in Bonn und Oxford. Er war Feuilletonchef der »Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung«, leitete das Auktionshaus Grisebach und ist jetzt Mitherausgeber der »ZEIT«. Bei S. FISCHER erschien zuletzt das inzwischen in 18 Sprachen übersetzte Buch über die 1920er und 1930er Jahre »Liebe in Zeiten des Hasses«. Sein Kunst-Podcast »Augen zu« (gemeinsam mit Giovanni di Lorenzo) gehört zu den meistgehörten Podcasts deutscher Sprache.
Florian Illies hat ein Jahrhundertbuch geschrieben.
ein Text der Freude […] so leicht und knapp kann nur einer schreiben, der über sein Material und seine Kenntnisse souverän verfügt.
Selten wurde die Frage nach dem Wirkungsgrad der Kunst auf die Gesellschaft verständlicher beantwortet als hier
Ich habe lange kein Buch so vergnügt gelesen wie dieses.
Seine Fähigkeit, Gemälde auf den anschaulichen Begriff zu bringen, sie in Worte und Metaphern zu übersetzen, ist außergewöhnlich und bereitet intellektuell-sinnliches Vergnügen.
JANUAR
Das ist der Monat, in dem sich Hitler und Stalin beim Spazierengehen im Schlosspark von Schönbrunn begegnen, Thomas Mann fast geoutet und Franz Kafka vor Liebe fast verrückt wird. Zu Sigmund Freud auf die Couch schleicht eine Katze. Es ist sehr kalt, der Schnee knirscht unter den Füßen. Else Lasker-Schüler ist total verarmt und verliebt in Gottfried Benn, bekommt eine Pferdepostkarte von Franz Marc, nennt Gabriele Münter aber eine Null. Ernst Ludwig Kirchner zeichnet die Kokotten am Potsdamer Platz. Der erste Looping wird geflogen. Aber es hilft alles nichts. Oswald Spengler arbeitet schon am »Untergang des Abendlandes«.
Es ist die erste Sekunde des Jahres 1913. Ein Schuss hallt durch die dunkle Nacht. Man hört ein kurzes Klicken, die Finger am Abzug spannen sich an, dann ein zweiter, dumpfer Schuss. Die alarmierte Polizei eilt herbei und nimmt den Schützen sofort fest. Er heißt Louis Armstrong.
Mit einem gestohlenen Revolver hatte der Zwölfjährige in New Orleans das neue Jahr begrüßen wollen. Die Polizei steckt ihn in eine Zelle und schickt ihn schon am frühen Morgen des 1. Januar in eine Besserungsanstalt, das Colored Waifs’ Home for Boys. Er führt sich dort so wild auf, dass der Leiter der Anstalt, Peter Davis, sich nicht anders zu helfen weiß, als ihm spontan eine Trompete in die Hand zu drücken (eigentlich hat er ihn ohrfeigen wollen). Louis Armstrong aber wird urplötzlich stumm, nimmt das Instrument fast zärtlich entgegen, und seine Finger, die noch in der Nacht zuvor nervös mit dem Abzug des Revolvers gespielt hatten, spüren erneut das kalte Metall, doch statt eines Schusses entlockt er der Trompete noch im Zimmer des Direktors erste warme, wilde Töne.
»Gerade der Mitternachtsschuss. Schreien auf der Gasse und der Brücke. Glockenläuten und Uhrenschlagen.« Aus Prag berichtet: Dr. Franz Kafka, Angestellter der Arbeiter-Unfall-Versicherung für das Königreich Böhmen. Sein Publikum sitzt im fernen Berlin, in der Etagenwohnung in der Immanuelkirchstraße 29, es ist nur eine Person, doch es ist für ihn die ganze Welt: Felice Bauer, fünfundzwanzig, etwas blond, etwas knochig, etwas schlaksig, Stenotypistin in der Carl Lindström A. G. Im August, es goss in Strömen, da hatten sie sich kurz kennengelernt, sie hatte nasse Füße bekommen, er sehr schnell kalte. Aber seitdem schreiben sie sich nachts, wenn ihre Familien schlafen, hochtemperierte, zauberhafte, seltsame, verstörende Briefe. Und nachmittags meist noch einen hinterher. Als Felice einmal ein paar Tage nichts von sich hören ließ, da fing er, als er aus unruhigen Träumen erwachte, verzweifelt »Die Verwandlung« an zu schreiben. Er hatte ihr von dieser Geschichte erzählt, kurz vor Weihnachten war sie fertig geworden (sie lag jetzt in seinem Sekretär, gewärmt von den beiden Fotos, die ihm Felice von sich geschickt hatte). Doch wie schnell sich ihr ferner, geliebter Franz selbst in ein schreckliches Rätsel verwandeln konnte, das erfuhr sie erst mit diesem Silvesterbrief. Ob sie ihn wohl, so fragt er aus dem Nichts, mit dem Schirm kräftig schlagen würde, wenn er einfach im Bett liegen bliebe, wenn sie sich für ein Treffen in Frankfurt am Main verabredet hätten, um nach einer Ausstellung ins Theater zu gehen, so also fragt Kafka einleitend in einem dreifachen Konjunktiv. Und dann beschwört er scheinbar harmlos ihre gemeinsame Liebe, träumt davon, dass Felices und seine Hand unlösbar zusammengebunden sind. Um dann fortzufahren: Es sei »immerhin möglich, dass einmal auf solche Weise zusammengebunden ein Paar zum Schafott geführt wurde«. Was für ein reizender Gedanke für einen Brautbrief. Man hat sich noch nicht einmal geküsst, da phantasiert der Mann schon vom gemeinsamen Gang zum Schafott. Kafka selbst scheint kurzzeitig erschrocken über das, was da aus ihm herausbricht: »Aber was läuft mir denn da alles durch den Kopf?«, schreibt er. Die Erklärung ist einfach: »Das macht die 13 in der neuen Jahreszahl.« So also beginnt 1913 in der Weltliteratur: mit einer Gewaltphantasie.
Vermisstenanzeige. Es fehlt: Leonardos »Mona Lisa«. 1911 wurde sie aus dem Louvre gestohlen, es gibt noch immer keine heiße Spur. Pablo Picasso wird von der Pariser Polizei verhört, doch er hat ein Alibi und darf wieder nach Hause gehen. Im Louvre legen die trauernden Franzosen Blumensträuße an der kahlen Wand ab.
In den ersten Januartagen, ganz genau wissen wir es nicht, kommt aus Krakau mit dem Zug ein leicht verwahrloster, vierunddreißigjähriger Russe am Wiener Nordbahnhof an. Draußen Schneegestöber. Er hinkt. Seine Haare sind in diesem Jahr noch nicht gewaschen worden, sein buschiger Schnurrbart, der sich wie wucherndes Gestrüpp unter seiner Nase ausbreitet, kann die Pockennarben im Gesicht nicht verbergen. Er trägt russische Bauernschuhe und einen vollgestopften Koffer, kaum angekommen, steigt er sofort in eine Trambahn, die ihn rausbringen soll nach Hietzing. In seinem Pass steht »Stavros Papadopoulos«, das soll nach einer griechisch-georgischen Mischung klingen, und so verwahrlost, wie er aussah, und so kalt, wie es gerade war, nahm ihm das jeder Grenzer ab. In Krakau, im anderen Exil, hatte er am Abend zuvor Lenin ein letztes Mal beim Schach besiegt, zum siebten Mal hintereinander. Das konnte er deutlich besser als Fahrradfahren. Lenin hatte verzweifelt versucht, ihm auch das beizubringen. Revolutionäre müssen schnell sein, hatte er ihm eingebläut. Doch der Mann, der eigentlich Josef Wissarionowitsch Dschugaschwili hieß und sich jetzt Stavros Papadopoulos nannte, lernte das Radfahren nicht. Kurz vor Weihnachten stürzte er übel auf den vereisten Kopfsteinpflaster-Straßen Krakaus. Sein Bein war noch voller Wunden, sein Knie verstaucht, erst seit ein paar Tagen konnte er überhaupt wieder auftreten. Mein »prächtiger Georgier« hatte Lenin ihn lächelnd genannt, als er ihm entgegengehinkt kam, um den gefälschten Pass für die Reise nach Wien entgegenzunehmen. Und nun gute Fahrt, Genosse.
Unbehelligt überquerte er die Grenzen, fieberhaft saß er im Zug über seinen Manuskripten und Büchern, die er beim Umsteigen hektisch in seinen Koffer stopfte.
Nun, in Wien angekommen, legte er den georgischen Tarnnamen ab. Vom Januar 1913 an sagte er: Mein Name ist Stalin, Josef Stalin. Als er aus der Tram gestiegen war, sah er rechts das Schloss Schönbrunn, hell erleuchtet im matten Wintergrau, dahinter den Park. Er geht in die Schönbrunner Schlossstraße 30, so stand es auf dem kleinen Zettel, den ihm Lenin gegeben hatte. Und: »Bei Trojanowski klingeln«. Also schlägt er sich den Schnee von den Schuhen, schnäuzt in sein Taschentuch und drückt etwas unsicher den Klingelknopf. Als das Hausmädchen erscheint, sagt er das verabredete Codewort.
Eine Katze schleicht sich in der Wiener Berggasse 19 in das Arbeitszimmer von Sigmund Freud, in dem sich gerade die Mittwochsgesellschaft zum Kolleg versammelt hat. Das ist die zweite Überraschungsbesucherin innerhalb kurzer Zeit: Im Spätherbst war schon Lou Andreas-Salomé zu der Herrenrunde gestoßen, erst argwöhnisch beäugt, nun schmachtend verehrt. Lou Andreas-Salomé trug an ihrem Strumpfband eine lange Reihe von Skalps erlegter Geistesgrößen: Mit Nietzsche war sie in einem Beichtstuhl im Petersdom, mit Rilke im Bett und in Russland bei Tolstoi, Frank Wedekind nannte angeblich seine »Lulu« nach ihr und Richard Strauss seine »Salomé«. Nun erlag ihr Freud zumindest intellektuell – sie durfte in diesem Winter sogar in seiner Arbeitsetage wohnen, diskutierte mit ihm sein neues Buch über »Totem und Tabu«, an dem er gerade saß, und hörte ihm zu, wenn er sein Leid klagte über C. G. Jung und die abtrünnigen Psychologen aus Zürich. Vor allem aber ließ sich die inzwischen 52-jährige Lou Andreas-Salomé, Autorin mehrerer Bücher über den Geist und die Erotik, vom Meister selbst in der Psychoanalyse ausbilden – im März dann würde sie in Göttingen ihre eigene Praxis eröffnen. So sitzt sie also im feierlichen Mittwochskolleg, neben ihr die gelehrten Kollegen, rechts die schon damals legendäre Couch und überall die kleinen Skulpturen, die der antikenversessene Freud sammelte, um sich über die Gegenwart hinwegzutrösten. Und in diese andächtige Runde huschte nun, als Lou durch die Tür trat, auch eine Katze hinein. Erst war Freud irritiert, doch als er sah, mit welcher Neugier die Katze die griechischen Vasen und römischen Kleinskulpturen musterte, da ließ er ihr gerührt etwas Milch bringen. Aber Lou Andreas-Salomé berichtet: »Dabei nahm sie jedoch von ihm trotz seiner steigenden Liebe und Bewunderung durchaus keine Notiz, richtete ihre grünen Augen mit den schiefen Pupillen kaltsinnig auf ihn wie auf einen beliebigen Gegenstand, und wenn er auch nur für einen Augenblick mehr wollte als ihr egoistisch-narzisstisches Schnurren, dann musste er den Fuß vom bequemen Liegestuhl heruntertun und mit den erfinderisch bezauberndsten Bewegungen der Stiefelspitze um ihre Aufmerksamkeit werben.« Woche für Woche erhielt die Katze fortan Zutritt zum Kolleg, als sie kränkelte, durfte sie mit Wickelkompressen auch auf Freuds Couch liegen. Sie erwies sich als therapierbar.
Apropos kränkelnd. Wo steckt eigentlich Rilke?
Die Angst, dass sich 1913 als Unglücksjahr erweisen könnte, sitzt den Zeitgenossen im Nacken. Gabriele D’Annunzio schenkt einem Freund sein »Martyrium des Heiligen Sebastian« und datiert es in der Widmung lieber vorsorglich als »1912 + 1«. Und Arnold Schönberg hält den Atem an angesichts der Unglückszahl. Nicht ohne Grund erfand er die »Zwölf-Ton-Musik« – eine...
| Erscheint lt. Verlag | 25.10.2012 |
|---|---|
| Verlagsort | Frankfurt am Main |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Kunst / Musik / Theater ► Malerei / Plastik |
| Sachbuch/Ratgeber ► Geschichte / Politik ► Allgemeines / Lexika | |
| Geschichte ► Teilgebiete der Geschichte ► Kulturgeschichte | |
| Schlagworte | 1. Weltkrieg • 20. Jahrhundert • Angst • Armstrong • Bertold Brecht • Brecht • Duchamp • Edvard Munch • Else Lasker-Schüler • Erster Weltkrieg • Europa • Felice Bauer • Florian Illies • Franz Kafka • Freud • Georg Trakl • Glück • Heimat • historisch • Hitler • James Joyce • Joyce • Kafka • Kasimir Malewitsch • Krieg • Lasker-Schüler • Louis Armstrong • Malewitsch • Marcel Duchamp • Marcel Proust • Munch • Musil • Proust • Robert Musil • Sachbuch • Sigmund Freud • Stalin • Tod • Trakl • Vergangenheit • Verzweiflung |
| ISBN-10 | 3-10-401420-5 / 3104014205 |
| ISBN-13 | 978-3-10-401420-3 / 9783104014203 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 2,5 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich