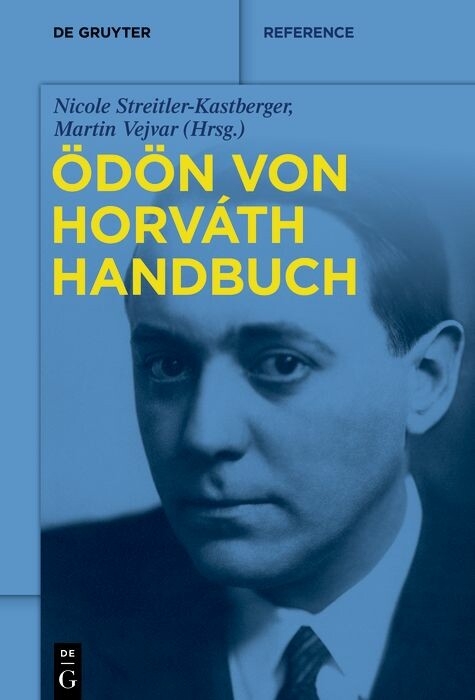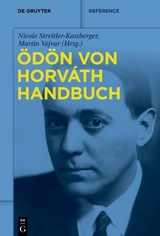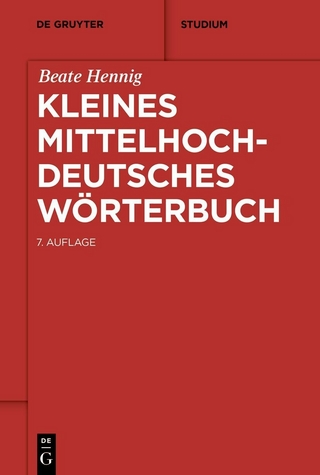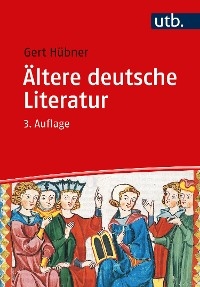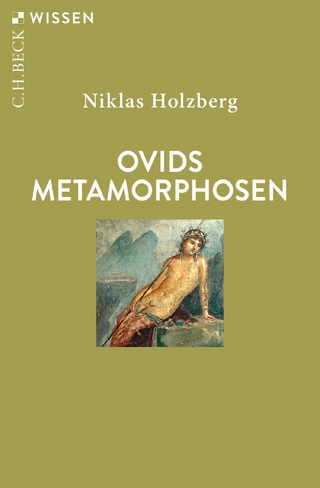Ödön-von-Horváth-Handbuch (eBook)
500 Seiten
De Gruyter (Verlag)
978-3-11-070438-9 (ISBN)
Nicole Streitler-Kastberger; Martin Vejvar, Franz-Nabl-Institut für Literaturforschung, Karl-Franzens-Universität Graz, Österreich.
1 Biographische Konstellationen
1.1 Biographie
Ödön von Horváth wurde am 9. Dezember 1901 in Fiume (heutiges Rijeka/Kroatien) geboren. Sein Vater Edmund von Horváth (1874-1950) war Ungar (geboren in Vukovar/Kroatien), seine Mutter Maria von Horváth (1882-1959) Wienerin mit böhmischen Wurzeln (geboren in Broos/Siebenbürgen). Ihr Mädchenname war Přehnal. Bereits der junge Ödön war mit Migration konfrontiert (siehe auch 2.4.1.6. Streitler-Kastberger). Sein Vater war Handelsattaché der k. u. k. Monarchie und wurde als solcher ständig auf neue Posten versetzt. So zog Horváth schon mit knapp zwei Jahren zum ersten Mal um: 1903 ging es von Fiume nach Belgrad, wo der Bruder Lajos (1903-1968) geboren wurde. 1908 übersiedelten die Horváths nach Budapest, die Söhne Ödön (Edmund) und Lajos (Ludwig) erhielten hier privaten ungarischen Sprachunterricht und besuchten die Volksschule (vgl. Krischke 1988, 7-16). 1913 zog die Familie nach München; dort kam der junge Ödön aufs Gymnasium, zuerst auf das Königliche Wilhelmsgymnasium in der Thierschstraße, dann wegen eines Ungenügend in Latein auf das Realgymnasium in der Siegfriedstraße (vgl. Krischke 1998, 23-24). Seine schulischen Leistungen waren mangelhaft, in der vierten Klasse fiel er in Deutsch durch, bei deren Wiederholung in Latein (vgl. Krischke 1998, 24). 1916 wurde Ödön allein nach Pressburg (Bratislava) geschickt, wo er bis 1918 die Staatliche Oberrealschule besuchte und bei seinem Lehrer für Latein und Französisch wohnte (vgl. Krischke 1988, 21).
Das Abitur, genau genommen die Matura, machte Horváth 1919 an einem privaten Realgymnasium in der Habsburgergasse in Wien, dem sogenannten Konzessionierten Institut Vrtel (vgl. Krischke 1988, 26). In Wien wohnte er zunächst im ersten Bezirk, in der Rathausstraße 17/6, und dann bei seinem Onkel Pepi, Joseph Přehnal, dem Bruder der Mutter, im achten Bezirk in der Piaristengasse 62, unweit der Langen Gasse, die das Vorbild abgab für die „[s]tille Straße im achten Bezirk“ (WA 3, 709) in dem Volksstück Geschichten aus dem Wiener Wald (1931) (vgl. Krischke 1988, 25-26). Dieses ist ohne Horváths Wiener Intermezzo kaum denkbar, auch wenn er zur Zeit der Entstehung des Stückes vorrangig in Berlin lebte und der inszenierte Heurigen ‚Grinzing‘ im Berliner Vergnügungstempel ‚Haus Vaterland‘ für ihn eine mindestens gleichwertige Inspirationsquelle gewesen sein dürfte. Nach der Matura zog Horváth wieder zu seiner Familie nach München (vgl. Krischke 1988, 26). 1920 wohnte er neuerlich drei Monate in Wien, und zwar in der ‚Pension Zipser‘ in der Langen Gasse 49/6 (vgl. Krischke 1988, 28): Wien ließ den jungen Horváth nicht mehr los. Die folgenden Jahre verbrachte er indes größtenteils in München, wo er von Oktober 1919 bis Februar 1922 studierte, ohne aber einen Abschluss zu erlangen. Er belegte dabei Vorlesungen und Übungen in den Fächern Philosophie, Psychologie, Theaterwissenschaften und Germanistik (vgl. Krischke 1988, 26-33; WA 18/D11-D15), insbesondere bei Artur Kutscher (1878-1960), dessen Lehrveranstaltungen auch andere bekannte Autor:innen der Zeit wie Bertolt Brecht und Marieluise Fleißer besuchten. In einem Brief an den Journalisten Paul Fent erwähnt Horváth, dass er das Studium abgebrochen habe, weil er irgendwann hätte „nicht mehr folgen“ können. Danach habe er bei einem Verlag gearbeitet und sei eineinhalb Jahre in Paris gewesen, wo es ihm „mies“ gegangen sei, was aber nicht weiter ausgeführt wird (Brief Horváths an Paul Fent, 30.11.1937, WA 18/B126). Sehr viel Zeit verbrachte Horváth in den 1920er Jahren auch in Murnau, wo die Familie erstmals 1921 zur Sommerfrische im Hotel Schönblick war und wo der Vater Edmund 1924 eine Villa in der Bahnhofstraße erbauen ließ (vgl. Krischke 1988, 31 u. 37), sodass sich der junge Autor allmählich als Bayer zu fühlen begann (vgl. Zuckmayer 1976, 210). In dieser Zeit entstanden die ersten literarischen Texte Horváths, wie Das Buch der Tänze (1922), eine Reihe lyrischer Prosaskizzen, die er auf Anregung Siegfried Kallenbergs (1867-1944) schrieb, der, glaubt man Horváths Selbstauskunft in dem autobiographischen Text „Wenn sich jemand bei mir erkundigt…“ (1931/1932), den Autor erst zu einem solchen gemacht habe (vgl. WA 17, 449). Das Buch der Tänze erschien im Münchner Schahin Verlag; möglicherweise war dies auch der Verlag, bei dem Horváth arbeitete, wie er im Brief an Fent bekräftigte. Die Pantomime oder Tanzdichtung wurde 1922 auf einem Abend des Kallenberg-Vereins gelesen und 1926 in Osnabrück szenisch aufgeführt. Da die Texte Horváths von der Kritik als Kitsch verrissen wurden, zog der Autor dieses Frühwerk zurück und kaufte mithilfe seines Vaters alle noch vorhandenen Exemplare auf (vgl. KW 11, 263-264 [Anhang]). Über diese Zeit schreibt Horváth später: „Natürlich versuchte ich es noch mit allerhand mehr oder minder bürgerlichen Berufen, aber es wurde nichts daraus - Anscheinend war ich zum Schriftsteller geboren.“ (WA 17, 449)
Die frühen Dramen dieser Zeit - Ein Epilog, Mord in der Mohrengasse (beide 1923/1924) und Niemand (1924) - stehen noch deutlich in expressionistischer Nachfolge. Mit den Sportmärchen und der verstreuten Kurzprosa der Jahre 1923/1924 wagte sich Horváth ins komische Fach und in die Nähe der Neuen Sachlichkeit, der der Autor nie wirklich angehörte, deren grenzüberschreitende „Offenheit“ (Vejvar (2014), 267) und nüchtern-sachlichen Berichtstil er jedoch für sich fruchtbar machte, auch wenn er ihn bereits in der frühen Prosa ironisch unterwanderte (siehe auch 2.1.1. Streitler-Kastberger und 2.3.3. Huber). Den Bau der Tiroler Zugspitzbahn 1926, über den die lokalen Murnauer Zeitungen ausführlich berichteten, verarbeitete Horváth 1926/1927 in seinem ersten Volksstück, Revolte auf Côte 3018, später überarbeitet zu Die Bergbahn (1927). Beide Stücke sind im Dialekt verfasst, und zwar in „Dialekte[n] des ostalpenländischen Proletariats“ (WA 1, 378). Die Uraufführung der Revolte an den Hamburger Kammerspielen war ein Misserfolg, diejenige der Bergbahn an der Volksbühne Berlin ein erster Achtungserfolg für den jungen Schriftsteller, der im Umfeld der Volksbühne, in deren Verlag auch einige der frühen Stücke als Theaterdrucke vervielfältigt wurden, eine erste schriftstellerische Heimat fand (siehe auch 1.3.3. Vejvar). Einige wichtige Theaterkritiker der Zeit wurden ebenfalls bereits auf den jungen Autor aufmerksam, so etwa Alfred Kerr, Julius Bab und Kurt Pinthus. Letzterer bemerkt beispielsweise: „Der Sproß des adeligen Diplomaten schrieb ein soziales Zeitstück, das in die Zukunft weist, auch in die Zukunft des Autors, auch in die Zukunft der Volksbühne.“ (Pinthus 1929) In dieser äußerst produktiven Schaffensphase entstanden überdies die Komödie Zur schönen Aussicht (1927), die Historie Sladek (1928/1929) und die Posse Rund um den Kongreß (1929). Sie leiteten die Phase der vier großen Volksstücke ein: Italienische Nacht (1931), Geschichten aus dem Wiener Wald, Kasimir und Karoline (1932) sowie Glaube Liebe Hoffnung (1933).
In einem 1931 in der Wiener Allgemeinen Zeitung veröffentlichten Interview bekennt Horváth: „‚Ich bin ungarischer Staatsbürger[,] […] bin aber so viel in der Welt herumgekommen, daß ich mich als Kosmopolit fühle. Seit meinem siebzehnten Lebensjahr habe ich mich für die deutsche Sprache entschieden. Mein Vater war Handelsattach[é], und durch seinen Beruf hatte ich Gelegenheit, in jungen Jahren unendlich viel zu sehen und viel zu erleben; ich lernte Belgrad, Budapest, Wien, München, Paris, Berlin, Zürich und viele andere Städte kennen.[‘]“ (Anonym 1931) Horváth war letztlich ein selbst gewählter ‚Heimatloser‘. Er lebte und arbeitete in Deutschland und Österreich, hatte aber einen ungarischen Pass. 1923 wurde ihm in einem Dokument die Zuständigkeit zum Staat Ungarn bestätigt (vgl. WA 18/D16). Immer wieder musste er nach Ungarn einreisen, um seine Staatsbürgerschaft nicht zu verlieren (vgl. auch WA 18/D22), eine Thematik, die er in seiner Posse Hin und her (1934) behandelte (siehe auch 2.4.1.6. Streitler-Kastberger). In dem autobiographischen Text Fiume, Belgrad, Budapest, Preßburg, Wien, München… (1929) beschreibt der Autor seine komplexe und hybride Identität folgendermaßen: „Ich bin eine typisch altösterreichisch-ungarische Mischung: magyarisch, kroatisch, deutsch, tschechisch - Mein Name ist magyarisch, meine Muttersprache ist deutsch. Ich spreche weitaus am besten Deutsch, schreibe nunmehr nur Deutsch, gehöre also dem deutschen Kulturkreis an, dem deutschen Volke. Allerdings: der Begriff ‚Vaterland‘, nationalistisch gefälscht, ist mir fremd. Mein Vaterland ist das Volk.“ (WA 17, 446) Seine Haltung zu dem zu der Zeit wieder aufkommenden Heimatbegriff fasst der Autor in dem autobiographischen Text so: „Ich habe keine Heimat und leide natürlich nicht darunter, sondern freue mich meiner Heimatlosigkeit, denn sie befreit mich von einer unnötigen Sentimentalität.“ (WA 17, 446; siehe auch 2.4.1.6. Streitler-Kastberger) Noch 1927 hatte...
| Erscheint lt. Verlag | 21.8.2023 |
|---|---|
| Reihe/Serie | De Gruyter Reference | De Gruyter Reference |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Geisteswissenschaften ► Sprach- / Literaturwissenschaft ► Germanistik |
| Geisteswissenschaften ► Sprach- / Literaturwissenschaft ► Literaturwissenschaft | |
| Schlagworte | Deutsch / Literatur • Exile literature • Exilliteratur • German / literature • HORVÁTH • Horváth, Ödön von • Ödön von • Theatergeschichte • Theater History |
| ISBN-10 | 3-11-070438-2 / 3110704382 |
| ISBN-13 | 978-3-11-070438-9 / 9783110704389 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 2,3 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich