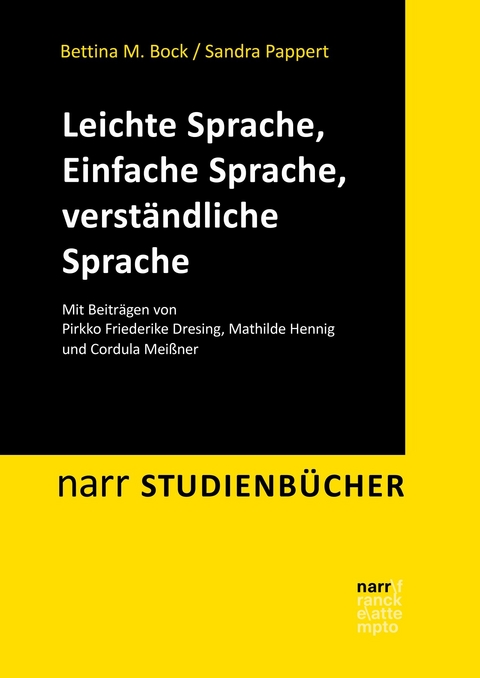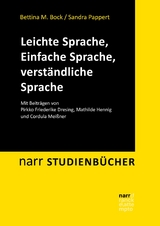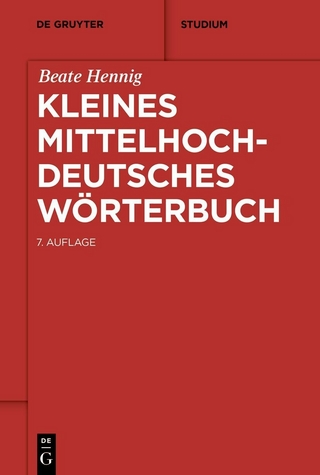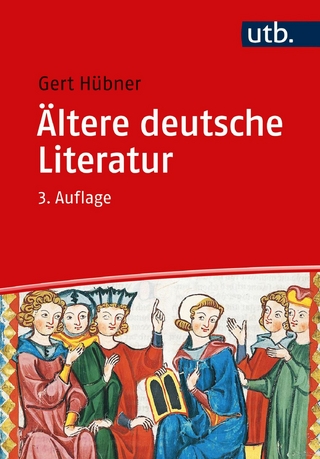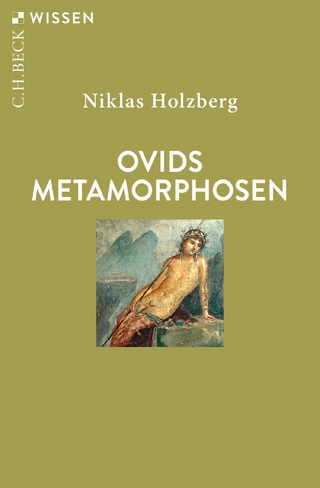Leichte Sprache, Einfache Sprache, verständliche Sprache (eBook)
298 Seiten
Narr Francke Attempto Verlag
978-3-8233-0488-3 (ISBN)
Das Buch bietet eine empirisch fundierte Einführung in Erkenntnisse zu sprachlicher Einfachheit auf Wort-, Satz- und Textebene sowie Untersuchungsergebnisse zum Lesen und Verstehen bei den wichtigsten Zielgruppen "Leichter" und "Einfacher Sprache". Es führt außerdem mithilfe von Anwendungsbeispielen in empirische Forschungsmethoden ein und berücksichtigt dabei sowohl quantitative als auch qualitative Forschungsansätze.
Prof. Dr. Bettina M. Bock ist Juniorprofessorin am Institut für deutsche Sprache und Literatur II der Universität zu Köln. PD Dr. Sandra Pappert ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Deutsch als Fremdsprachenphilologie der Universität Heidelberg.
Zur Konzeption dieses Studienbuchs
Übersicht über die Kapitel
1 Leichte Sprache? Einfache Sprache? Verständliche Sprache?
1.1 Erster Zugang zum Gegenstandsbereich
1.2 Verständliche Sprache als "Dach"
1.3 Leichte Sprache
1.4 Einfache Sprache
2 Grundlagen
2.1 Lesen und Verstehen - psycholinguistische Perspektiven
2.2 (Text-)Linguistische Perspektiven auf Verstehen und Verständlichkeit
2.3 Komplexität als Gegenstand der Linguistik (Mathilde Hennig)
2.4 Über Verständlichkeit hinaus I - Angemessenheit
2.5 Über Verständlichkeit hinaus II - diskurs- und soziolinguistische Perspektiven
3 Leicht, einfach, verständlich - Forschungsstand
3.1 Wort (Cordula Meißner)
3.2 Satz (Mathilde Hennig)
3.3 Text
3.4 Multimodalität: Typografie und Bild
4 Adressatenkreise
4.1 Menschen mit sog. geistiger Behinderung
4.2 DaF- und DaZ-Lernende (Pirkko Friederike Dresing)
4.3 Gering literalisierte Erwachsene
5 Empirische Zugänge zu Verstehen und Verständlichkeit
5.1 Überblick und Grundbegriffe
5.2 Korpusmethoden (Cordula Meißner / Bettina M. Bock)
5.3 Quantitative Zugänge zum Leseverstehen
5.4 Qualitative Zugänge zum Leseverstehen
5.5 Partizipatives Forschen
5.6 Forschungsethik
6 Desiderate
Literatur und digitale Ressourcen
| Erscheint lt. Verlag | 30.1.2023 |
|---|---|
| Reihe/Serie | narr STUDIENBÜCHER | narr STUDIENBÜCHER |
| Verlagsort | Tübingen |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Geisteswissenschaften ► Sprach- / Literaturwissenschaft ► Germanistik |
| Schlagworte | barrierefreie Kommunikation • Barrierefreiheit • DaZ/DaF • DaZ-Lernend • DaZ-Lernende • Einfache Sprache • Einfachheit • empirische Sprachforschung • Inklusion • Korpuslinguistik • Leichte Sprache • Leseverstehen • Linguistik • Menschen mit geistiger Behinderung • Psycholinguistik • Soziolinguistik • textebene • Textverständlichkeit • Verständliche Sprache • Verständlichkeit |
| ISBN-10 | 3-8233-0488-7 / 3823304887 |
| ISBN-13 | 978-3-8233-0488-3 / 9783823304883 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 6,0 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich