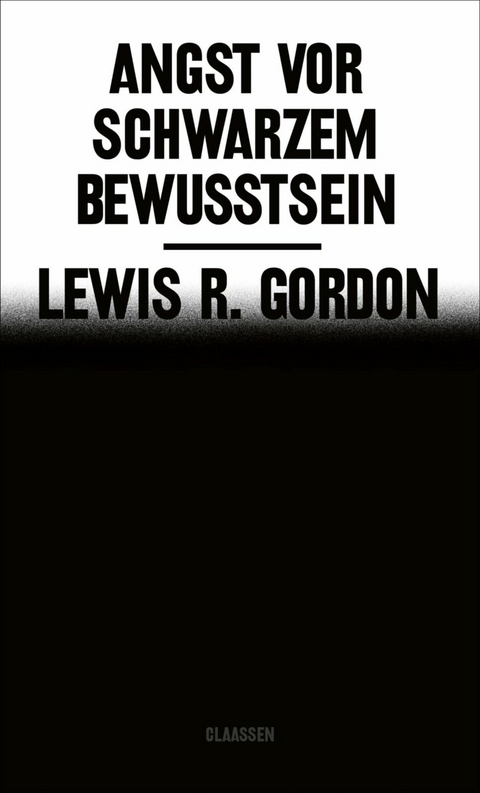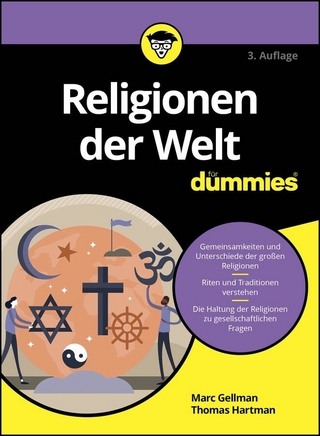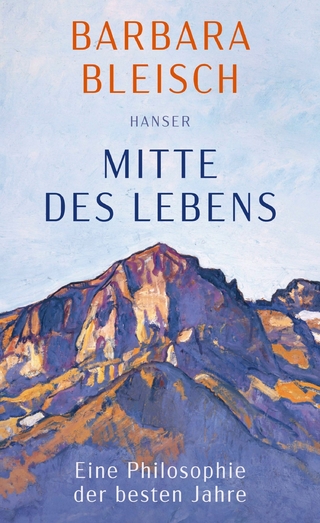Angst vor Schwarzem Bewusstsein (eBook)
304 Seiten
Ullstein (Verlag)
978-3-8437-2777-8 (ISBN)
Lewis R. Gordon ist ein afro-jüdischer amerikanischer Philosoph, politischer Denker und Musiker, spezialisiert auf afrikanische Philosophie, Existenzialismus sowie Theorien zu Postkolonialismus und Rassismus. Er ist Professor und Leiter des Philosophie-Departments an der University of Connecticut, Gastprofessor an der University of Johannesburg in Südafrika und Ehrenvorsitzender des Global Center for Advanced Studies. Für seine bisherigen Bücher erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, zuletzt erschien 2021 Freedom, Justice, and Decolonization.
Lewis R. Gordon ist ein afro-jüdischer amerikanischer Philosoph, politischer Denker und Musiker, spezialisiert auf afrikanische Philosophie, Existenzialismus sowie Theorien zu Postkolonialismus und Rassismus. Er ist Professor und Leiter des Philosophie-Departments an der University of Connecticut, Gastprofessor an der University of Johannesburg in Südafrika und Ehrenvorsitzender des Global Center for Advanced Studies. Für seine bisherigen Bücher erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, zuletzt erschien 2021 Freedom, Justice, and Decolonization.
PROLOG
Nach innen schauen
Im Angesicht von Einschränkungen
Zuweilen am Sehen scheitern
Der Blick nach innen
Wächst – vertieft sich
Implodiert
Nach innen zu sinken,
Ist der schwerste Abstieg,
Sagt uns die Physik
Da kannst du jedes schwarze Loch fragen
– natürlich nur, aus der Ferne
– GEDICHT DES AUTORS
Ich wurde nicht mit einem schwarzen Bewusstsein geboren. Ich bezweifle, dass das auf irgendwen zutrifft. Das Gleiche gilt für jedes andere rassifizierte Bewusstsein. Wir könnten eine lange Liste an Identitäten aufzählen, ohne die wir geboren werden. Doch irgendwann erlernen wir sie, und manchmal werden wir auch in sie hineingezwungen.
1962 wurde ich, nur wenige Monate vor der amtlichen Unabhängigkeit von Großbritannien, in dem Inselstaat Jamaika geboren. Das bedeutete, dass ich das Privileg hatte, eine Kindheit mit Premierministern zu erleben, die alle schwarz oder zumindest of Color waren. Dabei hatten wir Kinder keinerlei Anlass, sie auf diese Weise wahrzunehmen. Sie waren einfach nur die oberste Führung unseres Landes. Die auf unserer Währung abgedruckten Personen sahen ebenso aus, und es war nicht ungewöhnlich, dass wir einen Zahnarzt, eine Anwältin oder einen Lehrer trafen, die wie die meisten von uns aussahen. Das Gleiche traf auf Journalisten und Künstlerinnen zu, ebenso wie auf Musikproduzenten. Und obwohl wir durchaus sehr hellhäutige Menschen an den Stränden oder an touristischen Sehenswürdigkeiten sahen, verkörperten sie keine inneren Grenzen für uns. Immerhin waren »wir« in allen gesellschaftlichen Bereichen vertreten. Von der Elite über die Arbeiter:innenklasse bis hin zu den Leuten aus den Bergen oder vom Land – sie alle waren »wir«. Wir waren Jamaika. Diese selbstverständliche Form der Zugehörigkeit ist eine, die viele schwarze Menschen, die in Ländern mit mehrheitlich weißer Bevölkerung leben, nicht erfahren. Wenn ich morgens aufwachte, verfolgte ich nicht das Ziel, das Land meiner Geburt zu verlassen. Aus meiner Sicht ging es im Leben darum, Teil einer Welt zu sein, die allen, die ich kannte, vorausging und noch lange nach uns existieren würde. Wir waren, mit anderen Worten, ganz gewöhnlich.
Alle Bilder, die ich in meiner Kindheit von Autorität, Schönheit und Liebe hatte, stammten von Menschen, die im nordamerikanischen und europäischen Kontext die Grenzen zwischen rassifizierten Gruppen überschritten. Das eindrücklichste Bild von Autorität in meiner Familie war Uriah Ewan, mein Urgroßvater mütterlicherseits, den wir schlicht »Großvater« nannten. Großvater war ein über zwei Meter großer, panamaisch-liberianischer Mann in seinen Neunzigern mit dunklem Hautton. Da er den Kampf gegen das Glaukom verloren hatte, war er außerdem blind. Seine Worte waren voller Weisheit, und seine Berührungen – er musste uns mit den Fingern ertasten oder mit seinen großen Händen festhalten, um uns zu »sehen« – waren stets liebevoll und zärtlich. Andere Bilder von Autorität waren für mich meine Urgroßmutter mütterlicherseits, Beatrice Norton Ewan (»Granny Bea«), eine Jüdin irischer, schottischer und tamilischer Abstammung, meine Großmutter väterlicherseits, Gertrude Stoddart, Chinesin und Schottin, sowie meine vielen Tanten, alle ebenfalls mit unterschiedlichen Abstammungen. Das wichtigste Abbild von Schönheit war für mich meine Mutter – Yvonne Patricia Solomon, eine Frau mit dunkler Haut, die auf beiden Seiten von einer jüdischen Familie abstammte, da sich ihre mütterliche irisch-jüdische Verwandtschaft mit der palästinensisch-jüdischen väterlicherseits traf. Familie bedeutete für mich, farbenfroh zu sein. Das ist noch immer so.
Das soll nicht heißen, dass ich mir der jamaikanischen Hautfarben-Aristokratie nicht bewusst war. Da die Insel nur wenige Monate nach meiner Geburt unabhängig geworden war, blieben Spuren des britischen Kolonialismus zurück. Menschen mit einem helleren Hautton wurden als »schön«, »anständig« und »klug« bezeichnet. Dunkelhäutige Menschen wurden oft als »hässlich«, »unanständig«, »dumm« und sogar als »renk« (ein Patois-Ausdruck für stinkend) bezeichnet. Dies war mit vielen Widersprüchen verbunden, da meine dunkelhäutige Mutter überall, wo sie auftauchte, Komplimente für ihre Schönheit und ihre Intelligenz erhielt. Auch Großvater genoss bei uns hohes Ansehen, und fast jede meiner tatsächlichen Begegnungen mit Schönheit, Liebenswürdigkeit und Weisheit betraf meine Verwandten und Freund:innen mit dunklem Teint. Dennoch war es klar, dass die jamaikanische Gesellschaft hellhäutige Menschen bevorzugte. Die überwältigende Mehrheit der nicht-weißen ausgebildeten Berufstätigen war höchstens von einem Braunton oder heller. Obwohl ein Großteil der jamaikanischen Gesellschaft auf der Seite der Menschen mit hellerem Teint stand, fiel mir immer wieder auf, dass blasse Menschen nie zufrieden waren. Es gab immer etwas, das sie störte.
Ein Vorfall, bei dem dunkle Hautfarbe eine Rolle spielte, stach für mich besonders hervor. In der Grundschule, die ich mit sechs Jahren besuchte, gab es einen Jungen mit dunklem Teint. Einige ältere Kinder hänselten ihn unentwegt und nannten ihn »Paul Bogle«. Das schöne Gesicht des echten Bogle ist auf dem jamaikanischen Zwei-Dollar-Schein zu sehen. Bogle ist einer der Nationalhelden des Landes. Er wurde gehängt, weil er gegen die Briten rebellierte. Stellen Sie sich vor, ein Kind in den Vereinigten Staaten würde gehänselt, weil es Nathan Hale ähnelt, der bekanntlich bedauerte, nur ein Leben für sein Land geben zu können. Der kleine Junge hätte stolz darauf sein sollen, wie Bogle auszusehen, und die anderen hätten seine Ähnlichkeit bewundern müssen. Doch sie hänselten ihn, weil das dominierende Merkmal von Bogle für sie, genauso wie das des Jungen, der dunkle Ton seiner Haut war. Trotz dieser Beschimpfungen vertrat niemand, auch nicht seine Peiniger:innen, den Standpunkt, dass der Junge kein Jamaikaner sei oder gar einer anderen »Rasse« angehöre.
1971 verließ ich Jamaika mit der Hilfe von zwei Tanten, um wieder bei meiner Mutter zu sein, die meinen Stiefvater verlassen hatte und mit nur fünf US-Dollar nach New York City ausgewandert war. Ihre Biografie sowie die Erfahrungen ihrer drei Söhne sind mittlerweile allgemein bekannt, da die Geschichten von Migrant:innen ohne Aufenthaltserlaubnis und notleidenden Flüchtenden heute weltweit verbreitet sind. Meine Begeisterung für eine Stadt in dem Land, das oft in Filmen zu sehen ist, wurde schnell durch die Realität des Drecks, der Härte und der Gewalt in der Bronx, wo ich zwanzig Jahre lang leben sollte, gedämpft. Dort entwickelte ich ein rassifiziertes schwarzes Bewusstsein.
Meine erste Erfahrung mit schwarzem Bewusstsein machte ich in der Grundschule. Dort saß ich neben einem kleinen weißen Jungen namens Tommy. Ich ging sehr gerne in die Schule. Ich las alles und beantwortete eifrig die Fragen, die uns die Lehrerin stellte. In der zweiten Woche wandte sich Tommy an mich und fragte grinsend: »Na, wie geht’s, ›nigger‹?«
So seltsam es auch klingen mag, ich wusste nicht, was das Wort »nigger« bedeutete. Was mich misstrauisch machte, war sein Grinsen. Es war klar, dass er meine Unwissenheit ausnutzte und sie genoss. Als ich ihn fragte, was das Wort bedeutete, lachte er und weigerte sich, es mir zu erklären. Also bat ich während einer Gruppenaufgabe andere Mitschüler und Mitschülerinnen um eine Erklärung. Sie waren aus Puerto Rico mit brauner und dunklerer Haut sowie, wie man heute sagt, Afroamerikaner:innen. Ihr Gesichtsausdruck machte deutlich, dass etwas nicht stimmte. Es fiel ihnen schwer, es zu erklären, bis einer schließlich sagte: »Das ist ein übles Schimpfwort für schwarze Menschen. Es bedeutet, schmutzig, dumm – schwarz – zu sein.«
Ich ging an meinen Platz zurück.
Tommy grinste. »Na, weißt du’s jetzt, ›nigger‹?«
Ich packte ihn an der Kehle, schleuderte ihn zu Boden und trat ihm ins Gesicht. Die Lehrerin riss mich von ihm los.
Später sprach meine Lehrerin – eine große, blonde italienische Frau, die aussah, als stamme sie aus der Fernsehserie Mod Squad aus den späten 1960er-Jahren – im Büro des Direktors mit mir. Sie sagte: »Du scheinst so ein netter Junge zu sein. Das hätte ich nicht von dir erwartet.«
Ich sagte nichts.
Sie seufzte. »Bisher warst du immer so nett. Und klug. Das hätte ich wirklich nicht erwartet.«
»Warum sprechen Sie nicht mit Tommy darüber, was Sie von ihm erwarten?«, fragte ich sie.
Als wir uns nach Schulschluss alle auf den Heimweg machten, sah ich Tommy. Er war mit einer Gruppe weißer Jungen unterwegs. Er zeigte auf mich. Als sie mit geballten Fäusten auf mich zukamen, brach ich durch sie hindurch und stieß Tommy zu Boden. Als sich seine Freunde auf mich stürzten, stieß ich sie zur Seite. Tommy riss sich los und rannte davon, und ich rannte ihm hinterher. Seine Freunde standen wie erstarrt da, angesichts dessen, was für sie offenbar undenkbar war. Ich sollte bald lernen, dass der Anblick eines weißen Jungen, der vor einem schwarzen Jungen wegläuft, in diesem Teil der Bronx – und auch sonst überall in den Vereinigten Staaten – selten war. Unsere Schule lag mitten zwischen dem italienischen Viertel auf der einen und dem schwarzen und puerto-ricanischen Viertel auf der anderen Seite. Nach der Schule ging jede Gruppe getrennte Wege. Ich hatte noch nicht...
| Erscheint lt. Verlag | 27.10.2022 |
|---|---|
| Übersetzer | Dominique Haensell, Anna Jäger |
| Verlagsort | Berlin |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Geisteswissenschaften ► Religion / Theologie |
| Schlagworte | Black lives matter • Diskriminierung • Existentialismus • Frantz Fanon • Phänomenologie • Philosophie • Popkultur • Postkolonialismus • Proteste George Floyd • Proteste Rassismus • Rassismus |
| ISBN-10 | 3-8437-2777-5 / 3843727775 |
| ISBN-13 | 978-3-8437-2777-8 / 9783843727778 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 1,4 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich