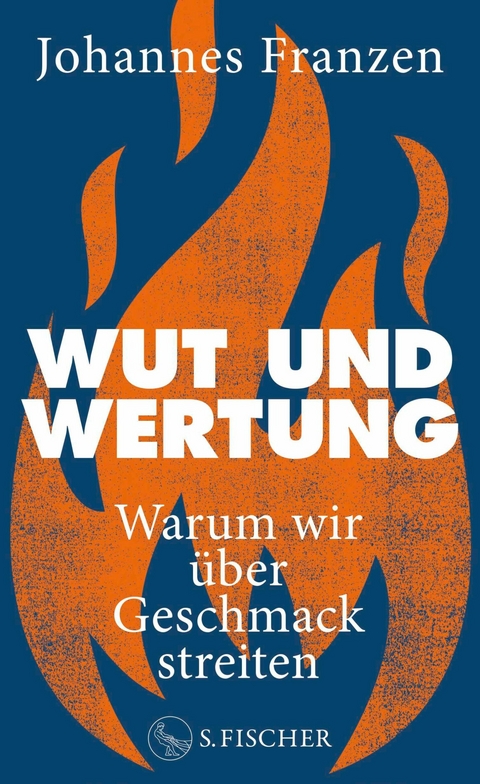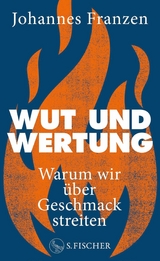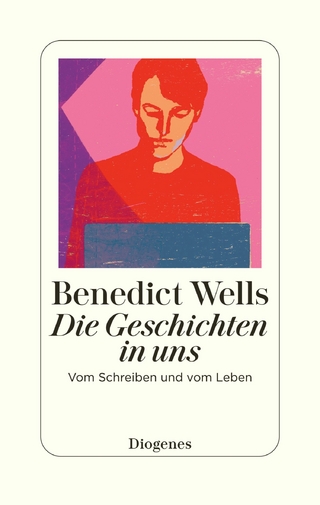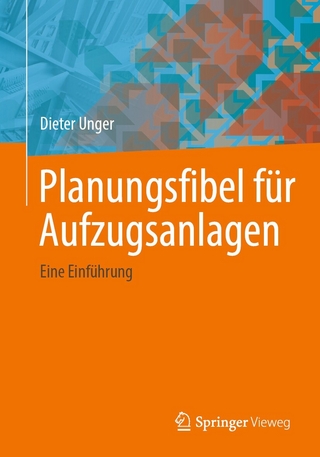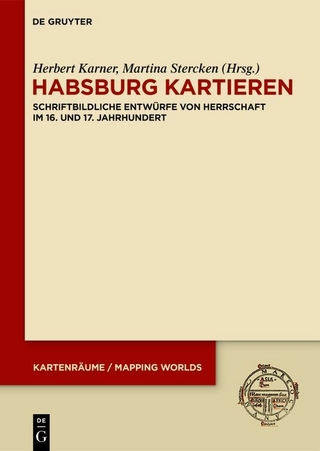Wut und Wertung (eBook)
240 Seiten
S. Fischer Verlag GmbH
978-3-10-492012-2 (ISBN)
Johannes Franzen, geboren 1984, ist Literaturwissenschaftler und Mitarbeiter am Germanistischen Institut der Universität Siegen. Er spricht und publiziert regelmäßig zu kulturellen Themen und Kontroversen u. a. im Deutschlandfunk Kultur sowie in der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung«, der »taz« und auf »ZEIT Online«. Er ist Mitbegründer und -herausgeber des Online-Feuilletons »54books« und schreibt den Newsletter »Kultur und Kontroverse«.
Johannes Franzen, geboren 1984, ist Literaturwissenschaftler und Mitarbeiter am Germanistischen Institut der Universität Siegen. Er spricht und publiziert regelmäßig zu kulturellen Themen und Kontroversen u. a. im Deutschlandfunk Kultur sowie in der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung«, der »taz« und auf »ZEIT Online«. Er ist Mitbegründer und -herausgeber des Online-Feuilletons »54books« und schreibt den Newsletter »Kultur und Kontroverse«.
Prolog – Tote und Verletzte
Am Abend des 10. Mai 1849 versammelte sich vor dem Astor-Place-Opernhaus in New York City eine aufgebrachte Menschenmasse. Es herrschte eine feindselige Stimmung. Steine wurden auf das Theater geworfen, das von Polizei und Miliz abgeriegelt worden war. Politische Scharfmacher peitschten die Menge mit Parolen auf wie: »Zündet die Bude der Aristokratie an!« Als die Protestierenden versuchten, das Theater zu stürmen, eröffnete die Miliz das Feuer. Über 20 Menschen kamen zu Tode, über 100 wurden verletzt.[1]
Man mag kaum glauben, dass der Ausgangspunkt der Unruhe ein Streit über William Shakespeare gewesen war, der sich aus der öffentlichen Rivalität zweier Schauspieler entsponnen hatte – dem Amerikaner Edwin Forrest und dem Engländer William Macready, der am Abend des Aufruhrs im Astor-Place-Theater aufgetreten war. Beide waren prominente Darsteller der Dramen Shakespeares, verkörperten allerdings sehr unterschiedliche Darstellungsstile. Während Macready einen intellektuellen, zurückgenommenen, verfeinerten Stil zum Einsatz brachte, war Forrest für seine virile, laute und ausdruckstarke Darstellung bekannt.
Aus der zunächst harmlos, ja eigentlich bedeutungslos anmutenden Geschmacksfrage (Wer ist der bessere Shakespeare-Darsteller?) entwickelte sich in der Folge ein Konflikt, in dem sich ästhetische Urteile, soziale Verwerfungen und politische Ressentiments auf eine explosive Art und Weise vermengten. Forrest inszenierte sich als genuin amerikanischer Schauspieler, als Patriot, der sich nicht nur stilistisch, sondern auch politisch von einem ›aristokratischen‹ englischen Geschmack abgrenzte. Macready dagegen wurde – auch in den USA – von einer kulturellen Oberschicht geschätzt, die ihre Überlegenheit dadurch zum Ausdruck brachte, dass sie die Subtilität seiner Figuren der polternden Theatralität Forrests vorzog.
Ob man sich für Macready oder Forrest begeistern konnte, entschied über die Zugehörigkeit zu einer sozialen Identität. Geschmack wirkte vergemeinschaftend, drängte die Zuschauer:innen in unterschiedliche Lager, die sich immer mehr verfestigten. Die Dramen Shakespeares waren zu diesem Zeitpunkt in den USA kein reines Elitenphänomen, sondern ein fester Bestandteil der klassenübergreifenden Volkskultur. Shakespeare war populär. Menschen aller Klassen besuchten die Stücke, identifizierten sich mit den Figuren, folgten den spannungsreichen Handlungen.[2]
Die Astor-Place-Unruhen bilden den Höhepunkt eines historischen Geschmackskonfliktes, der furchtbar entgleiste. Bereits der Ort selbst war umstritten. Er wurde als ein Theater der Oberschicht wahrgenommen, in dem die Mitglieder anderer Gesellschaftsschichten nicht willkommen waren. Für Unmut sorgte nicht nur das künstlerische Programm, das durch einen Schauspieler wie Macready verkörpert wurde, sondern auch die Tatsache, dass man in Abendgarderobe erscheinen musste. So entstand der (berechtigte) Eindruck, dass eine mächtige Gruppe beträchtliche Mittel einsetzt, um ihre künstlerischen Vorlieben durchzusetzen und andere davon fernzuhalten.
Für einen Teil der Stadtöffentlichkeit wirkte die ganze Institution wie ein Affront gegen den demokratischen Geist der jungen Republik. Shakespare sollte allen gehören, nicht nur einer verfeinerten Geldaristokratie, die den Zugang zu Kunst und Kultur über den Besitz weißer Handschuhe regeln wollte. In der Wut auf Macready wurden die sozialen Ressentiments und politischen Bruchlinien der amerikanischen Gesellschaft konkret. In dieser Wut kanalisierte sich ein Patriotismus, der sich in Abgrenzung zu allem Englischen vor allem auch kulturell definierte und damit auf den schwelenden geopolitischen Konflikt zwischen den beiden Mächten reagierte.
Der Fall zeigt, wie stark und effektiv sich die Emotionen, die um die Begeisterung oder Ablehnung für eine bestimmte Kunst entstehen, politisieren lassen. Vor diesem Hintergrund muss man sich die Frage stellen, ob der Konflikt überhaupt noch etwas mit Kunst zu tun hatte. War Shakespare für die Menschen, die im Mai 1849 vor dem Theater randalierten, nicht nur ein Vorwand, um ihrer Frustration Luft zu machen? Hatte sich das politische Ereignis in diesem Moment nicht schon längst von jeder Diskussion über künstlerische Qualität gelöst? War hier nicht schlicht ein Mob am Werk, der sich von zynischen Demagogen hatte aufhetzen lassen? Die Fragen verweisen auf eine grundsätzliche Kontroverse darüber, wessen Urteil über Kunst überhaupt legitim ist. Es war ja gerade der Vorwurf mangelnder Kennerschaft gewesen, der die Gegner des Astor-Place-Publikums zur Weißglut gebracht hatte.
In diesem Buch will ich der Wut nachspüren, die mit einer ästhetischen Meinungsverschiedenheit beginnt und mit Toten und Verletzten enden kann. Es geht im Wesentlichen um die Frage, warum wir über Geschmack streiten – über die Frage, was gute und was schlechte Kunst ist – und warum dieser Streit so heftig eskalieren kann. Nicht jede Auseinandersetzung über Kunst und Kultur endet so blutig wie die Astor-Place-Unruhen. Das Ereignis zeigt aber, wie groß das Verletzungspotential ist, das darin liegt, dass Menschen bestimmte Vorlieben haben, bestimmte Kunstwerke anderen vorziehen. Dieses Verletzungspotential ist dafür verantwortlich, dass die Kulturgeschichte eine Geschichte von Skandalen und Kontroversen, von Fehden, Streitereien und Rivalitäten darstellt.
Dieses Buch handelt davon, wie Konflikte über Kunst entstehen und welche Funktion sie einnehmen – vor allem in unserer Gegenwart. Ich werde die kulturellen Orte besichtigen, wo sich diese Konflikte abspielen. Dazu gehören die Kulturteile etablierter Zeitungen genauso wie die Kommentarspalten unter Videos im Internet; der Streit um ein Gedicht oder ein klassischer Kunstskandal um erotische Gemälde, aber eben auch die kollektive Wut der Fans über das Verhalten einer Autorin in den Sozialen Medien. Gerade dort, wo sich Meinungen ineinander verhaken, wo unterschiedliche Welten der ästhetischen Wertung aufeinanderstoßen, explodieren diese Konflikte besonders eindrucksvoll.
Die Kapitel in diesem Buch bauen aufeinander auf und beziehen sich aufeinander, allerdings können sie auch einzeln gelesen werden, als Studien über Aspekte des Geschmacks, die eine besondere Volatilität besitzen. Gemeinsam bieten sie einen Streifzug durch die Konfliktzonen der Gegenwartskultur. Irritation entsteht schon bei der grundsätzlichen Frage, was Kunst überhaupt sein darf. Der Respekt, zu dem das moderne Kunstparadigma die Menschen erzogen hat, führt dazu, dass ausgerechnet die Frage nach unseren persönlichen Vorlieben unter starkem gesellschaftlichem Druck steht. Was dürfen wir überhaupt lesen, hören, anschauen? Und woher kommt die kulturelle Hierarchie, die uns die Hochkultur aufdrängen und den Massengeschmack, der hedonistischen Bedürfnissen folgt, abtrainieren möchte (Kapitel 2)?
Diese Fragen haben gerade im Verlauf der letzten Jahrzehnte an Bedeutung gewonnen. Wir erleben die unmittelbaren Auswirkungen der digitalen Medienrevolution in allen Bereichen unseres Alltagslebens. Dazu gehört – vielleicht in besonderer Weise – auch, wie wir Musik, Literatur, Filme etc. auswählen und bewerten. Die Digitalisierung hat einen ungeheuren Schub an Teilhabe freigesetzt, der eine Emanzipation des Publikums zur Folge hatte – eine Entwicklung, die, wie ich zeigen werde, auch ihre dunklen Seiten haben kann, wenn etwa wütende Fans über Kritiker:innen herfallen oder wenn riesige Wertungsgemeinschaften in einer organisierten Form ästhetischer Feindschaft aufeinander losgehen (Kapitel 3).
Die negativen Emotionen, die wir in Bezug auf die Kunst anderer Menschen entwickeln können, sind ein wichtiger Motor der Kultur. Ärger über grässliche Musik, Ekel vor kitschigen Bildern, Enttäuschung über schlechte Romane – all das sind Gefühle, die genauso produktiv sein können wie Begeisterung. Die Frage, die man sich stellen muss, lautet: Woher kommt der Hass auf schlechte Kunst? Warum können wir Geschmack, der von unserem abweicht, nicht einfach ignorieren oder tolerieren (Kapitel 4)? Stattdessen sind wir oft regelrecht besessen vom ästhetischen Versagen der anderen, machen einen Volkssport daraus, uns darüber lustig zu machen, wenn ein besonders misslungener Song oder ein besonders inkompetenter Film ins Licht der Öffentlichkeit gerückt wird (Kapitel 5).
Dieses Verhalten stellt ein Rätsel dar, dessen Lösung man näherkommt, wenn man sich mit den Mechanismen beschäftigt, die Druck auf unseren Geschmack ausüben. Bereits in der Schule wird man zu Lektüren gezwungen, auf die man eigentlich keine Lust hat. So kann ein Roman wie Effi Briest, der Generationen von Schüler:innen mit Langeweile erfüllt, zum Inbegriff einer quälenden Pflichtrezeption werden. Das Internet bietet mittlerweile allerdings auch einen Ort, wo sich die Opfer dieser Zwangslektüre gegen den herrschenden Kanon zur Wehr setzen können (Kapitel 6). Dabei lassen sich eigentümliche Phänomene beobachten. Ausgerechnet Lyrik scheint Menschen besonders wütend zu machen, wie mehrere Fälle zeigen, in denen Gedichte und Autor:innen aufs heftigste beschimpft wurden. Eine Frage, die ich in diesem Buch beantworten möchte, ist: Warum lassen wir uns von so etwas scheinbar Harmlosem wie einem Gedicht demütigen (Kapitel 7)?
Konflikte über Kunst und Kultur sind eminent politisch – ein ständiger Schauplatz gesellschaftlicher Konflikte darüber, was gesagt und gezeigt werden darf. Gerade in den letzten Jahren wurde...
| Erscheint lt. Verlag | 9.10.2024 |
|---|---|
| Verlagsort | Frankfurt am Main |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Kunst / Musik / Theater ► Malerei / Plastik |
| Schlagworte | Ästhetische Urteile • Effi Briest • J.K. Rowling • Kevin Spacey • Klassiker lesen • Literatur-Kanon • Literaturkritik • Madame Bovary • Michael Jackson • Pflichtrezeption • problematische Kunst • Rezeption von Schullektüre • Skandalforschung • Streitkultur • Till Lindemann • Wertungskulturen |
| ISBN-10 | 3-10-492012-5 / 3104920125 |
| ISBN-13 | 978-3-10-492012-2 / 9783104920122 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 6,3 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich