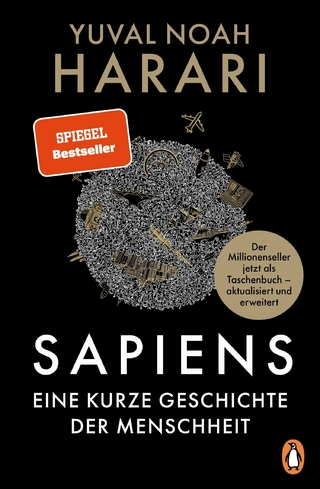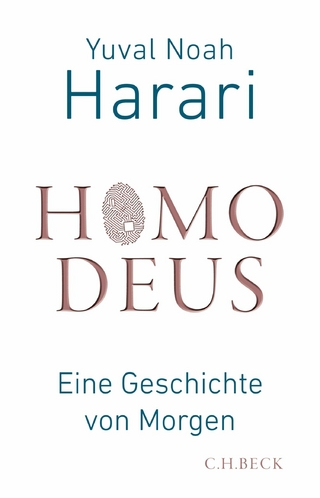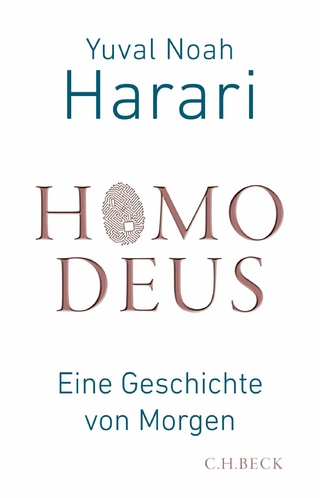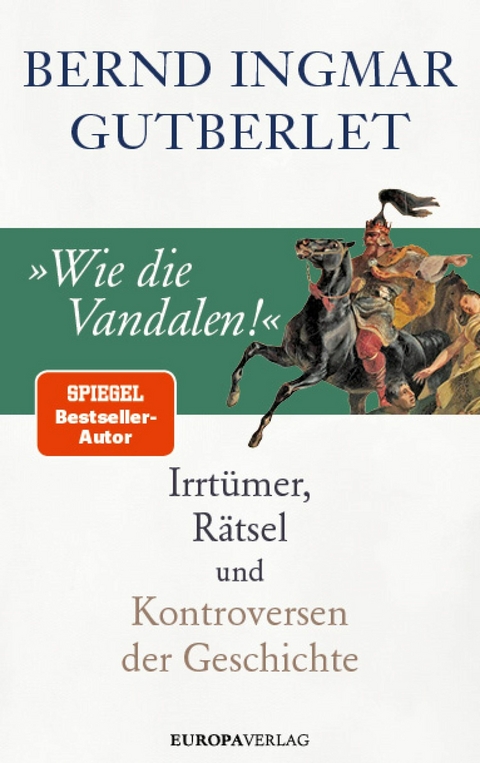
»Wie die Vandalen!« (eBook)
264 Seiten
Europa Verlag GmbH & Co. KG
978-3-95890-501-6 (ISBN)
Bernd Ingmar Gutberlet, geb. 1966, ist Historiker. Er studierte in Berlin und Budapest und arbeitet heute als Publizist in Berlin. In vielen Büchern vermittelt er zwischen Wissenschaft und 'interessierten Laien', weil er findet, dass fundierte Recherche und komplexe Zusammenhänge nicht auf Kosten der Verständlichkeit und des Lesevergnügens gehen müssen. Neben seiner publizistischen Tätigkeit macht Gutberlet außerdem als Stadtführer in Berlin Geschichte zugänglich - so mit seiner Berlin Pandemie-Tour. www.berlinfirsthand.de
Bernd Ingmar Gutberlet, geb. 1966, ist Historiker. Er studierte in Berlin und Budapest und arbeitet heute als Publizist in Berlin. In vielen Büchern vermittelt er zwischen Wissenschaft und "interessierten Laien", weil er findet, dass fundierte Recherche und komplexe Zusammenhänge nicht auf Kosten der Verständlichkeit und des Lesevergnügens gehen müssen. Neben seiner publizistischen Tätigkeit macht Gutberlet außerdem als Stadtführer in Berlin Geschichte zugänglich – so mit seiner Berlin Pandemie-Tour. www.berlinfirsthand.de
Zuflucht in der heiligen Stadt
Auch die Anhänger des Christentums waren im alten Rom alles andere als privilegiert, bevor Kaiser Konstantin im 4. Jahrhundert die obskure Sekte zur Staatsreligion erhob. Diese Frühzeit des Christentums konnte trotz intensivster Forschungsbemühungen bisher nicht lückenlos erforscht werden. Eine aufstrebende Religion in ihren Anfängen, die noch nicht recht ernst genommen wird, konspirativ tätig ist und Verfolgungen zu gewärtigen hat, hinterlässt naturgemäß weniger Spuren als die Institution, die später in die Sphären der Macht aufstieg. Das gilt noch viel mehr für die riesige antike Metropole Rom, auch wenn sie als mutmaßlicher Wirkungs- und Todesort der Märtyrer-Apostel Petrus und Paulus sehr bald eine Sonderstellung in der jungen Christenheit erlangte und ihre Bischöfe zu einer Autorität im Streit um Glaubensinhalte wurden. Daher muss man sich eigentlich nicht wundern, dass die frühesten archäologischen Beweise zur Präsenz des Christentums in Rom erst aus dem späten 2. Jahrhundert stammen. Unser Wissen von einer zu diesem Zeitpunkt in der Hauptstadt längst bestehenden frühchristlichen Gemeinde, die bereits eine Organisationsstruktur aufgebaut hatte, stammt aus schriftlichen Quellen. Aber wo sich die ersten römischen Christen zu Gottesdiensten und Versammlungen trafen, ist unbekannt. Bestattet wurden sie zunächst wie ihre heidnischen Mitbürger auf den städtischen Friedhöfen; rein christliche oberirdische Friedhöfe wurden seit dem 3. Jahrhundert eingerichtet, aber diese Begräbnispraxis stieß mit steigender Zahl von Gläubigen an ihre Grenzen, da die Christen Einäscherung strikt ablehnten.
Zu den ältesten Bauwerken der römischen Christen gehören die Katakomben, die wohl seit dem 2. Jahrhundert eingerichtet wurden, während jüdische Katakomben schon früher belegt sind. Die christlichen Katakomben sind überaus faszinierende Zeugnisse des frühen Glaubens und in ihrer Schlichtheit und Enge höchst authentisch. Im Bewusstsein der ganz nahen Überreste von Menschen, die sich vor mehr als anderthalb Jahrtausenden von einer noch jungen Religion begeistern ließen, spürt man unwillkürlich in Gedanken der Frühzeit des Christentums nach, das hier eine Präsenz beweist, die so manches Oberirdische der inzwischen altehrwürdigen Religion in den Schatten stellt. Das unterstützt die populäre Auffassung, die Katakomben seien geheime Versammlungsorte einer unterdrückten Minderheit gewesen. In der Zeit der Christenverfolgungen seit Kaiser Nero bis Ende des 3. Jahrhunderts seien sie dafür angelegt und später aufgegeben worden, als die Verfolgungen ein Ende gefunden hatten und die Verstecke nicht mehr gebraucht wurden. Doch bei dieser verbreiteten Annahme handelt es sich um einen Irrtum. Tatsächlich dienten die Katakomben als Begräbnisorte. Die alte lateinische Bezeichnung coemeterium, die sich in vielen Sprachen bis heute als Bezeichnung für Friedhof gehalten hat, bezog sich auch auf diese unterirdischen Nekropolen. Der Begriff Katakombe stammt von der Ortsbezeichnung der ersten wiederentdeckten, aber keineswegs ältesten Grabganganlage Roms, die im 16. Jahrhundert freigelegt wurde: ad catacumbas, in der Senke. Zur Wallfahrtskirche San Sebastiano fuori le mura gehörig und rund drei Kilometer vor der antiken Stadtgrenze gelegen, sind diese namensgebenden Gräbersysteme heute als Sebastians-Katakomben bekannt.
Eine der ersten von Christen genutzten Katakomben ist die 1849 wiederentdeckte Calixtus-Katakombe unter der Via Appia vor der antiken Stadt auf dem heutigen Anwesen eines Klosters. Papst Calixtus I., zuvor Beauftragter der römischen Gemeinde für diesen Begräbnisort, ließ sie nach seiner Wahl im Jahr 217 erweitern. Oberirdisch bestand die Via Appia wie andere Ausfallstraßen aus einer endlosen Reihe von Gräbern, denn auf dem Stadtgebiet des antiken Rom war die Bestattung von Toten nicht erlaubt. Mit dem Übergang von Feuer- zu Erdbestattung im 2. Jahrhundert n. Chr. kam es zu einem Platzproblem, auch für die wachsende Zahl der Christen. Der Umfang der römischen Gemeinde wird für die Mitte des 3. Jahrhunderts auf bis zu 50000 Mitglieder geschätzt.
Das poröse Gestein der Gegend um Rom ermöglichte die Anlage eines ganzen Netzes unterirdischer Gänge. Die Calixtus-Katakombe wurde als rechtwinkliges Raster mit fünf Ebenen planmäßig auf Erweiterung angelegt. Die Hauptgänge, zu denen der Zugang von oben erfolgt, sind mit kleinen Quergängen untereinander verbunden. Insgesamt kommt das Gängenetz auf eine Gesamtlänge von mehr als zehn Kilometern. In die Gänge wurden seitlich sogenannte loculi gehauen, kleine Einzelgräber individueller Größe, die die Verstorbenen aufnahmen. Die Gräber wurden übereinander angeordnet und mit Ziegeln oder Marmorplatten verschlossen. Deren Ausführung zeigt große Unterschiede: Neben aufwendigen Gräbern betuchter Christen befinden sich hier schmucklose Begräbnisstätten von Armen, die sich nur ein bescheidenes Ruheplätzchen und die Ziegel für den Grabverschluss leisten konnten, wenn die Kosten nicht ganz von der Gemeinde getragen wurden. Die 1854 entdeckte Krypta der Calixtus-Katakombe diente auch als Grablege von neun Päpsten und verschiedenen Heiligen, und ihre Fresken gehören zu den frühesten Zeugnissen christlicher Bildkunst überhaupt: Biblische Themen, Darstellungen von Wundern, von religiösen Riten und Handlungen wie der Eucharistiefeier finden sich hier abgebildet. Die Wandmalereien erzählen viel über die Glaubenswelt der frühen Christen, vor allem ihre Hoffnungen auf ein erquickliches Jenseits sprechen daraus. Wegen ihrer regalweisen Aufbewahrung der Toten bezeichnete der Kirchenhistoriker Wilhelm Gessel die Katakomben als »gewaltige Lagerhallen zur Bereitstellung der Toten auf den Tag der allgemeinen Auferstehung«. Aufgrund des provisorischen Charakters als nur vorübergehende Unterbringung wurden die meisten Gräber achtlos und in aller Eile verschlossen.
Die christlichen Bestattungen in Katakomben begannen im 2. Jahrhundert und erreichten ihren Höhepunkt im 4. und 5. Jahrhundert; die letzte datierte Grabinschrift stammt aus dem Jahr 535 und findet sich in den Sebastians-Katakomben. Mit dem Märtyrerkult wurde seit dem 4. Jahrhundert die Bestattung in der Nähe von Märtyrergrablegen immer beliebter, wovon die Katakomben reiches Zeugnis ablegen. Die Gedenktage der Glaubenszeugen wurden festlich begangen, und man hielt in den engen Katakomben auch kleinere Feiern ab. Für größere Veranstaltungen aber waren die Gänge viel zu eng – und gänzlich unbrauchbar waren sie als Versteck. Denn wegen der wenigen Zugänge und weil die Lage der Katakomben kein Geheimnis war, hätten die Verfolger mit den dort Zuflucht suchenden Christen ein leichtes Spiel gehabt. Für einen geeigneten Zufluchtsort befanden sich die Katakomben außerdem viel zu weit außerhalb der Stadt. Auch die Chronologie entlarvt die Geschichte von den Katakomben als Zufluchtsstätten bedrängter Christen als falsch. Denn die meisten Bestattungen stammen aus der Zeit nach dem Ende der Verfolgungen, nachdem Kaiser Konstantin im Jahr 313 in der Mailänder Vereinbarung Religionsfreiheit gewährte.
Um 500 n. Chr. ging man mehr und mehr dazu über, die Toten auf Friedhöfen und in Kirchen beizusetzen, was die Blütezeit der Katakomben beendete. Die Katakomben dienten aber nach wie vor als Wallfahrtsstätten und tauchten in Romführern des Mittelalters noch lange als Attraktionen auf – man konnte sie also wohl weiterhin besuchen. Ihre Anziehungskraft für die Pilger nahm allerdings seit dem 9. Jahrhundert stetig ab, weil immer mehr Heiligenreliquien aus ihnen in oberirdische Kirchen verlegt wurden, sei es in Rom oder an anderen Orten der Christenheit. Wer also die Gebeine eines geschätzten Heiligen zum Gebet aufsuchen wollte, musste dafür immer seltener in den Untergrund hinabsteigen. Ganz aufgegeben und dann vergessen wurden sie vermutlich in der Zeit des Papsttums von Avignon im 14. Jahrhundert, der sogenannten babylonischen Gefangenschaft der Päpste unter den französischen Königen. Damals erlebte das religiöse Leben in der Ewigen Stadt seinen Tiefstand. Aber da waren auch nur noch eine Handvoll der römischen Katakomben überhaupt zugänglich. Größere Aufmerksamkeit zogen sie erstmals mehr als ein Jahrhundert später wieder auf sich und dann verstärkt durch das Interesse der Gegenreformation an den Wurzeln des Christentums. 1788 unternahm Goethe einen Besuch, sprach in seiner Italienischen Reise allerdings missvergnügt von »dumpfigen Räumen«, die er sogleich wieder verließ. Auch Stendhal und Charles Dickens schrieben darüber, aber wissenschaftlich umfassend und systematisch erforscht werden sie erst seit Mitte des 19. Jahrhunderts.
Die Geschichte von den Katakomben als Zufluchtsorte bedrängter Christen, die sich darin vor den gewaltsamen Verfolgungen in Sicherheit...
| Erscheint lt. Verlag | 19.10.2023 |
|---|---|
| Verlagsort | München |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Geschichte / Politik |
| Schlagworte | Adolf Hitler • Fake News • Geschichte • Geschichtsfälschung • Geschichtsklitterung • Gesunde Skepsis • Historiker • historische Wahrheit • irrtümern • kollektiven Gedächtnisses • Kontroversen • Landeskultur • Manipulation • Marco Polo • Maya-Kalender • Mongolen • Populäre Fälschungen • Populäre Verleumdungen • Quellenlage • Seidenstraße • Spanien • Vandalen • Verleumdung • Verzerrung der Wahrheit • Völkerwanderung |
| ISBN-10 | 3-95890-501-3 / 3958905013 |
| ISBN-13 | 978-3-95890-501-6 / 9783958905016 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 1,6 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.