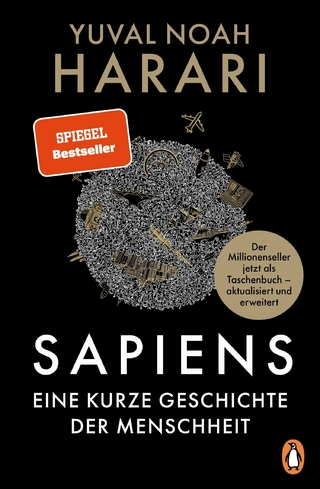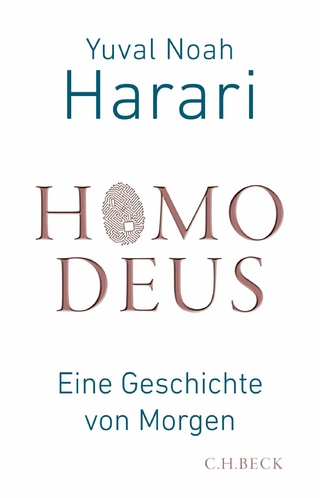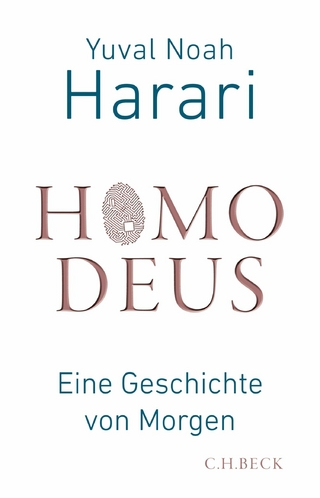»Sollen sie doch Kuchen essen« (eBook)
304 Seiten
Europa Verlag GmbH & Co. KG
978-3-95890-499-6 (ISBN)
Bernd Ingmar Gutberlet, geb. 1966, ist Historiker. Er studierte in Berlin und Budapest und arbeitet heute als Publizist in Berlin. In vielen Büchern vermittelte er zwischen Wissenschaft und 'interessierten Laien', weil er findet, dass fundierte Recherche und komplexe Zusammenhänge nicht auf Kosten der Verständlichkeit und des Lesevergnügens gehen müssen. Neben seiner publizistischen Tätigkeit macht Gutberlet außerdem als Stadtführer in Berlin Geschichte zugänglich.
Bernd Ingmar Gutberlet, geb. 1966, ist Historiker. Er studierte in Berlin und Budapest und arbeitet heute als Publizist in Berlin. In vielen Büchern vermittelte er zwischen Wissenschaft und "interessierten Laien", weil er findet, dass fundierte Recherche und komplexe Zusammenhänge nicht auf Kosten der Verständlichkeit und des Lesevergnügens gehen müssen. Neben seiner publizistischen Tätigkeit macht Gutberlet außerdem als Stadtführer in Berlin Geschichte zugänglich.
Untergang auf Raten
Man kann sich einen schlechteren Ausgangspunkt denken für einen Spaziergang durch zweieinhalb Jahrtausende voller Fälschungen, Verleumdungen und Verschwörungsmythen als die Mutter aller Universalbibliotheken, denn schließlich dienen Bibliotheken als Wissensspeicher, und die Menschheit verwahrt hier seit mehreren Tausend Jahren Wissen und Kultur. Man kann in ihnen der Vergangenheit nachgehen und natürlich auch dem, wo die Überlieferung der Geschichte fehlerhaft ist. Die Zahl der Bibliotheken ist riesig, ihr Bau und ihr Unterhalt sind nicht selten auch eine Frage des Prestiges.
Zu Anfang des 21. Jahrhunderts wurde in Ägypten mit großem Pomp und als PR-Aktion des Staates eine Bibliothek »wiedereröffnet«, die trotz ihres Untergangs vor vielen Jahrhunderten zu den bekanntesten der Welt gehört und als die wichtigste der Antike gilt: die Bibliothek von Alexandria. Über das traurige Schicksal der antiken Bibliothek gibt es verschiedene Versionen: Mal soll sie 48/47 v. Chr. im Alexandrinischen Krieg zerstört worden sein, als Julius Cäsar im Hafen der Stadt die Schiffe der ägyptischen Flotte in Brand setzen ließ und damit ein verheerendes Feuer auslöste. In anderen Erklärungen heißt es, die Bibliothek sei der Christianisierung Alexandrias Ende des 4. Jahrhunderts n. Chr. zum Opfer gefallen. Eine weitere Version macht den Islam für die Zerstörung der Bibliothek verantwortlich: Als der Feldherr Amr 642 n. Chr. Alexandria eroberte, soll Kalif Omar I. entschieden haben, den gesamten Bestand der Bibliotheken zu vernichten. Die Begründung war ebenso einfach wie folgenreich: Die Bücher, die dem Koran widersprachen, gehörten ohnehin vernichtet. Alle anderen aber waren überflüssig, weil der Koran ausreichte, und hatten ihr Existenzrecht mithin ebenfalls verwirkt. Ein halbes Jahr lang seien die 4000 Badestuben der Stadt mit den Rollen befeuert worden. All diese Erklärungen erscheinen mehr oder weniger glaubwürdig, und Altertumsforscher haben viel Energie und Leidenschaft darauf verwandt, aus dem Schicksal der ersten Universalbibliothek der Geschichte schlau zu werden. Wer aber ist wirklich verantwortlich für dieses Verbrechen am kulturellen Erbe der Antike? Es lässt ja zumindest aufhorchen, dass da Schuldige angeführt wurden, denen man sowieso alles Schlechte zutraute – jedenfalls aus der Perspektive ihrer Widersacher. Aber treffen die Verdächtigungen wirklich zu, oder handelt es sich um bloße Verleumdung?
Die hellenistische Welt verstand seit dem 4. Jahrhundert v. Chr. die Bibliothekskultur als Teil einer umfassenden Kulturpolitik. In Alexandria wurden unter den Ptolemäern gleich zwei bedeutende Buchsammlungen begründet: eine kleinere Bibliothek im Tempel des Serapis, die über 40 000 Buchrollen verwahrte, und die erheblich größere, bis heute legendäre Bibliothek im Museion, die mehr als eine halbe Million Rollen besaß. Das ist für die damalige Zeit eine bemerkenswerte Sammlung, zumal weitaus die meisten Buchrollen nicht nur ein Werk, sondern mehrere enthielten. Das Museion im Stadtteil Brucheion war eine Akademie nach dem Vorbild der aristotelischen Schule in Athen, die sich den Wissenschaften widmete, aber sie war gleichzeitig noch mehr: nämlich erstmals eine Universität nach unseren Maßstäben, mit Fachbereichen aller Art, darunter naturwissenschaftlichen. In der zugehörigen Büchersammlung konnten die Gelehrten der Akademie das gesammelte Wissen der damaligen Zeit studieren. So berühmt wurde die Bibliothek, dass der König für seine Akademie die Besten unter den Gelehrten anwerben konnte, denn sie waren begierig darauf, die Bücherschätze zu nutzen.
Das Museion und seine Bibliothek hatte Ptolemaios I. Soter um 300 v. Chr. gegründet; sie lag im Palastviertel und wurde von seinem Nachfolger noch erheblich erweitert. Ptolemaios I. war einer der Diadochen, die nach dem Tod Alexanders des Großen um dessen Weltreich kämpften und es schließlich aufteilten. Der Ehrgeiz der ptolemäischen Könige bestand darin, das gesamte Wissen der Menschheit zusammenzutragen: »Alle Bücher aller Völker der Erde« sollten es sein. Dies gehörte zum Programm der Hellenisierung des uralten ägyptischen Reiches und der übrigen Teile des Herrschaftsgebietes der Ptolemäer. Das Kalkül war einfach, aber klar: Um fremde Völker zu beherrschen, musste man ihre Kultur verstehen; dafür wiederum musste man ihre Bücher kennen, die daher ins Griechische übersetzt werden sollten. Ptolemaios I. schrieb an die Fürsten der Welt, ihm Bücher zu schicken.
Daneben durften es aber auch krumme Wege sein, um die Bücher nach Ägypten zu holen. Zur Erwerbspolitik der Bibliothek gehörte zum Beispiel, dass die Bücher von in Ägypten eintreffenden Schiffen beschlagnahmt wurden, um sie der Bibliothek zuzuschanzen. Die rechtmäßigen Besitzer wurden mit oft schlampig erstellten Abschriften abgespeist. Besonders dreist ging Ptolemaios III. vor, in einem Fall ein paar Jahrzehnte nach Gründung der Sammlung: Er lieh in Athen gegen ein Pfand die offiziellen Ausgaben Athens der Tragödien der klassischen Dramatiker Aischylos, Sophokles und Euripides aus und gab sie nicht mehr zurück. Selbst das stolze Athen musste sich mit einer Abschrift begnügen. Aber nicht alle Bücherrollen der Bibliothek waren solch zweifelhaften Ursprungs, sondern fanden auf akzeptablen Wegen ihren Platz in der legendären Alexandreia. Agenten im Dienste der Bibliotheken kauften im ganzen Reich Bücher, die sie nach Alexandria schickten. So oder so, die Sammlung wuchs, und die Alexandreia wurde zur größten und wichtigsten Bibliothek der Welt.
Die Bibliothek beschäftigte sich aber nicht nur mit dem Sammeln von Büchern. Bedeutende Gelehrte leiteten sie, und unter ihnen wurden Bibliografien, Kataloge, Kommentare und kritische Textausgaben erstellt. Wer in der Bibliothek arbeiten durfte, war privilegiert: steuerbefreit, gut bezahlt und in jeder Hinsicht bestens versorgt. Die gelehrten Mitarbeiter der Bibliothek dienten als Erzieher der königlichen Familie sowie als politische und kulturelle Ratgeber. Unter den Nutzern der Alexandreia waren viele wichtige Geschichtsschreiber wie Kallimachos, Plutarch und Strabo. In ihrer Arbeit wirkte die Alexandreia beispielgebend, und noch heute bekommen Bibliothekshistoriker feuchte Augen, wenn sie an die verlorenen Schätze von Alexandria denken.
Die Bedeutung der Bibliothek und ihr hervorragender Ruf dürften dazu beigetragen haben, dass für ihre Zerstörung unterschiedliche Erklärungen in Umlauf gebracht wurden. Auffällig ist aber schon, wie abwechselnd Heiden, Christen und Moslems für den Untergang dieses Symbols der antiken Kultur verantwortlich gemacht wurden.
Tatsächlich führten die Aktivitäten des Julius Cäsar 48/47 v. Chr. zu Zerstörungen in Alexandria, denen auch Bücherrollen zum Opfer fielen. Wie groß das Feuer im Hafen war und wie verheerend es wütete, ist allerdings umstritten. Und wie sehr die Bibliothek betroffen war, ist noch schwerer zu klären, da bis heute unklar ist, wo genau die Bibliothek stand – wie nah am Hafen und damit am Brandherd. Möglicherweise handelte es sich bei den damals zerstörten Büchern auch nur um jene rund 40 000 für den Export bestimmten Exemplare, die im Hafen der Stadt aufbewahrt wurden, denn die Bibliothek kaufte nicht nur, sondern handelte auch mit Büchern. Wahrscheinlich wurden das Museion selbst und die dort untergebrachte Bibliothek nicht allzu stark betroffen oder blieben gar unversehrt. Kleopatras römischer Ehemann Antonius, Widersacher Octavians, der als Augustus Roms erster Kaiser werden sollte, soll ihr später zum Trost für die verlorenen Kulturgüter mit 200 000 Rollen ausgeholfen haben: aus dem Besitz der Bibliothek von Pergamon, der schärfsten Konkurrentin der Alexandreia. Das allerdings ist vermutlich nur eine hübsche Geschichte ohne historischen Wahrheitsgehalt.
Zur eigentlichen Zerstörung der Bibliothek kam es Ende des 3. Jahrhunderts anlässlich der Kämpfe Kaiser Aurelians gegen Zenobia von Palmyra; ihnen fiel das Stadtviertel Brucheion zum Opfer, in dem der Königspalast und das Museion lagen. Ein gutes Jahrzehnt später schickte auch Diokletian Truppen nach Alexandria, um Aufstände niederzuschlagen. Die Gelehrten der Bibliothek mussten auf die kleinere Bibliothek im Serapistempel ausweichen, die rund 120 Jahre später ebenfalls zerstört wurde. Dieses Mal waren es Christen, vor Kurzem noch selbst wegen ihres Glaubens verfolgt, die nun ihrerseits über den Wert von Büchern richteten. Bischof Theophilos führte 391 eine erboste Menschenmenge an, die es auf die heidnischen Tempel abgesehen hatte. Der Serapis-Tempel ging dabei unter – vermutlich mitsamt seiner Büchersammlung.
Die Geschichte der islamischen Zerstörung der übrig gebliebenen Büchersammlung im 7. Jahrhundert ist unter den Fachleuten umstritten. Immerhin achtet der Islam die beiden anderen Buchreligionen Judentum und Christentum und verbietet die Vernichtung christlicher und jüdischer Schriften, die einen Teil der Bücher ausmachten. Auch hat ein erheblicher Teil der Schriften des Altertums das...
| Erscheint lt. Verlag | 30.6.2022 |
|---|---|
| Verlagsort | München |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Geschichte / Politik |
| Schlagworte | alternative Wirklichkeit • die mittelalterliche Chronik • Fake News • Fälschen • Geschichtsfälschung • Geschichtsklitterung • Gesunde Skepsis • Helden der Geschichte • historisches Allgemeinwissen • historisches Wissen • historische Wahrheit • Instrumentalisierung von Geschichte • Lebenslügen • Manipulation • Manipulieren • Populäre Fälschungen • Populäre Verleumdungen • ungezählte zweifelhafte Berichte • Verleumdung • Verleumdungen • Verschwörungstheorien • Verzerrung der Wahrheit |
| ISBN-10 | 3-95890-499-8 / 3958904998 |
| ISBN-13 | 978-3-95890-499-6 / 9783958904996 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 613 KB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.