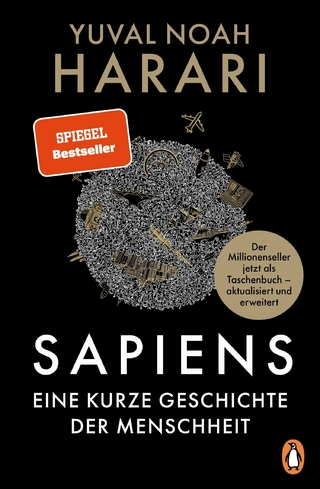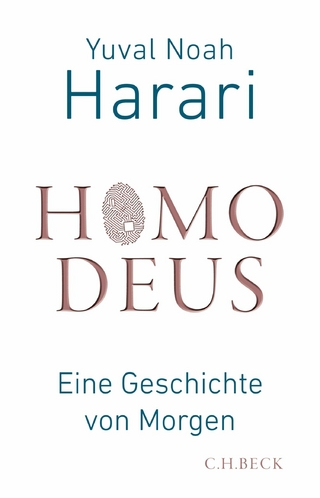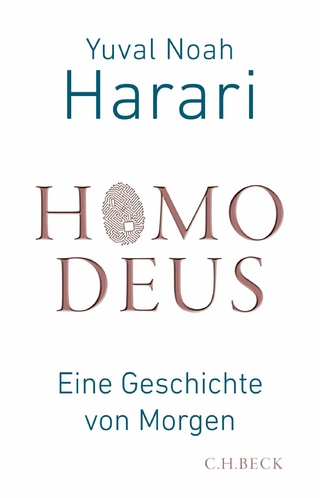Eine andere Jüdische Weltgeschichte (eBook)
176 Seiten
Verlag Herder GmbH
978-3-451-82708-2 (ISBN)
Michael Wolffsohn, Prof. Dr., geb. 1947, ist Historiker und Publizist. Von 1981 bis 2012 arbeitete er als Professor für Neuere Geschichte an der Universität der Bundeswehr in München. Er hat zahlreiche Bücher, Aufsätze und Fachartikel verfasst und ist publizistisch und als vielbeachteter Vortragsredner tätig. Er erhielt zahlreiche Preise und Auszeichnungen, u.a. kürte der Deutsche Hochschulverband Michael Wolffsohn 2017 zum Hochschullehrer des Jahres und 2018 wurde er mit dem Franz-Werfel-Menschenrechtspreis der Stiftung Zentrum gegen Vertreibungen ausgezeichnet.
Michael Wolffsohn, Prof. Dr., geb. 1947, ist Historiker und Publizist. Von 1981 bis 2012 arbeitete er als Professor für Neuere Geschichte an der Universität der Bundeswehr in München. Er hat zahlreiche Bücher, Aufsätze und Fachartikel verfasst und ist publizistisch und als vielbeachteter Vortragsredner tätig. Er erhielt zahlreiche Preise und Auszeichnungen, u.a. kürte der Deutsche Hochschulverband Michael Wolffsohn 2017 zum Hochschullehrer des Jahres und 2018 wurde er mit dem Franz-Werfel-Menschenrechtspreis der Stiftung Zentrum gegen Vertreibungen ausgezeichnet.
II. „Die“ Juden: Namen und Benennungen
Nicht „Juden“, sondern „Söhne Israels“ oder, inhaltlich-grammatikalisch Männliches und Weibliches vereinend: „Volk Israel“ („Am Israel“). Das ist die ursprüngliche Selbstbezeichnung der Juden. „Juden“ – das ergab sich erst im Laufe der Geschichte, nämlich nach der Spaltung des von den biblischen Königen Saul, David und Salomon vereinigten Königsreiches in zwei Monarchien. „Israel“, das Königreich der zehn nach Stammvater Jakobs Söhnen benannten jüdischen Stämme, bestand seit 721 v. u. Z. nicht mehr. Die damalige Weltmacht Assyrien hatte den größeren der beiden jüdischen Ministaaten besiegt, zerstört und einen Großteil der jüdischen Bevölkerung ins mesopotamische Exil verschleppt. Danach gab es nur noch das Königreich Judäa. Es bestand aus den Stämmen Judas und Benjamin, ebenfalls nach Söhnen Jakobs benannt. Seine Einwohner waren „Jehudim“ (Judäer bzw. Juden). Sobald es ab 721 v. u. Z. keinen Staat „Israel“ mehr gab, waren alle, die in Judäa oder woanders als Nachfahren der zehn Stämme bzw. der zehn Söhne Jakobs/„Israels“ lebten und ihren EINEN Gott sowie die Tora (Fünf Bücher Moses) als „Gottes Wort“ verehrten, „Juden“. Auch diejenigen, die im religiösen Sinne Juden wurden. Das gab es in der Antike häufig, wenngleich oft zu hören ist: „Juden betrieben und betreiben keine Missionierung.“ Bis zum frühen 4. Jahrhundert ist diese Aussage falsch. Dann erließ der römische Kaiser Konstantin ein Missionierungsverbot für Juden. Seitdem stand nichtjüdische Macht gegen jüdische Ohnmacht, die ihrerseits in der folgenden jüdischen Tradition rationalisiert, quasi kanonisiert und überhöht wurde, indem Konversionswillige (in der jüdischen Orthodoxie noch heute) durch hohe, exklusive Beitrittshindernisse sozusagen abgeschreckt werden sollten.
Dieser Kunstgriff verwandelte ideologisch-theologisch die eigene Ohnmacht zu Exklusivität. So wurde die bittere Pille, eigene Schwäche, versüßt. Das seit Mitte des 19. Jahrhunderts bestehende liberale Judentum hat die Beitrittshürden weitgehend aufgehoben. Unabhängig von jeglicher Bewertung hebt diese Praxis den Volkscharakter bzw. die Abstammungsgemeinschaft der Juden auf. Das Judentum wird so von einer (für deutsche Ohren unerträglich) „Volksgemeinschaft“ zur Religionsgemeinschaft, also Konfession. So weit die statische, rein formale Sichtweise.
Weil Wirklichkeit meistens dynamisch ist, kann keineswegs aus der Konfessionalisierung des Judentums eine spätere, modifizierte und dauerhafte abstammungsbezogene „Eingemeindung“ ausgeschlossen werden. Auch dieses Faktum um- und beschreibt das Alte Testament durch eine Geschichte. Im Buch Ruth ist sie zu finden. Ruth ist darin eine Nichtjüdin, die das Schicksal ihrer jüdischen Schwiegermutter teilt, einen Juden heiratet und damit Großmutter von König David wird. Aus seinem „Haus“ komme der Messias, besagt die jüdische (und christliche) Tradition. Die beschriebene Liberalisierung der Judaisierung im liberalen Judentum entspricht trotz orthodoxer Verneinung also durchaus dem biblischen Geist. Gleiches gilt für die beiden nichtjüdischen Ehefrauen Moses’. Die eine Midjaniterin, die andere „Kuschit“.
Das Reich „Kusch“ existierte zwischen 700 und 300 v. u. Z. südlich von Ägypten, also genau in der Zeit, zu der der größte Teil der Hebräischen Bibel schriftlich fixiert wurde, nämlich zwischen 500 und 300 v. u. Z. Kusch war sozusagen die Brücke zwischen der Kultur und Religion Ägyptens im Norden und der ostafrikanischen-nordsudanesischen südlich Ägyptens. Diese geografisch-kulturell-religiöse „Mischung“ kennzeichnet die Hebräische Bibel ganz und damit die jüdische Frühgeschichte ganz allgemein. Wer die Bibel so liest, versteht, dass hier ganz offen auf religiöses Monopol und damit auch auf Auserwähltheit oder Überlegenheit gegenüber anderen Völkern verzichtet wird – allen gegenteiligen Formulierungen bzw. Ansprüchen jüdischer Auserwähltheit zum Trotz. Vorsichtiger formuliert und später auszuführen: Zwei Dimensionen kennzeichnen das Judentum: die partikularistisch-monopolistische einerseits sowie die universalistisch-pluralistische andererseits.
In der jüdischen Tradition ist Moses nicht irgendwer, sondern „der“ Prophet und (wieder so ein Schreckenswort) „Führer“ schlechthin. Verwiesen sei auch auf Osnat, die ägyptische Gattin von Jakobs Lieblingssohn Josef.
Daraus folgt (ketzerisch?): Sowohl die beiden Söhne von Josef (Efrajim und Menasse) als auch Gerschom und Elieser, die zwei Söhne des Mythos Moses, waren hilachisch (= dem jüdischen Religionsgesetz gemäß) keine Juden. Die Halacha bestimmt nämlich: Jude ist, wessen Mutter Jüdin ist. Das hört sich ketzerisch an, ist es aber nicht wirklich, denn die Halacha (das jüdische Religionsgesetz) wurde erst lange nach der Festlegung des alttestamentlichen Textes fixiert.
Was nun? Was gilt? Wir stoßen auf ein Kennzeichen vieler Religionen, nicht nur des Judentums: Viele scheinbar eindeutige, unumstößliche Bestimmungen sind oft mehrdeutig und alles andere als unumstößlich. So wurden biblische Bestimmungen oder Aussagen von den späteren Rabbinern scheinbar mir nichts, dir nichts oft vom Kopf auf die Füße gestellt oder umgekehrt.
Daraus folgt: Das Judentum war und ist sowohl eine Abstammungs- beziehungsweise (Entschuldigung) „Volksgemeinschaft“ als auch eine Konfession. Nebenbei: Auch Sprache ist mehrschichtig. Das dokumentieren die hier entschuldigend gebrauchten, zur treffenden Beschreibung aber nahezu unvermeidlichen, doch NS-vergifteten Begriffe wie „Führer“ oder „Volksgemeinschaft“.
Judas wäre, aus biblisch ideologischen Gründen, wohl nicht die erste Wahl für die Benennung der Gesamtheit der Gemeinschaft gewesen, denn auch und zuerst in der Hebräischen Bibel (Altes Testament) ist Judas nicht gerade bestens beleumundet. Man lese dazu in Genesis 38. Judas war der vierte Sohn von Stammvater Jakob, und seine Mutter Lea war, im Vergleich zu Stammmutter Rachel, die von Jakob weniger geliebte zweite Hauptfrau. Trotzdem atmete Lea auf: „Ich will dem Herren danken.“ Aus den hebräischen „Wurzelbuchstaben“ für Gott sowie Dank entstand der Name „Judas“.
Eine im Namen der Gemeinschaft enthaltene, zugleich ähnliche und abgrenzende Gedankenbrücke finden wir auch im Christentum. Sie führt ebenfalls zu Gott. Aber anders – nicht zu Gottvater, sondern zum Sohn. Diese beiden sind im Christentum Teil der einheitlichen Dreiheit aus Vater, Sohn und Heiligem Geist („Trinität“ bzw. „Heilige Dreieinigkeit“). Ähnlichkeiten zwischen und Abgrenzungen von Judentum und Christentum werden wir häufiger begegnen. Diese Gedankenbrücke finden wir auch im Buddhismus, nicht aber im Islam, der eben kein „Allahismus“ ist. Angehörige des Islam, Muslime, sind diejenigen, die sich (Gott) unterwerfen.
Der Großteil des Alten Testaments wurde zwischen 500 und 300 v. u. Z. verfasst. Das ist die Epoche jüdischer Autonomie bzw. Quasi-Staatlichkeit in der alten Heimat Judäa. Gewährt wurde sie den Juden im Perserreich und in der Ära des Hellenismus. Die alttestamentliche Judas-Überlieferung erzählt die dazu passende Geschichte, die, wie das Alte Testament überhaupt, nie beanspruchte, Geschichte zu sein, sondern eben Geschichten, die beschreiben, nicht dokumentieren sollten, „wie es dazu kam“. Woher also, trotz der „Startnachteile“ (besonders Genesis 38), die herausragende Bedeutung von Judas für „die“ Juden? Weil Judas trotz aller Makel auch positive Züge aufwies: Josef, Jakobs Lieblingssohn, war seinen eifersüchtigen Brüdern verhasst. Sie wollten ihn töten. Das verhinderte Judas. Er schlug vor, Josef nicht zu ermorden, sondern ihn zu verkaufen. Gesagt, getan. Auch nicht gerade fein, aber doch Josefs Leben rettend.
Dieser bewussten dialektischen Ethik begegnet man in der Hebräischen Bibel sowie in der gesamten jüdischen Tradition immer wieder. Sie als Beliebigkeit zu bezeichnen, wäre völlig verfehlt. Vielmehr soll signalisiert werden, dass ein und derselbe Mensch oder Sachverhalt nicht eindimensional, sondern mehrdimensional betrachtet und bewertet werden muss. Wie bei jeder guten Literatur. Diese Erzählweise ist zugleich Denkmethode.
Angesichts jener Judas-Dialektik überrascht die Tatsache, dass sowohl in der jüdischen als auch christlichen Tradition der Messias aus dem Hause Davids kam (christlich) oder kommen soll (jüdisch). Eine zweite, scheinketzerische Schlussfolgerung: Auch diese Doppelbödigkeit der Judas-Erzählung verbindet Juden und Christen gleichermaßen. Vielleicht sehen es die Mehrheiten beider Seiten eines Tages ein.
Fazit: Vom frühen 8. Jahrhundert v. u. Z. bis zur ersten Hälfe des 19. Jahrhunderts nennen sich Juden „Juden“ und werden auch von außen so genannt. Die zur Zeitenwende beginnende rabbinische Literatur spricht dagegen meist von „Israel“. Die Außenwelt nahm „Juden“ meist negativ wahr. Um diesem „Makel“ zu entkommen, nennen sich deshalb seit dem 19. Jahrhundert assimilationseifrige Juden „Israeliten“. Die Flucht aus der traditionellen Bezeichnung führte spätestens seit 1948 (Gründung des Staats Israel) in die politische und identifikatorische Sackgasse. Kaum jemand will oder kann zwischen Juden und Israel unterscheiden.
Einer ähnlichen Doppelbödigkeit wie bei Judas begegnen wir bei der Sammelbezeichnung...
| Erscheint lt. Verlag | 11.4.2022 |
|---|---|
| Verlagsort | München |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Geschichte / Politik |
| Schlagworte | Geschichte • Israel • Juden • Judentum • Jüdische Geschichte • Jüdische Religion • Palästina • Religionsgeschichte • Weltgeschichte |
| ISBN-10 | 3-451-82708-5 / 3451827085 |
| ISBN-13 | 978-3-451-82708-2 / 9783451827082 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 1,5 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.