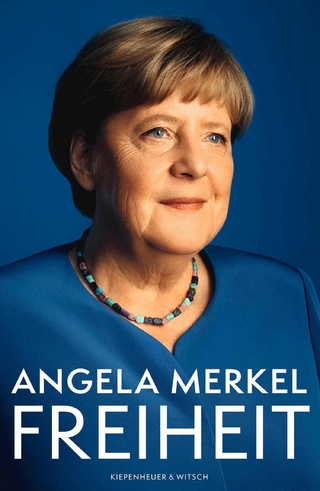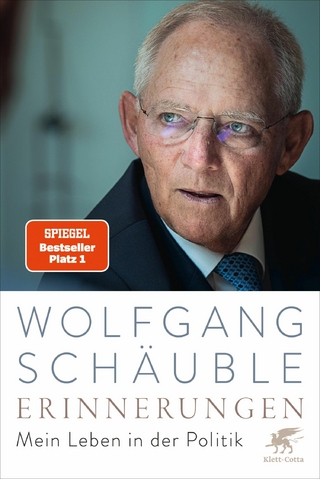Walter Kempowski (eBook)
320 Seiten
Pantheon (Verlag)
978-3-641-29361-1 (ISBN)
Der Lebensweg Walter Kempowskis ist exemplarisch für die wechselvolle Geschichte des deutschen Bürgertums im 20. Jahrhundert. Dirk Hempel, langjähriger Mitarbeiter Kempowskis, stellt in diesem Buch Leben und Werk des großen Erzählers und deutschen Chronisten dar: Kindheit und Jugend in Rostock, die Inhaftierung in Bautzen, die gleichzeitige Existenz als Dorfschullehrer und Erfolgsautor. Seine schnörkellose Biographie bietet einen einzigartigen Einblick in das Leben dieses herausragenden Schriftstellers und Zeitzeugen.
Dirk Hempel, geboren 1965, leitete nach dem Studium der Germanistik und Theaterwissenschaft in München die Redaktion von Walter Kempowskis kollektivem Tagebuch »Echolot«. 2006 habilitierte er sich an der Universität Hamburg und war in der akademischen Lehre tätig. Er ist Autor und Herausgeber zahlreicher Bücher zur Literatur- und Kulturgeschichte, darunter »Walter Kempowski. Eine bürgerliche Biographie« (2004).
2. Herkunft
Zu bedenken, daß sich »das Polnische«
mit »dem Französischen« in mir kreuzte.4
Die Wurzeln der Kempowskis verlieren sich in der Weite des Ostens. Wahrscheinlich kamen sie aus Polen. »Kępa« bedeutet Büschel, Baumgruppe oder bewaldete Insel, ein häufiger Siedlungsname. Die Nachsilbe »-owski« bezeichnet die Zugehörigkeit zu einem Platz. »Kępowski« wäre dann vielleicht der Bewohner einer bewaldeten Flußinsel. Das polnische »ę«, nasal ausgesprochen, wurde unter deutschem Einfluß zu »am«, Kampowski, oder zu »em«, Kempowski.5 Oder aber ein Vorfahr wurde, wie in der Familie überliefert, für besondere Tapferkeit mit der Adelsendung -ski ausgezeichnet.6 Damit gehörte er zum polnischen Landadel, der Szlachta. Die polnische Herkunft war jedenfalls in der Familie sprichwörtlich, vor allem, wenn es darum ging, Verfehlungen, Ungenauigkeiten zu erklären.
Die Geschichte der Rostocker Kempowskis ist ein ständiger Wechsel von Aufstieg und Niedergang, sie ist auch eine Geschichte von der Entstehung des Bürgertums aus eigener Kraft. Der erste nachgewiesene Vorfahr ist der Schneider Kempowski, der um 1768 in Rehberg auf der Elbinger Höhe geboren wurde.7 Rehberg war Rittergut und gehörte zur Herrschaft Cadinen. Das dortige Schloß kaufte Kaiser Wilhelm II. im Jahr 1898, ließ es zu einer Sommerresidenz ausbauen und eine Majolikamanufaktur gründen.
Am 1. Juni 1801 wurde der Schneider Kempowski zum Lehrer ernannt, ein in der damaligen Zeit nicht ungewöhnlicher Vorgang. Denn bis weit ins 19. Jahrhundert waren es auf dem Land oft Handwerker, selbst kaum des Lesens und Schreibens kundig, die den Kindern elementare Kenntnisse vermittelten. Kempowski erhielt von seiner Herrschaft ein jährliches Gehalt von 42 Talern, außerdem für jedes Schulkind wöchentlich einen Groschen – ein äußerst niedriges Einkommen. Ein Schulmeister in der Stadt verdiente damals etwa 200, ein hoher Beamter etwa 700 Taler. Die dem Lehrer zugebilligten Naturalien – fünf Scheffel Roggen, ein Scheffel Gerste, ein Scheffel Erbsen sowie freie Wohnung und Feuerholz – mögen die Kontinuität seiner materiellen Existenz gewährleistet haben.
Warum er nicht in Rehberg blieb und 1812 Lehrer im nahen Succase wurde, das auf dem Sumpfland zwischen Haff und Höhe lag und zur Elbinger Ratsherrschaft gehörte, ist ungewiß. Vielleicht war der Alkohol schuld, dem er immer wieder übermäßig zugesprochen haben soll, ein Laster, das auf der Elbinger Höhe weit verbreitet gewesen zu sein scheint. Der Krug in Succase jedenfalls schenkte im Jahr 1772 an die 6000 Liter Bier aus, bei 28 erwachsenen Einwohnern mehr als 200 Liter pro Kopf und Jahr, dazu rund 170 Liter Branntwein.8 Die Zahlen erhöhen, ja verdoppeln sich pro Kopf, wenn man annimmt, daß die Frauen eher nicht den Krug aufsuchten. Aber schon den Kindern verabreichte man Schnaps, wenn sie zu Weihnachten von Tür zu Tür zogen und Weihnachtslieder sangen.9 Und bei Festen, so heißt es, wurde auf den Dörfern »gefressen und gesoffen und aus einem Hause in das andre geschwärmt«.10
Der Lehrer Kempowski lebte unter einem ungesitteten und ungebildeten Menschenschlag, klein und gedrungen, oft schwarzhaarig – ein Erbteil der heidnischen Pruzzen? »Feine Sitten wird man nicht gewahr, wohl aber Ausbrüche von Roheit«, urteilte ein zeitgenössischer Beobachter.11 Aberglaube herrschte in dem entlegenen Landstrich. Faulheit, Liederlichkeit, Schlägereien, Unzucht, wilde Ehen waren an der Tagesordnung. Mit Halseisen und Stockstrafe ging der Elbinger Rat dagegen vor.
Vorlaubenhaus auf der Elbinger HöheDie Schule war erst 1804 gegründet worden. Der Lehrer Kempowski, der unter der Aufsicht des Pastors stand, unterrichtete die Kinder in seinem Vorlaubenhaus, im Sommer 15 Stunden pro Woche, im Winter 30. Er bekam nur noch 18 Taler Gehalt, kaum mehr als ein Knecht verdiente. Die Verschlechterung spricht für einen unrühmlichen Abgang von seiner ersten Stelle.
Succase wurde in diesen Jahren von den großen Welthändeln berührt. Im Januar 1807 lagerten die Truppen des französischen Marschalls Bernadotte hier, sicher auch im Haus des Lehrers. Von der Höhe aus konnte man die preußischen und französischen Kähne beobachten, die sich auf dem Haff Gefechte lieferten, und im Mai 1807 drang die Kunde auf die Dörfer, daß der Usurpator selbst in der Festung Elbing eingetroffen war. Kempowski muß auch die Soldaten der Grande Armée gesehen haben, die dann im Sommer 1812 nach Rußland zogen, und ihre jämmerlichen Reste, die im Winter als Flüchtlinge zurückkehrten. Murat, der König von Neapel, war unter ihnen. Dutzende von Verwundeten, die mit Schlitten über das gefrorene Haff gebracht werden sollten, versanken hier im Eis.12 Die Franzosen brachten Seuchen mit, Typhus und Ruhr. Ihnen folgten die russischen Truppen auf dem Fuß.
Mit dem Lehrer Kempowski nahm es kein rühmliches Ende. Der tapfere Schneider, der den westpreußischen Kindern jahrelang das Lesen und Schreiben beigebracht hatte, wurde ein Opfer der Humboldtschen Bildungsreformen, die in Preußen nach 1812 die Lehrerausbildung professionalisierten und gesetzlich regelten. Kempowski mußte sich nun einer Prüfung unterziehen, die er nicht bestand. Succase blieb bis 1829 ohne Lehrer.
Sein Sohn Friedrich (Wilhelm) Kempowski (?–1881) lebte als »Eigengärtner« in Succase. Er besaß ein Haus und ein kleines Stück Gartenland, bevor er sich 1824 einen Haffkahn anschaffte und »Schiffer« wurde. Er transportierte Obst, vor allem Kirschen und Pflaumen, auf die Frische Nehrung, nach Elbing und Königsberg. Die Elbinger Höhe galt als eines der vorzüglichsten Obstanbaugebiete Preußens. In späteren Jahren lebte er als »Schiffseigner« mehrerer Lastkähne in Elbing, in einem der typischen Kaufmannshäuser der ehemaligen Hansestadt. Er war dreimal verheiratet. Einer seiner Söhne lernte das Handwerk des Zigarrenmachers bei der Firma Loeser & Wolff, die in Elbing die größte Zigarrenfabrik des Kontinents errichtet hatte, bevor er nach Amerika auswanderte. Der zu Succase Erstgeborene aber, Friedrich Wilhelm (1824–1904), ging nach Königsberg, in die Provinzialhauptstadt. Er war nun schon »Rheeder« und besaß bald sechs Segelschiffe.
Ein kleines Familienimperium entstand hier am Pregel. Die Schiffe befuhren das Haff und die Ostsee mit Obst und Gemüse, und Nachkommen aus der dritten Ehe von Friedrich Kempowski betrieben vor Ort einen Obst- und Kartoffelgroßhandel, der nach 1945 in Lübeck fortgesetzt wurde.
Es ging aufwärts. Friedrich Wilhelm und seine Frau Auguste Wilhelmine geborene Benson (1825–1912) führten nun schon ein bürgerliches Leben. In ihrer geräumigen Wohnung mit Blick auf den alten Hafen sollen Porzellan und Kristall die Schränke gefüllt haben. In einer Truhe wurden angeblich Säcke mit Talern aufbewahrt. Auguste Wilhelmine, eine stattliche Blondine, trug reichen Goldschmuck und ließ sich von Kindern und Enkeln die Hand küssen.13 Sie brachte mit dem »Güldnen Schatzkästlein« den ersten Zettelkasten in die Familie Kempowski ein, ein frommes Orakel biblischer Sprüche aus dem Jahr 1726.14
Auguste Wilhelmine und Friedrich Wilhelm Kempowski am Tag ihrer Goldenen Hochzeit 1899Doch dann gingen alle sechs Segelschiffe unter, in einem Jahr, und Friedrich Wilhelm Kempowski verlor sein Vermögen. Sein viertes Kind, Robert William Oskar Alfred (1865–1939), lebte da schon in Rostock. Er hatte als Befrachter in der Schiffsmaklerei Otto Wiggers15 begonnen, eine derbe Natur mit westpreußischem Vierkantschädel, der fluchte und Plattdeutsch sprach, allerdings auch Dänisch und Englisch beherrschte. Er vermittelte Kohle aus England und Schottland, norwegisches Süßwasserblockeis, Kalksteine aus Dänemark, exportierte Kartoffeln und Mauersteine nach Schweden und Finnland. Er erwies sich bald als rührig und tüchtig.16 So konnte er nicht nur die Einnahmen der Firma erheblich steigern, sondern auch seine eigenen Einkünfte, wovon er ein recht flottes Leben führte. Aber er unterstützte auch seine Eltern in Königsberg durch regelmäßige Zahlungen.
Rostock war Ein- und Ausfuhrhafen Mecklenburgs, die Stadt eine Mischung aus Wissenschaft und Wirtschaft. Die Universität existierte seit 1419, eine der ältesten Deutschlands. Der Humanist Ulrich von Hutten hatte hier bettelarm und syphiliskrank Vorträge gehalten und der Astronom Tycho Brahe im Duell einen Teil seiner Nase eingebüßt. Fritz Reuter gab sich Anfang der dreißiger Jahren dem studentischen Treiben hin, und Heinrich Schliemann wurde 1869 promoviert.
Der Schiffsmaklerei Wiggers gegenüber wohnte der Chemiker Dr. Carl Grosschopf,17 ein...
| Erscheint lt. Verlag | 25.7.2022 |
|---|---|
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Literatur ► Biografien / Erfahrungsberichte |
| Sozialwissenschaften ► Politik / Verwaltung | |
| Schlagworte | 2022 • Autor • Biografie • Biographien • Deutschland • eBooks • Echolot • Ein Kapitel für sich • Geschichte • Haus Kreienhoop • Literatur • Nartum • Neuerscheinung • Rostock • Schriftsteller • Tadellöser & Wolff |
| ISBN-10 | 3-641-29361-8 / 3641293618 |
| ISBN-13 | 978-3-641-29361-1 / 9783641293611 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 12,5 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich