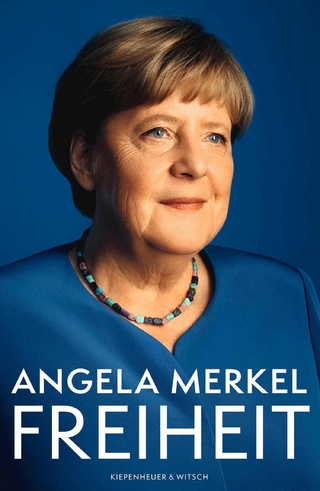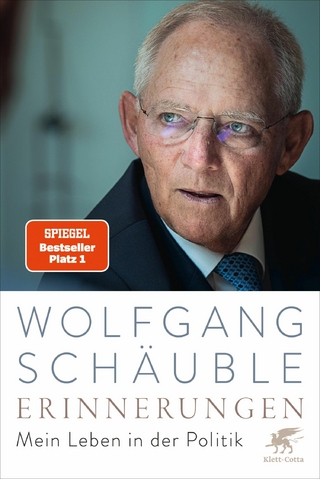Die Schwiegertochter. Das Leben der Ottilie von Goethe (eBook)
250 Seiten
Insel Verlag
978-3-458-77069-5 (ISBN)
»Er hatte nie eine Tochter gehabt. Nun war sie da.«
Für ihren Schwiegervater, den Dichter und Staatsminister Johann Wolfgang von Goethe, war sie unentbehrlich: Ottilie von Goethe, eine geb. von Pogwisch aus schleswig-holsteinischem Uradel, war eine der unkonventionellsten, faszinierendsten, auch umstrittensten Frauen ihrer Zeit.
Obwohl ihre adelsstolzen Verwandten die Ehe mit August, dem unehelich geborenen Sohn des Dichters, nicht billigten, kam die Heirat zustande. Ottilie hatte dabei hauptsächlich ein Ziel: Goethes Schwiegertochter zu werden.
Die Ehe mit August erwies sich als problematisch, Ottilie suchte Trost in diversen Liebschaften. Doch ihre Heiterkeit, Intelligenz und Hilfsbereitschaft machten sie ihrem Schwiegervater bald unersetzlich. Nach Augusts frühem Tod sah Ottilie in der Sorge für Goethe und sein Werk ihre Lebensaufgabe. Und er förderte die geistigen Interessen der Mutter seiner drei Enkelkinder Walther, Wolfgang und Alma. Ottilie schrieb auch selbst, dichtete und gründete die Zeitschrift Chaos. Goethes letzte Worte gehörten Ottilie.
Dagmar von Gersdorff zeichnet das Bild einer geistreichen, liebeshungrigen, unkonventionellen Frau. Nach Goethes Tod musste sich Ottilie neu erfinden. Sie führte ein unstetes Leben zwischen Weimar, Wien und Italien. Den geistigen Größen ihrer Zeit durch Freundschaften verbunden, genoss sie, nicht nur als »Goethes Schwiegertochter«, bis zuletzt hohes Ansehen.
<p>Dagmar von Gersdorff, geb. von Forell, stammt aus Trier/Mosel. Sie lebt heute als Literaturwissenschaftlerin und Biographin in Berlin. Verheiratet, drei Kinder. Studium der Germanistik und Kunstgeschichte an der Freien Universität Berlin. Ihre Promotion schrieb sie über den Einfluss der deutschen Romantik auf Thomas Mann. Für die Staatlichen Museen Preußischer Kulturbesitz verfaßte sie drei Text-Bild-Bände.<br /> Bekannt wurde sie durch ihre Biographien über bedeutende literarische und historische Persönlichkeiten: Marie Luise Kaschnitz, Bettina und Achim von Arnim, Goethes Mutter, Caroline von Günderrode, Goethes Enkel, Prinz Wilhelm von Preußen und Elisa Radziwill, Caroline von Humboldt. Ihr Werk wurde mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet. Sie ist Mitglied des Verbandes deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller sowie Mitglied des internationalen PEN.</p>
I.
Ottilie Wilhelmine Ernestine Henriette
Freiin von Pogwisch
»Du weißt, ich liebe den Vater ungewöhnlich –«
Wem von beiden war sie zuerst aufgefallen, dem Vater oder dem Sohn? Goethe, soviel ist sicher, hatte sich schon früh wohlwollend über Ottilies warme Stimme geäußert. Er habe sie immer aus allen anderen herausgehört, hatte er behauptet. Daß ihm die Vierzehnjährige zu seinem Geburtstag einen Blumenstrauß überreichte, war nicht vergessen – es hatte Goethe gefallen. Zum Dank wurde die anmutige junge Dame an seinen Mittagstisch gebeten. Ihre spontanen Antworten hatten ihn zum Schmunzeln gebracht. Diese lebhafte Person war entschieden anziehender als die spröden Mitglieder ihres Musenvereins.
Als Karl und Ernst zu Gast waren, die Söhne seines Freundes Schiller, lud Goethe Ottilie wieder ein. »Mittags Frl. Pogwisch und beyde Schillers«, liest man in seinem Tagebuch vom 4. Oktober 1812. Ihre Gegenwart war ein Gewinn. Es wurde viel geredet und noch mehr gelacht. Schon im November durfte sie wiederkommen, im Dezember ebenfalls. »Mittag Frl. Bowisch« und »Mittags Frl. v. Bogwisch« lauten die Einträge. Schließlich merkte sich Goethe ihren richtigen Namen: »Mittags die zwey Fräulein von Pogwisch«. Die jüngere Schwester hatte mitkommen dürfen. Man erfuhr, daß Ottilie Klavier spielte, Englischunterricht nahm und die von der Herzogin gegründete Nähschule besuchte. Das alles berichtete sie mit gewinnender Liebenswürdigkeit. Von ihrem anziehenden Wesen angetan, erwähnte der Dichter bei seinem Freund Knebel noch einmal Ottilies schöne Altstimme, die ihm an den Sonntagen, als in seiner »Hauskapelle« alte italienische Lieder erklangen, besonders gefallen habe.
Es ist anzunehmen, daß an den Mahlzeiten auch des Dichters einziger Sohn teilnahm. Bemerkte der Vater die Blicke, die August der Besucherin zuwarf? Am 25. Dezember 1812, seinem zweiundzwanzigsten Geburtstag, trank man auf Augusts Wohl – der regierende Herzog Carl August hatte ihn zum Wirklichen Assessor im Kammerkollegium ernannt. Grund genug, auch die hübsche Ottilie zur Feier einzuladen. »Mittags Fräulein von Pogwisch.« Schüchtern war sie nicht, das tat dem steifen Sohn gut. Ihm schien die ungewohnte Schlagfertigkeit, mit der die gerade Sechzehnjährige das Tischgespräch belebte, zu gefallen. Den wahren Grund seiner Einladungen verrät Goethes Tagebuch mit keiner Silbe. Daß sich eine Absicht dahinter verbarg, zeigte sich erst später, als der Dichter noch andere Fäden spann, um die Verbindung seines Sohnes mit dem geschätzten Freifräulein fester zu knüpfen.
Über Ottilies Herkunft, ihre Familie, ihre Geschwister wußte Goethe, der bis dahin gerade einmal ihren Namen kannte, so gut wie nichts. Was würde er erfahren, wenn er nach der Familie derer von Pogwisch, nach Ottilies Eltern fragte? August hatte berichtet, daß Ottilie in den Mansarden des Fürstenhauses wohnte, unmittelbar über den Gemächern der regierenden Herzogin Luise. Allerdings hatte er Ottilies Vater noch nie zu Gesicht bekommen.
Weder Goethe noch sein Sohn wußten, daß Ottilie von Pogwisch noch nie in ihrem Leben ein richtiges Zuhause erlebt hatte, sondern unter denkbar ungünstigen Bedingungen aufgewachsen war. Schuld an der Misere war der preußische Major Julius von Pogwisch, Ottilies Vater. Er war zweiunddreißig Jahre alt, als er der sechzehnjährigen Komtesse Henriette Henckel von Donnersmarck begegnete, Tochter des Gouverneurs von Königsberg, in die er sich stürmisch verliebte. In Schloß Rheinsberg bei Potsdam fand die Vermählung der zwanzigjährigen Henriette mit dem wohlhabenden Gutsbesitzer statt.
Noch im Hochzeitsjahr wurde ihnen am 31. Oktober 1796 im preußischen Danzig das erste Kind geboren, die Tochter Ottilie Wilhelmine Ernestine Henriette Freiin von Pogwisch. Zu dieser Zeit, und auch nach der Geburt der zweiten Tochter, Ulrike Henriette Adele Eleonore, herrschte zwischen den Eltern das schönste Einvernehmen. Der Major war ein liebender Ehemann und zärtlicher Vater – bis das denkbar größte Unglück über ihn hereinbrach. Durch Grundstücksspekulationen verlor Freiherr von Pogwisch seine gesamten Güter und Ländereien. Unglaublicher Leichtsinn hatte den finanziellen Ruin zur Folge. Die Katastrophe erwies sich als so weitreichend, daß der unselige Major nicht einmal mehr Frau und Kinder ernähren konnte. Henriettes Mutter, die energische Reichsgräfin Eleonore Henckel von Donnersmarck, befahl ihrer Tochter die sofortige Trennung von diesem unrühmlichen Gatten.
Damit begann für die vierundzwanzigjährige Freifrau von Pogwisch ein elendes Wanderleben. In trostloser Verfassung ging sie zunächst zu einem Onkel, der sie und die kleinen Mädchen, vier und zwei Jahre alt, so lange aufnahm, bis der verschuldete Major seine Finanzen geregelt haben würde. Doch nichts geschah. Um ihrer Mutter nicht auf der Tasche zu liegen, beschloß Henriette, sich eine bezahlte Tätigkeit zu suchen. Für Frauen – und speziell solche der gehobenen Stände – war ein derartiges Vorhaben so gut wie aussichtslos. Doch Henriette von Pogwisch hatte Glück. Prinzessin Friederike von Solms-Braunfels, Schwester der Königin Luise von Preußen, suchte eine Erzieherin für ihre Kinder. Henriette bekam die Stelle und war überglücklich, auch ihre kleinen Töchter ins fränkische Ansbach mitbringen zu dürfen. Allerdings waren die Mädchen fortan meist sich selbst überlassen; ihre Mutter war von morgens bis abends eingespannt. Die sechsjährige Ottilie mußte lernen, Verantwortung zu übernehmen und sich klug anzupassen, um der Mutter keine Schwierigkeiten zu bereiten. Als es nach drei Jahren zu Mißhelligkeiten zwischen Fürstin und Erzieherin kam, trennte man sich. Frau von Pogwisch ging nach Dessau zu ihrer Stiefschwester Auguste von Hagen. Hier wurden die Mädchen zwar liebevoll aufgenommen, doch das Gefühl, wieder nur Anhängsel zu sein, verließ Ottilie nicht.
An eine Rückkehr in die Heimat war nicht zu denken. Major von Pogwisch saß weiter auf hohen Schulden. Was sollte eine mittellose Offiziersfrau mit zwei Kindern bei einem nichtswürdigen Taugenichts, zürnte die Reichsgräfin, und untersagte der Tochter jede Wiederannäherung. Daraufhin suchte Henriette Zuflucht bei ihrer Tante Bertha von Schmeling in Ludwigslust, wo sie so lange unterkam, bis sie nach Thüringen befohlen wurde: Die Reichsgräfin hatte eine Stellung als Oberhofmeisterin bei Erbprinzessin-Großfürstin Maria Pawlowna in Weimar erhalten. Das geschah im April des verhängnisvollen Jahres 1806, in welchem der preußische König Friedrich Wilhelm III. die entscheidende Schlacht gegen Napoleon bei Jena und Auerstedt verlor. Geschlagene und verwundete Preußen und marodierende französische Soldaten fielen in der Stadt ein; am 15. Oktober 1806 erlebten die Neuankömmlinge den Einzug Napoleons im Weimarer Schloß. Goethe wurde in seinem Haus von plündernden Soldaten bedroht, von seiner Gefährtin Christiane Vulpius jedoch mutig beschützt, so daß er sie aus Dankbarkeit für ihre Fürsorge am 19. Oktober zur Frau nahm. Der gemeinsame Sohn August war zu diesem Zeitpunkt sechzehn Jahre alt.
Reichsgräfin Henckel von Donnersmarck, Ottilies Großmutter, hatte ihr Logis im Fürstenhaus nahe der Anna-Amalia-Bibliothek bezogen; gnadenhalber durfte auch ihre Tochter mit den Kindern dort einziehen. Die Zimmer unter dem Dach waren kalt, kahl und unbeheizbar. Als dann auch Henriette eine Stelle als Hofdame erhielt, blieben die zehnjährige Ottilie und die achtjährige Ulrike wieder sich selbst überlassen. Der gutherzigen Oberkammerherrin Caroline von Egloffstein war es zu verdanken, daß die Mädchen wenigstens täglich mit einer warmen Mahlzeit versorgt wurden. Von einem geregelten Unterricht ist nirgends die Rede. Nach ihren Briefen zu urteilen, war Ottilie wißbegierig, intelligent und lernbereit. Sie las wie besessen und hatte bald eine ganze Reihe von Lieblingsschriftstellern, worunter E. T. A. Hoffmann an erster Stelle rangierte. Seine überschäumende, groteske Phantasie diente ihr später als Vorbild zu eigenen Erzählungen. Außerdem...
| Erscheint lt. Verlag | 26.9.2021 |
|---|---|
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Literatur ► Biografien / Erfahrungsberichte |
| Schlagworte | Ehe • Frauenbiographie • Johann Wolfgang von Goethe • Weimar • Weimarer Klassik |
| ISBN-10 | 3-458-77069-0 / 3458770690 |
| ISBN-13 | 978-3-458-77069-5 / 9783458770695 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 10,9 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich