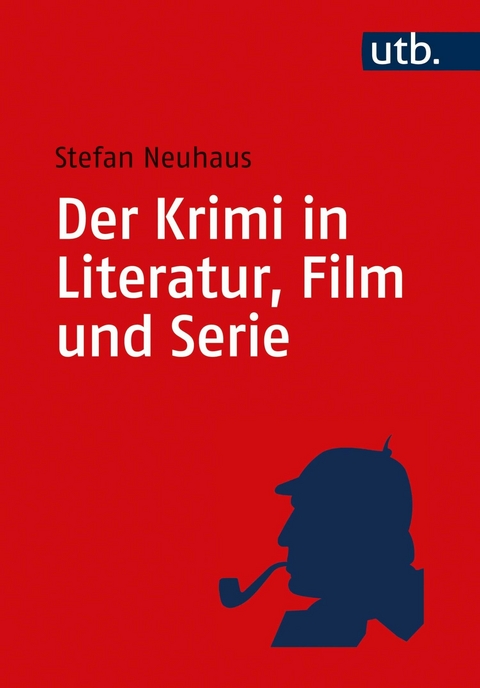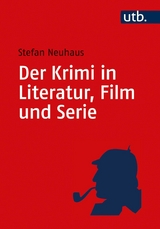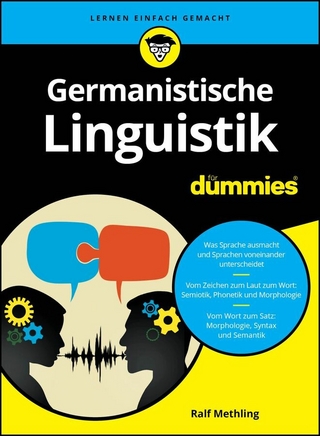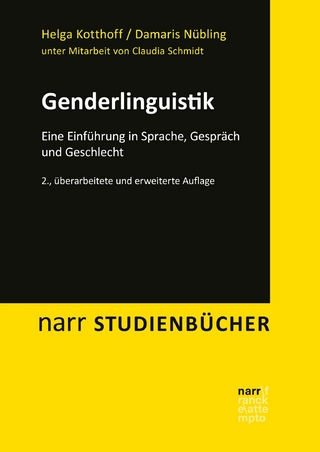Der Krimi in Literatur, Film und Serie (eBook)
300 Seiten
UTB GmbH (Verlag)
978-3-8463-5556-5 (ISBN)
Prof. Dr. Stefan Neuhaus lehrt Literaturwissenschaft an der Universität Koblenz.
1. Einleitung
1.1 Ein spannendes und vielfältiges Genre
1.2 Vorgehensweise
1.3 Gratifikationen für Krimi-Leser*innen
2. Merkmale
2.1 Was ist ein ‚Krimi‘?
2.2 Gängige Strukturen, Themen und Motive des Krimis
2.3 Konzeptionelle und kontextuelle Grundlagen
2.4 Diskurse von (poetischer) Gerechtigkeit
2.5 Rationalität und Emotionalität
2.6 Zuschreibungen von Gut und Böse
2.7 Zuschreibungen des Wertes: Unterhaltung, Kunsthandwerk und Kunst
3. Literatur- und filmgeschichtlicher Abriss
3.1 ‚Ursprungserzählung‘ und Genretraditionen
3.2 Vom Buch zum Film
4. Kriminalerzählungen
4.1 Ein Sammelbegriff
4.2 Der Anfang im 18. Jahrhundert mit der Frage nach dem Motiv der (Un-)Tat: Friedrich Schillers Der Verbrecher aus verlorener Ehre (1786)
4.3 Der Einbruch von Kontingenz: Theodor Fontanes Unterm Birnbaum (1891)
4.4 Die unbeantwortbare Frage nach der Schuld: Fritz Langs M (1931)
4.5 Die schwierige Abgrenzung von Kriminalerzählung, Detektiverzählung und Thriller: Nele Neuhaus’ Böser Wolf (2012)
5. Detektiverzählungen
5.1 Typen des Detektivs
5.2 Eine moderne Detektivfigur vor der Moderne: E.T.A. Hoffmanns Das Fräulein von Scuderi (1819)
5.3 Das Muster des Genres: Edgar Allan Poes The Murders in The Rue Morgue (1841)
5.4 Das Muster der Detektivfigur: Sherlock Holmes in Sir Arthur Conan Doyles The Hound of the Baskervilles (1902)
5.5 Holmes im Film: The Hound of the Baskervilles (1939)
5.6 Muster der Variation: Hercule Poirot in Agatha Christies The Murder of Roger Ackroyd (1926)
5.7 Poirot im Film: The Murder of Roger Ackroyd (2000)
5.8 Das Muster des Kinder-Detektivs: Erich Kästners Emil und die Detektive (1929)
5.9 Emil im Film: Emil und die Detektive (1931)
5.10 Der bekannteste ‚hard-boiled detective‘: Philip Marlowe in Raymond Chandlers The Big Sleep (1939)
5.11 Marlowe im Film: The Big Sleep (1946)
5.12 Requiem für den Detektiv: Friedrich Dürrenmatts Das Versprechen (1958)
5.13 Matthäi im Film: Es geschah am hellichten Tag (1958)
5.14 Der Detektiv als Stehaufmännchen in der späten Postmoderne: Simon Brenner in Wolf Haas’ Das ewige Leben (2003)
5.15 Brenner im Film: Das ewige Leben (2015)
6. Thriller
6.1 Es geht um den Nervenkitzel
6.2 Der Vorläufer: Friedrich Schillers Der Geisterseher (1789) Liebe, Tod und Wahnsinn: Alfred Hitchcocks Rebecca (1940)
6.3 Der lange Schatten der Vergangenheit: John Schlesingers Marathon Man (1976)
6.4 Ein postmoderner Meta-Thriller: Kenneth Branaghs Dead Again (1992)
7. Erzählungen von Agenten und Spionen
7.1 Der Spion im Mittelpunkt
7.2 Britische Snoblesse: Ian Flemings Roman Goldfinger (1959)
7.3 Filmische Nonchalance: Albert R. Broccolis und Harry Saltzmans Goldfinger (1964)
8. Krimikomödien und Krimiparodien
8.1 Bunt ist alle Parodie
8.2 Adel vernichtet: Kind Hearts and Coronets (1949)
8.3 Very English: Die James-Bond-Parodie Johnny English Strikes Again (2018)
8.4 Ein Fünf-Sterne-Krimi-Komödie-Parodie-Satire-Cocktail: Fargo (2014 ff.)
9. Fazit: Ein mörderisch gutes Genre
10. Literaturverzeichnis
10.1 Primärwerke
10.2 Filme
10.3 Monographien, Sammelwerke und Aufsätze
10.4 Internet-Quellen
Abbildungsnachweis
Sachregister
Personenregister
1. Einleitung
1.1 Ein spannendes und vielfältiges Genre
Ein Blick in die Programme von Verlagen, Fernsehsendern und Filmanbietern legt die Vermutung nahe, dass es kein populäreres Genre gibt als den Krimi. Stellvertretend für viele sei auf zwei Superlative hingewiesen: „Nur von Shakespeares Werken und von der Bibel sind mehr Exemplare verkauft worden als von [Agatha] Christies Romanen, inzwischen über zwei Milliarden“ (Hamann 2016, 26). Nach den Romanen und Erzählungen setzten Filme und Serien die Erfolgsgeschichte fort. Für die Erstausstrahlung der Francis-Durbridge-Verfilmung Das Halstuch als sechsteiliges Fernsehspiel im Januar 1962 wurde die sensationelle Einschaltquote von 89 Prozent ermittelt.
Einführungen in die Kriminalliteratur gibt es bereits (v.a. Vogt 1971; Vogt 1998; Nusser 2009), ein Handbuch von 2018 dokumentiert den Forschungsstand (Düwell u.a. 2018). Ebenso hat der Kriminalfilm in seinen verschiedenen Ausprägungen immer wieder Beachtung erfahren (Hickethier 2005; Grob 2012; Koebner/Wulff 2013). Dazu kommen Studien zu Subgenres und besonderen Themen (z.B. Föcking/Böger 2012; Hißnauer u.a. 2014). Allerdings ist das Feld der grundlegenden Handreichungen immer noch übersichtlich, wenn man sie mit dem Erfolg des Genres vergleicht.
Der wichtigste Grund dürfte sein, dass die Popularität des Genres als Zeichen schneller Konsumierbarkeit und somit als Beleg für seine Trivialität gewertet wird (vgl. z.B. Alewyn 1998, 52; Wörtche 2007, 344; Nusser 2009, 11; Worthington 2011, 1). Mit anderen Worten: Wenn etwas so einfach gestrickt ist wie ein Krimi, dann lohnt sich keine (literatur- oder kultur-)wissenschaftliche Auseinandersetzung (es sei denn, man blickt auf das Genre als Kulturbetriebsphänomen). Dieses Urteil ist allerdings ein Vor-Urteil. So hat beispielsweise Josef Hoffmann in seiner Studie Philosophien der Kriminalliteratur versucht, die „Entstehung der Kriminalliteratur aus dem Geist der westlichen Philosophie“ zu erklären (Hoffmann 2013, 41). Auch andere Genres waren oder sind populär und auch hier ist der größere Teil stets eher der Unterhaltung gewidmet. Das heißt aber nicht, dass es nicht einen Anteil an herausragenden, innovativen und im Wortsinn bemerkenswerten Beispielen gibt, die eine genauere Betrachtung geradezu herausfordern. Goethes Die Leiden des jungen Werther und Die Wahlverwandtschaften sind frühe Beispiele für Liebesromane – aber doch wohl keineswegs trivial.
Die bisherigen Studien, Sammelbände und Nachschlagewerke können keinen historischen Überblick über den ‚ganzen‘ Krimi geben, obwohl beeindruckende Versuche vorliegen (vgl. z.B. Arnold/Schmidt 1978 u. Walter 2002). Der vorliegenden Einführung kann und wird es ebenfalls nicht gelingen, alle Medien und Aspekte abzudecken und das allein für den „Kriminalroman“ festgestellte „erhebliche[s] Forschungsdesiderat“ zu beheben (Wörtche 2007, 345). Dennoch soll erstmals der Versuch gewagt werden, den Krimi in Literatur, Film und Serie gemeinsam beispielhaft zu beleuchten. Auch das kann natürlich nur sehr selektiv geschehen, und dies bereits, wenn es um die Einbeziehung anderer kultureller Traditionen geht. Die im deutschsprachigen Raum besonders populäre US-amerikanische und britische Krimi-Tradition soll in die Darstellung mit einbezogen werden.
Die Ausdifferenzierung des Genres hat zu einer segmentierten Betrachtung verschiedener Subgenres geführt, die allerdings in ihrer idealtypischen Ausprägung nur selten vorkommen. Wie soll man sinnvoll eine Kriminalerzählung von einer Detektivgeschichte oder einem Thriller abgrenzen? Die Handlung entwickelt sich äußerst selten entweder retrospektiv-analytisch oder in die Zukunft gerichtet, in den meisten Fällen findet man eine Mischung von beidem vor. Und wohin gehören beispielsweise die Spionageerzählung oder der Spionagefilm? James Bond jagt in der Regel nicht politisch motivierte Verbrecher, sondern Kriminelle, die den Globus in Geiselhaft nehmen.
Kriminelle Handlungen sind in Literatur und Film ohnehin an der Tagesordnung. Letztlich kann nur das gewählte Analyseraster offengelegt und dann am Einzelbeispiel diskutiert werden, welches Thema überwiegt: Die Krimihandlung oder die Liebe zwischen den Protagonisten, selbst wenn gewalttätiges Verhalten eine große Rolle spielt, oder ein politisches Thema wie Rassismus, auch wenn Polizei und Gerichtsverfahren einen breiten Raum einnehmen. Ist also Harper Lees To Kill a Mockingbird (Wer die Nachtigall stört) von 1960, ein moderner Klassiker der US-amerikanischen Literatur, nun ein Krimi? Wie steht es mit der Verfilmung von 1962 unter der Regie von Robert Mulligan, die drei Oscars bekam und als einer der besten amerikanischen Filme überhaupt gilt? (AFI’S 100 Years 2019). Gregory Peck spielt die Hauptrolle, einen Anwalt, der einen Farbigen verteidigt, wobei der Plot als allegorische Anklage des alltäglichen Rassismus in den USA angelegt ist. Handelt es sich nun bei Buch und Film um Krimis?
Offenbar ja, denn es sind gleich mehrere Merkmale des Krimis zu finden – ein (angebliches) Verbrechen, Polizeiarbeit, eine Gerichtsverhandlung und am Ende noch versuchter Mord mit Notwehr. Andererseits zögert man, auch weil der Begriff des Krimis in der Praxis seiner Verwendung so weit herabgesunken ist, dass er vor allem die populären Ausprägungen des Genres meint. Deshalb ist beispielsweise Tatort-Kommissar Felix Murot, gespielt von Ulrich Tukur, so umstritten. Vor allem jene, die Entspannung durch Spannung suchen und erwarten, dass gängige Muster des Genres bedient werden, fühlen sich überfordert. Angriff auf Wache 08 von 2019 beispielsweise (Regie Thomas Stuber, mit ihm gemeinsam schrieb Schriftsteller Clemens Meyer das Drehbuch) hatte am 24.08.2019 Premiere auf dem Festival des deutschen Films – unüblich für eine Fernsehproduktion (Angriff auf Wache 08 2019).
Die grundlegenden Fragen danach, was das Genre ausmacht, sind alles andere als neu. Ein Beispiel für die Wirkmacht von Tradierungen: Für die Forschung steht offenbar fest, dass das Genre mit Edgar Allan Poes Murders in The Rue Morgue (Die Morde in der Rue Morgue) beginnt (vgl. z.B. Scaggs 2005, 7; Düwell 2018, 286), obwohl in der deutschsprachigen Literatur bereits mit Friedrich Schillers Der Verbrecher aus verlorener Ehre eine bahnbrechende und zentrale Kriminalerzählung vorliegt und mit E.T.A. Hoffmanns Das Fräulein von Scuderi wenige Jahrzehnte später eine Detektiverzählung (vgl. Bloch 1998, 40), die modern genug ist, um beispielsweise von ihr eine Brücke zu den Romanen um den Detektiv Brenner von Wolf Haas zu schlagen (zu möglichen weiteren Beispielen vgl. die Auswahl in Hamann 2016).
Dass es sich um eine international konventionalisierte Genregeschichte handelt, macht die, wenn auch in jüngerer Zeit monierte (z.B. Beck 2014, 33), Brüchigkeit der Argumentation nicht plausibler. So beginnt Richard Bradfords außerordentlich kundige Einführung in das Genre mit dem Hinweis auf Vorläufer wie Sophokles’ König Ödipus, Herodots Rhampsinit und der Meisterdieb oder Shakespeares Hamlet (Bradford 2015, 1), wobei es sich hier auch um Dramen handelt.
Reclams Kriminalromanführer verortet „die anscheinend erste Detektivgeschichte der Weltliteratur“ 1679 in China und spart die englische gothic novel des 18. Jahrhunderts nicht aus (vgl. Arnold/Schmidt 1978, 43). In einer Liste der ‚hundert lesenswerten Krimis‘ kommen allerdings weder Schillers noch Hoffmanns Erzählungen vor, ebenso fehlt Fontanes Unterm Birnbaum. Dafür finden sich ganze neun Titel von Sir Arthur Conan Doyle, aber nur zwei von Agatha Christie (vgl. Arnold/Schmidt 1978, 403ff.), die (wie eingangs festgestellt) mehr Kriminalromane verkauft hat als jede*r andere Krimiautor*in. Folgende Schlussfolgerung liegt nahe: Jede Auswahl in einer Einführung kann nur eine sehr subjektive sein.
Bradford erwähnt Schillers Verbrecher aus verlorener Ehre und E.T.A. Hoffmanns Das Fräulein von Scuderi (Bradford 2015, 70f.), er betont sogar die wegweisenden...
| Erscheint lt. Verlag | 15.2.2021 |
|---|---|
| Verlagsort | Stuttgart |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Geisteswissenschaften ► Sprach- / Literaturwissenschaft |
| Schlagworte | Agatha Christie • Alfred Hitchcock • Classroom-Management • Diagnostik • Didaktik in der Sonderpädagogik • Dorothey L. Sayers • Edgar Allan Poe • Emil und die Detektive • Erich Kästner • Erzählung • E.T.A. Hoffmann • Exklusion • Förderschulen • Friedrich Dürrenmatt • Fritz Lang • Gattung • Genre • Hercule Poirot • Ian Fleming • Inklusion • Intervention • James Bond • John Schlesinger • Kenneth Branaghs Dead Again • Krimi • Krimibestenlisten • Krimiliteratur • Kriminalerzählung • Kriminalfilm • Kriminalroman • Lehrbuch • lerntheoretische Didaktik • Literaturwissenschaft • Literaturwissenschaft studieren • marathon man • Nele Neuhaus • Raymond Chandler • Resilienz • schülerfokusierte Konzepte • schulische Inklusion • Schulische Integration • Sherlock Holmes • Sir Arthur Conan Doyles • Sonderpädagogische Diagnostik • Sonderschulen • Soziale Kompetenzen • Unterrichtskonzept • Vulnerabilität |
| ISBN-10 | 3-8463-5556-9 / 3846355569 |
| ISBN-13 | 978-3-8463-5556-5 / 9783846355565 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 5,7 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich