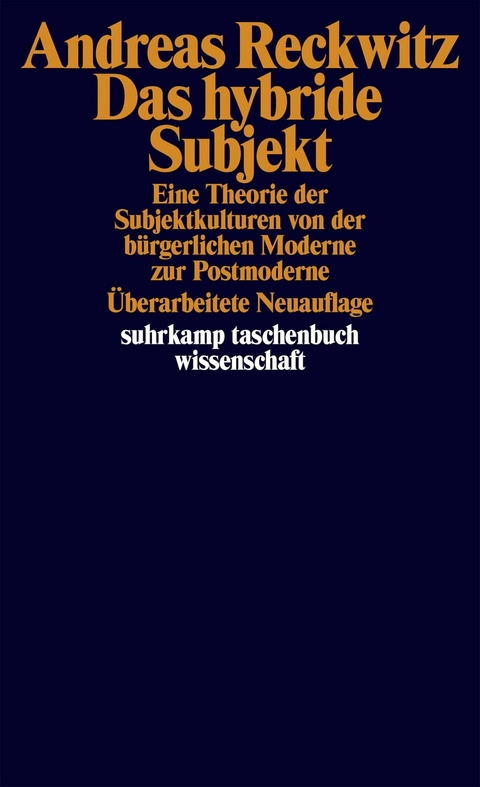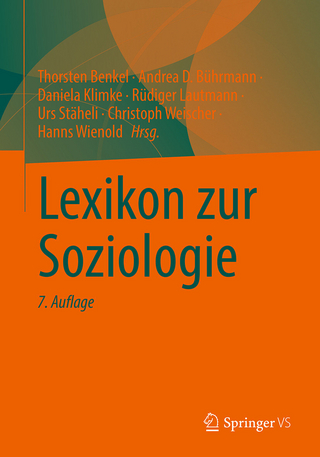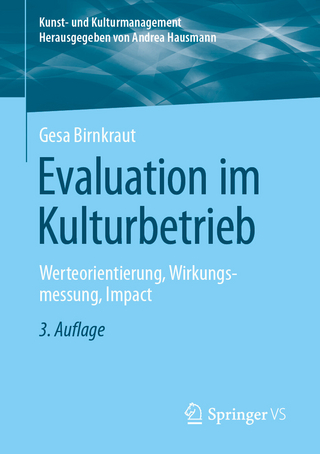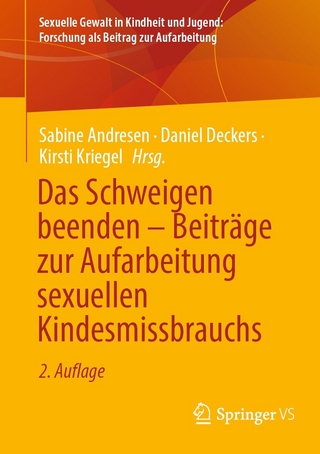Das hybride Subjekt (eBook)
709 Seiten
Suhrkamp Verlag
978-3-518-76358-2 (ISBN)
In welche Richtung formt die moderne Gesellschaft den Menschen? In welcher Weise wird das moderne Individuum »subjektiviert«? In seinem grundlegendem Buch, das thematisch in einer Reihe mit Die Erfindung der Kreativität und Die Gesellschaft der Singularitäten steht, unternimmt Andreas Reckwitz eine Tour de Force durch die Kultur- und Sozialgeschichte des Westens vom 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart und beleuchtet die widersprüchlichen Anforderungen zwischen Selbstdisziplinierung, Selbstdarstellung und Selbstverwirklichung, denen das moderne Subjekt gegenübersteht. Am Ende wird deutlich: Das Subjekt der postmodernen Gegenwart ist ohne die Geschichte der Bürgerlichkeit und ohne die kulturellen Bewegungen von der Romantik bis zur Counter Culture der 1960er Jahre nicht zu verstehen. Innere Balance findet es freilich genauso wenig wie seine historischen Vorläufer.
Andreas Reckwitz, geboren 1970, ist Professor für Allgemeine Soziologie und Kultursoziologie an der Humboldt-Universität zu Berlin und war Fellow im Thomas Mann House in Los Angeles. Sein Buch <em>Die Gesellschaft der Singularitäten</em> wurde 2017 mit dem Bayerischen Buchpreis ausgezeichnet und stand 2018 auf der Shortlist des Sachbuchpreises der Leipziger Buchmesse. 2019 erhielt er den Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft.
7Vorwort zur Neuauflage
Vierzehn Jahre nach seiner Erstveröffentlichung erscheint Das hybride Subjekt nun als Taschenbuch. Diese Gelegenheit, für die ich dem Suhrkamp Verlag danke, habe ich genutzt, um auf formaler und darstellerischer Ebene einiges zu verändern. Zum einen habe ich in allen Kapiteln Kürzungen vorgenommen, insbesondere dort, wo in der Erstausgabe einzelne Erläuterungen sehr detailliert ausgefallen sind. Zum anderen hat es eine ganze Reihe von stilistischen Glättungen und Vereinfachungen sowie Anpassungen von Zeichensetzung, Rechtschreibung und anderen Formalien gegeben.[1] In seiner generellen Argumentation wie auch in den inhaltlichen Details seiner Analyse ist das Buch jedoch unverändert.[2]
Meine Forschungen zu Kultur und Gesellschaft der Moderne waren mit Das hybride Subjekt nicht zum Abschluss gekommen. 2012 ist das Buch Die Erfindung der Kreativität erschienen, 2017 Die Gesellschaft der Singularitäten.[3] Grundsätzlich gilt: Jedes die8ser Bücher hat sich aus dem jeweils vorangegangen entwickelt, obwohl jedes als eigenständige Untersuchung zu verstehen ist. In ihrer Fragestellung und ihrer Argumentation hängen die drei Bände miteinander zusammen, zugleich sind sie jedoch nicht bewusst aufeinander abgestimmt. Bei der Arbeit an ihnen ging es mir nicht darum, eine Kontinuität der Argumentationen und Begriffe zu sichern oder einen einmal entwickelten theoretischen Rahmen auf verschiedene Gegenstände anzuwenden. Stattdessen hat zwischen den Büchern die Fragestellung ihren Fokus verschoben, die Argumentation hat sich verändert, und auch manche leitenden Begriffe habe ich im Laufe der Zeit modifiziert. Ich will daher dieses Vorwort dazu nutzen, um das Verhältnis zwischen Das hybride Subjekt auf der einen Seite, Die Erfindung der Kreativität und Die Gesellschaft der Singularitäten auf der anderen Seite zu umreißen.
Alle drei Bücher lassen sich als Beiträge zu einer Kultur- und Gesellschaftstheorie der Moderne verstehen, ein Projekt, das mich in den letzten zwanzig Jahren hauptsächlich beschäftigt hat. Alle drei wenden dabei eine sozialtheoretische Grundbegrifflichkeit an, die den Kern des Sozialen in sozialen Praktiken sieht – und damit auch in Wissensordnungen und Diskursen, in Subjektivierungsweisen und Artefaktsystemen, welche im Kontext dieser Praktiken entstehen oder angewandt werden.[4] Jedes der Bücher geht von einer anderen Leitfrage aus. Die Kernfrage von Das hybride Subjekt lautet: In welcher Weise und aus welchen Gründen hat sich das moderne Subjekt im Laufe der Geschichte der Moderne transformiert? Genauer: Welche in sich widersprüchlichen Subjektordnungen haben die bürgerliche Moderne, die organisierte Moderne und die Postmoderne hervorgebracht, und welche Rolle spielen bei diesem kulturellen Wandel seit der Romantik die ästhetischen Bewegungen? Die Leitfrage von Die Erfindung der Kreativität lautet: In welcher Weise konnte sich im Laufe der Moderne ein sogenanntes Kreativitätsdispositiv entwickeln, das heißt eine Form des Sozialen, die Subjektivität und Sozialität am Maßstab der Produktion des Neuen, vor allem des kulturell und ästhetisch Neuen ausrichtet? 9Und weiter: Welche Struktur hat dieses Kreativitätsdispositiv, und inwiefern forciert es in der Spätmoderne eine Ästhetisierung des Sozialen? Die zentrale Frage von Die Gesellschaft der Singularitäten lautet: Was sind die Grundstrukturen der spätmodernen Gesellschaft? Genauer: In welcher Weise unterscheidet sie sich von der industriellen Moderne, und was sind die Ursachen und Folgen dieses gesellschaftlichen Wandels? Und weiter: Inwiefern ist die Spätmoderne von einer Dialektik zwischen Singularisierung und Entsingularisierung sowie zwischen Valorisierung (Kulturalisierung) und Entwertung gekennzeichnet?
In der Art und Weise, wie diese Fragen angegangen werden, gehen die drei Bücher verschiedene Wege. Das hybride Subjekt nimmt grundsätzlich die Form einer historisch-systematischen Kulturtheorie an. Material aus geschichtswissenschaftlichen, kulturwissenschaftlichen und soziologischen Einzelanalysen habe ich hier in synthetisierender Absicht ausgewertet, und das Ziel ist es, die kulturellen Strukturen herauszuarbeiten, welche die Subjektivierungsweise in den einzelnen historischen Phasen und Bewegungen prägen. Über den Weg der Untersuchung der Subjektformen sollen die miteinander konkurrierenden Wissensordnungen, gewissermaßen die elementaren »Codes« der Kultur der Moderne, vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart herausdestilliert werden. Diese reichen von der Selbstdisziplinierung und der Souveränität der Bürgerlichkeit und der Selbstentfaltung in der Romantik bis hin zum Unternehmertum und der Kreativität in der Postmoderne. Damit werden auch ein systematischer Vergleich der einzelnen Phasen – die bürgerliche Moderne des späten 18. und des 19. Jahrhunderts, die organisierte Moderne großer Teile des 20. Jahrhunderts, schließlich die Postmoderne, die sich seit den 1980er Jahren anbahnt –, ein Vergleich mit den und zwischen den wirkungsmächtigen kulturellen Gegenbewegungen (die Romantik um 1800, die Avantgarden um 1900, die Counter Culture um 1970) sowie eine Untersuchung der Einflüsse und der Brüche zwischen diesen einzelnen Versionen der Kultur der Moderne möglich.
Die Erfindung der Kreativität knüpft in mancher Hinsicht unmittelbar an Das hybride Subjekt an. Wie sich dort am Ende herausstellte, bildet Kreativität einen Leitwert der spätmodernen Kultur, der von den ästhetisch-künstlerischen Bewegungen seit der Romantik motiviert ist. In der spätmodernen Kreativitätskultur ist die 10ehemalige Gegenkultur aber selbst in den Mainstream eingesickert, und die Frage lautet, auf welchem Weg dieser gesellschaftliche Prozess der Diffusion und »Umwertung« geschehen konnte und welche Auswirkungen er hat. Grundsätzlich verknüpft Die Erfindung der Kreativität die Perspektive einer historischen Genealogie mit Ansätzen zu einer Theorie der spätmodernen Gesellschaft. Die Genealogie fragt weniger nach dem Warum als nach dem Wie, das heißt, sie fragt danach, über welchen Pfad in der Geschichte das Unwahrscheinliche wahrscheinlich und real werden, in welchen verstreuten Kontexten das Marginale allmählich Dominanz erlangen konnte. Die Erfindung der Kreativität folgt somit in einzelnen sehr konkreten Kontexten den Spuren der Herauskristallisierung des Kreativitätsdispositivs, insbesondere im Verlauf des 20. Jahrhunderts: So geht das Buch im Detail auf die Ausbildung des Kunstfeldes und dessen Weiterentwicklung mit den Avantgarden und dem Postmodernismus, auf die Wandlungen im Managementdiskurs und die Entstehung der creative industries, die Transformation der Psychologie, die Entstehung eines medialen Starsystems und schließlich den Wandel der Stadtplanung in Richtung eines Modells der creative cities ein. Am Ende werden so Umrisse und Widersprüche des Kreativitätsdispositivs als spätmoderne Signatur deutlich. Dieses Dispositiv hat die Form eines radikalisierten Regimes des kulturell Neuen und wird damit zum Motor des gesellschaftlichen Ästhetisierungsprozesses, der die Spätmoderne insgesamt prägt.
Die Gesellschaft der Singularitäten nimmt diesen Faden einer Theorie der spätmodernen Gesellschaft auf und rückt – losgelöst von der historischen Genealogie – die gesellschaftstheoretische Frage nach der speziellen Form der Spätmoderne ins Zentrum der Betrachtung. Diese Spätmoderne löst seit den 1970er Jahren allmählich die organisierte oder industrielle Moderne ab, die das 20. Jahrhundert zunächst beherrschte, und wird spätestens seit den 1990er Jahren dominant. Die Gesellschaft der Singularitäten nimmt Elemente aus beiden vorangegangenen Büchern auf, das Buch setzt aber breiter und grundsätzlicher an. Breiter ist es insofern angelegt, als die neuen Strukturen in der kapitalistischen Ökonomie (Postindustrialismus und kognitiv-kultureller Kapitalismus) – sowie im Bereich der Technologien (die Digitalisierung) – die neue Sozialstruktur und ihre Lebensformen (eine Drei-Klassen-Gesellschaft mit dem Schlüsselmilieu der neuen, akademischen Mittelklasse) sowie die neuen 11Strukturen im politischen Feld (der Konflikt zwischen Liberalismus und Kulturessenzialismus) ...
| Erscheint lt. Verlag | 21.6.2020 |
|---|---|
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sozialwissenschaften ► Soziologie |
| Schlagworte | Bayerischer Buchpreis 2017 • Das politische Buch 2025 • Individuum • Leibniz-Preis 2019 • Moderne • Singularität • Soziologie • STW 2294 • STW2294 • Subjekttheorie • suhrkamp taschenbuch wissenschaft 2294 |
| ISBN-10 | 3-518-76358-X / 351876358X |
| ISBN-13 | 978-3-518-76358-2 / 9783518763582 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 2,2 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich