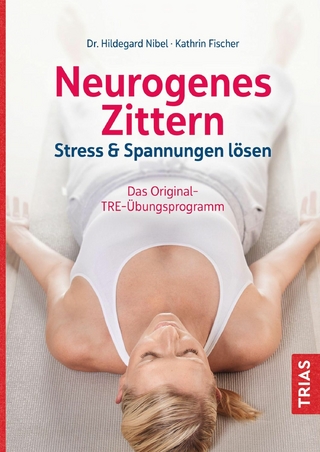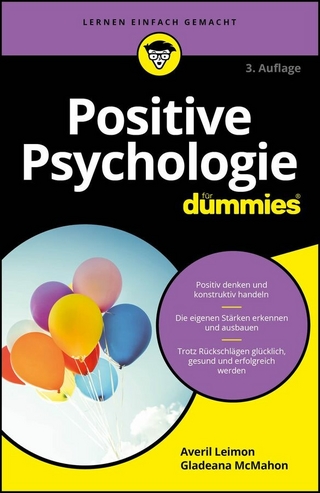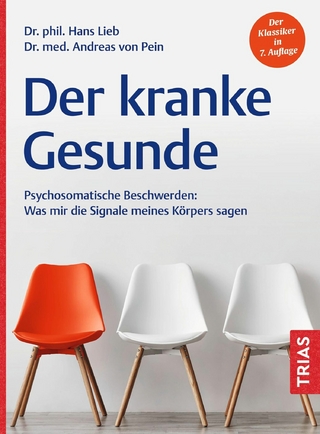Jenseits von Nichts und Leere: Das Geheimnis des Urgrunds (eBook)
144 Seiten
Crotona Verlag
978-3-86191-191-3 (ISBN)
Seit Anbeginn der Zeiten haben die größten Geister der Menschheit versucht, den „Urgrund“, das „Absolute“ oder die „Gottheit“ gedanklich und sprachlich zu fassen. Auch wenn dieses Unterfangen vielleicht in letzter Konsequenz - aufgrund der Endlichkeit des Menschen - zum Scheitern verurteilt ist, so hat es doch einige der tiefsten Einsichten über das SEIN hervorgebracht.
Daniel Matt gelingt es auf meisterhaft Weise, in diese „Abgründe der Transzendenz“ hineinzuschauen und aufzuzeigen, wo die Grenzen des menschlichen Erkennens liegen - und was jenseits davon demütig erahnt werden darf.
Eine Reise an den Anbeginn der Schöpfung, die deutlich macht, was gewusst werden kann - und was nicht!
I
Mystiker kontemplieren über die Leere, aber nicht in einem Vakuum. Die Kabbalisten wurden nicht nur von jüdischen Philosophen, sondern direkt oder indirekt auch von heidnischen und christlich-neuplatonischen Denkern beeinflusst: Plotin, Pseudo-Dionysius und Johannes Scotus Eriugena. Philon, den mystischen Philosophen, der am Übergang vom ersten vor- zum ersten nachchristlichen Jahrhundert lebte, kannten die Kabbalisten zwar nicht, doch er war es, der die Idee der Unkennbarkeit und Unbeschreibbarkeit Gottes einführte. Mit seiner Betonung der Unähnlichkeit Gottes mit Dingen in der Welt ebnete Philon der negativen Theologie den Weg. „Gott allein hat wahres Sein. … Dinge nach ihm haben kein wirkliches Sein, sondern gelten als nur in der Vorstellungskraft existierend.“3 Das Ziel religiösen Lebens ist es, die scheinbare Wirklichkeit der Welt zu durchschauen und das Bewusstsein von einem gesonderten Selbst abzulegen. „Dies ist der natürliche Verlauf: Einer, der sich vollständig versteht, lässt das Nichts, das er in aller Schöpfung erkennt, vollständig los, und wer sich selbst loslässt, lernt das Seiende kennen.“4 Zu den großen Mysterien gehört der Gegensatz zwischen der Macht „des Unerschaffenen und dem gewaltigen Nichts des Erschaffenen“.5
Philons Nichts (oudeneia) bezieht sich auf die Unwirklichkeit der Schöpfung angesichts der einzig wahren Wirklichkeit, des Göttlichen. Hier hat das Nichts rein negative Qualität; es bezeichnet ein fundamentales Nichtvorhandensein. Angesichts der überwältigenden Entdeckung, dass alles Ausdruck des Göttlichen ist, bricht Schöpfung als selbstständige Entität in sich zusammen und wird auf nichts reduziert. Durch die Kontemplation dieser grundlegenden Tatsache wird man in die Gegenwart Gottes entrückt. „Denn dann ist die rechte Zeit für das Geschöpf, zu seinem Schöpfer hinzutreten, wenn es seine eigene Nichtigkeit erkannt hat.“ Das Ideal lautet, zu lernen, „seine eigene Nichtigkeit zu ermessen“.6
Gott ist unermesslich, namenlos und unaussprechlich. In dieser Hinsicht lässt Philon die Gnostiker vorausahnen, die ihn zum Teil in ihrem Gebrauch negativer Sprache gegenüber Gott noch übertreffen. Der gnostische Gott ist – im Gegensatz zum schöpferischen Demiurgen – vollkommen anders, der andere, Unbekannte. Er ist der „Unbegreifliche, Undenkbare, der über jedes Denken erhaben ist“, „unaussprechlich, unausdrückbar, zu nennen durch Schweigen“.7 In dem Versuch, seine Vorgänger in negativer Theologie noch zu übertreffen, lehnt der alexandrinische Gnostiker Basilides aus dem 2. Jahrhundert sogar den Begriff „unaussprechlich“ als Prädikat Gottes ab. Seine Worte sind durch Hippolyt von Rom erhalten, der ihn in seiner Streitschrift gegen diverse damals vorherrschende Häresien zitiert: „Das, was [unaussprechlich] genannt wird, ist nicht absolut unaussprechlich, da wir das eine als unaussprechlich und das andere als noch nicht einmal unaussprechlich bezeichnen. Denn das, was noch nicht einmal unaussprechlich ist, wird nicht unaussprechlich genannt, sondern ist über jeden Namen, der genannt wird, erhaben.“8
Gott übersteigt die Möglichkeiten der menschlichen Sprache und die Kategorie des Seins. Basilides spricht vom „namenlosen, nichtseienden Gott“. Diese Negation wird in einer weiteren gnostischen Abhandlung, dem Allogenes, erklärt: „Auch ist er nicht etwas, das vorhanden ist, und das einer begreifen kann, sondern [er existiert] so, dass er vielmehr etwas anderes, Besseres ist, etwas, von dem es nicht möglich ist, dass es einer begreift. … Ihm ist zu eigen … nichtseiende Existenz.“9
Nichtsein beschreibt Gottes unbegreifliches Anderssein am besten. Für Basilides ist ein anderes, aber damit verwandtes Nichtsein auch der Ursprung der Schöpfung:
Der nichtseiende Gott schuf den Kosmos aus dem Nichtseienden, indem er einen einzigen Samen herabwarf, der in sich die gesamte Samenmasse des Kosmos enthielt. … Der nichtseiende Same des Kosmos, herabgeworfen vom nichtseienden Gott, enthielt eine Samenmasse, die zugleich vielgestaltig und der Ursprung vieler Wesen war. Der Same des Kosmos entstand aus nichtseienden Dingen [und dieser Same ist] das Wort, das gesprochen wurde: „Es werde Licht!“10
Basilides bietet damit eine extreme Formulierung der creatio ex nihilo, der Schöpfung aus dem Nichts, einer Theorie, deren mystische Entwicklung sich mit der negativen Theologie verflicht. In hellenistischer Zeit galt gemeinhin die Auffassung, dass es sich bei dem Stoff, aus dem die Welt besteht, um amorphe Hyle, formlose Materie, handelt. Thales und Parmenides hatten gelehrt, dass nichts aus Nichtseiendem entstehen kann, und Aristoteles schreibt: „So ziemlich allen nämlich, die sich mit Naturphilosophie beschäftigen, ist der Satz geläufig, dass nichts aus nicht Seiendem, jegliches aus Seiendem wird.“ Bis zur Entstehung des Christentums gab es offenbar keinen griechischen, römischen oder jüdisch-hellenistischen Denker, der die Schöpfung aus dem Nichts vertrat.11
Die Theorie der creatio ex nihilo taucht zum ersten Mal in der christlichen Literatur des 2. Jahrhunderts auf, hervorgerufen durch die Auseinandersetzung mit gnostischer Häresie und griechischer Philosophie. Sie stellt eine Ablehnung der vorherrschenden platonischen Auffassung von der Schöpfung aus ewiger Urmaterie dar, einer Idee, welche die Souveränität Gottes beeinträchtigt. So schreibt Augustinus: „Nichts hieltest du in der Hand, damit du hättest Himmel und Erde schaffen können.“ Theophilus, Bischof von Antiochia, betont, wenn Gott die Welt aus unerschaffener Materie gemacht hätte, wäre er nicht größer als ein Mensch, der etwas aus vorhandenen Materialien herstellt.12 Tatsächlich könnte die Formulierung creatio ex nihilo als Entgegnung auf das philosophische Prinzip nihil ex nihilo fit geprägt worden sein, demzufolge nichts aus nichts erschaffen wird. Ebenso fühlten sich christliche Denker herausgefordert, die Gnostiker zu widerlegen, die andere Mächte neben Gott gestellt hatten und behaupteten, eine davon habe die Welt erschaffen. (Dass Basilides die Schöpfung offenbar dem verborgenen Gott zuschreibt, ist für einen Gnostiker ungewöhnlich.) Die creatio ex nihilo lieferte eine Rechtfertigung für den Glauben an einen einzigen freien und transzendenten Schöpfer, der von nichts abhängig ist. Sie wurde zum Paradigma für Gottes Wunderkraft und diente als wesentliche Untermauerung der übernatürlichen Auffassung vom Göttlichen. Sie zu bestreiten, war gleichbedeutend mit einer Aushöhlung der offenbarten Religion. Mit den Worten von Moses Maimonides: „Wenn [die Philosophen] die Meinung Aristoteles‘ [von der Ewigkeit] durch einen Beweis bestätigt fänden, [müsste] unsere Heilige Schrift in ihrer Gänze zusammenfallen.“13
Wenn überhaupt, so gibt es nur sehr wenige Anhaltspunkte dafür, dass die normative rabbinische Ansicht die der creatio ex nihilo war.14 Die Stelle aus dem Sefer Jezira (dem „Buch der Schöpfung“), die später als Ausdruck des ex nihilo instrumentalisiert wurde, ist mehrdeutig: „Er bildete aus tohu [Chaos] Substanz und machte das Nichtseiende [eino] zum Seienden [yeshno]. Er meißelte die großen Säulen aus der Luft, die niemand greifen kann.“15 Das Sefer Jezira wurde zwischen dem 3. und 6. Jahrhundert erstellt. Zum ersten Mal in der hebräischen Literatur wird hier die Schöpfung aus Ayin oder vielmehr dem adverbiellen eino erwähnt. Das Substantiv Ayin erscheint in einem ontologischen Sinne erst viel später. „Das Nichtseiende“ bezieht sich hier aber wohl auf Hyle, Urmaterie, welche die Platoniker als „das Nichtseiende“ (to me on) bezeichneten.16 Intendiert wäre damit nicht das absolute Nichts, sondern vielmehr das, was noch nicht geformt ist oder dem noch keine Eigenschaften verliehen sind.
Auch wenn die Lehre von der creatio ex nihilo nicht ursprünglich jüdisch war, fand sie unter dem Einfluss christlicher und muslimischer Denker doch Eingang in jüdische philosophische und religiöse Kreise. Die Wendung yesh me-ayin („etwas aus nichts“) wurde zur Beschreibung des Schöpfungsprozesses, wenngleich die Theorie sowohl weniger verehrt wurde als auch theologisch weniger bedeutend war als im christlichen Denken. Die Schöpfung aus dem Nichts wurde von Maimonides übernommen, doch er weist darauf hin, dass diverse unklare Stellen in der Thora die Gültigkeit der platonischen Theorie zu beweisen scheinen. Dem Philosophen Joseph Albo zufolge ist die Ablehnung von yesh me-ayin zwar irrig, macht einen jedoch nicht der Häresie schuldig.17
Die ex-nihilo-Theorie kollidierte unweigerlich mit der Emanationstheorie von Plotin, einem Meister der negativen Theologie, dessen Gott ohne Willen erschafft. Plotin lehnt die biblische Theorie einer absichtlichen Schöpfung ab. Alles, was existiert, geht in einem abgestuften, aber ewigen Emanationsprozess aus dem Einen hervor, und alles strebt danach, zu dem Einen zurückzukehren.
Die Verneinung führt Plotin als eine Art göttlicher Eigenschaft ein und nimmt sie in eine formelle Klassifizierung auf. Er wendet die Technik der Aphairese (Wegnahme oder Abstraktion) an, um Prädikate Gottes zu negieren, was nicht heißt, dass ihr Gegenteil ausgesagt werden könnte, sondern dass Gott von diesem Bereich des...
| Erscheint lt. Verlag | 28.6.2020 |
|---|---|
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Gesundheit / Leben / Psychologie ► Esoterik / Spiritualität |
| Geisteswissenschaften | |
| ISBN-10 | 3-86191-191-4 / 3861911914 |
| ISBN-13 | 978-3-86191-191-3 / 9783861911913 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 196 KB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich