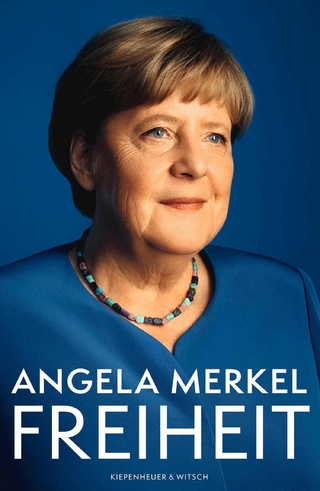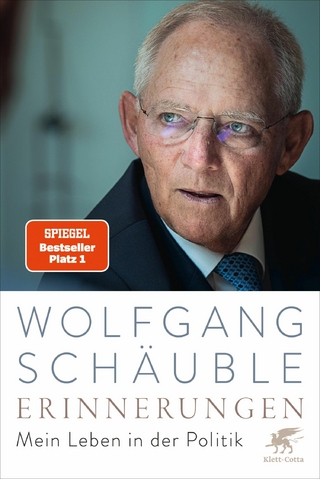Kein Roman (eBook)
432 Seiten
Penguin Verlag
978-3-641-23422-5 (ISBN)
Jenny Erpenbeck versammelt in diesem Band neben bisher nicht publizierten autobiografischen Texten verschiedenste Beiträge und Reden zu Literatur, Kunst, Musik und Politik. Was ihr am Werk anderer Anregung ist, wo sie anknüpft, wozu sie sich bekennt, erfahren wir in Texten zu Wagners »Götterdämmerung«, zum Werk Thomas Manns, Heimito von Doderers oder der Brüder Grimm. In diesem parallel zu den Romanen entstandenen essayistischen Werk reflektiert sie auch ihr eigenes Schreiben und Leben und gibt so Einblick in ihre Gedankenwelt und die Hintergründe ihres künstlerischen Schaffens.
Jenny Erpenbeck, geboren 1967 in Ost-Berlin, debütierte 1999 mit der Novelle »Geschichte vom alten Kind«. Es folgten zahlreiche Veröffentlichungen, darunter Romane, Erzählungen und Theaterstücke. Von Publikum und Kritik gleichermaßen gefeiert, wurde sie vielfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Thomas-Mann-Preis, dem Uwe-Johnson-Preis, dem Hans-Fallada-Preis und dem Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland. Auch international gilt Erpenbeck als wichtige literarische Gegenwartsautorin. So wurde sie u.a. mit dem britischen Independent Foreign Fiction Prize (inzwischen bekannt als International Booker Prize) und dem italienischen Premio Strega Europeo geehrt. Ihr Roman »Heimsuchung« wird vom Guardian auf der Liste der »100 Best Books of the 21st Century« geführt. Die amerikanische Übersetzung ihres jüngsten Romans »Kairos« war in den USA für den National Book Award nominiert und wurde 2024 mit dem International Booker Prize ausgezeichnet. Erpenbecks Werk erscheint in über 30 Sprachen.
WO DIE WELT ZU ENDE IST
Nichts Schöneres für ein Kind, als da aufzuwachsen, wo die Welt zu Ende ist. Da gibt es nicht viel Verkehr, der Asphalt ist für die Rollschuhe da, und die Eltern müssen sich keine Gedanken um herumschweifende Bösewichter machen. Was will ein Bösewicht in einer Sackgasse.
Die Wohnung, von der aus ich zum ersten Mal auf eigenen Füßen auf die Straße hinuntergehe, liegt im zweiten Geschoß eines prächtigen alten Mietshauses mit prächtig abblätterndem Putz, verglasten Erkern, einer riesigen doppelflügligen Eingangstür und einer hölzernen Treppe, das Ende des Handlaufs mündend in ein blankgegriffenes Ungeheuer. Florastraße 2A, Florastraße 2A, Florastraße 2A. Die ersten Worte nach Mama und Papa sind dieser Straßenname und diese Hausnummer. Damit ich, falls ich verlorengehe, immer sagen kann, wo ich hingehöre. Florastraße 2A. Hockend im Treppenhaus dieses Hauses lerne ich, wie man eine Schleife zubindet. Gleich um die Ecke, in der Wollankstraße, befindet sich der Bäckerladen, in dem ich, vier- oder fünfjährig, zum ersten Mal in meinem Leben allein einkaufen darf, von meinen Eltern hinuntergeschickt mit Beutel und abgezählten Talern für die Brötchen zum Frühstück. Der Bäckerladen hat geschnitzte Regale und eine Kasse, bei der die Verkäuferin, bevor sie das Geld hineingibt, an einer Kurbel dreht. Wenn die Schublade aufgeht, klingelt es. Die Wollankstraße endet ein paar hundert Meter weiter sehr plötzlich an einer Mauer. Dort ist die Endhaltestelle der Buslinie 50. Meine Eltern müssen sich keine Gedanken um herumschweifende Bösewichter machen, was will ein Bösewicht in einer Sackgasse. Damals werde ich allein auf den Hof zum Buddeln geschickt, eine große Tanne wirft Schatten auf meinen Buddelkasten, und wenn das Essen fertig ist, ruft meine Mutter aus dem Fenster. Im ersten Stock unseres Hauses ist eine Tanzschule, von dort hört man bis auf den Hof hinunter ein Klavier klimpern und die Anweisung der Lehrerin für die Schritte.
Hinter der Mauer, an der die Wollankstraße damals für mich zu Ende ist, fährt die S-Bahn. Sie fährt nach links und nach rechts, aber beide Richtungen kommen für uns nicht in Frage. Eine S-Bahn-Station weiter links, aber auch auf unserer Seite der Mauer, wohnen meine Großmutter mit ihrem Mann und meine Urgroßmutter zusammen in einer Zweizimmerwohnung im dritten Hinterhof eines Berliner Hauses. Eigentlich ist das Haus ein Eckhaus. Von der anderen Seite betreten, würde die Wohnung im Vorderhaus sein. Aber seit diese andere Seite zum Grenzstreifen erklärt worden ist, endet die begehbare Straße kurz vor der Ecke sehr plötzlich an einer Mauer. In diesem Viertel, in dem das Mietshaus meiner Großmutter und meiner Urgroßmutter steht, ist immer Winter. Wenn ich die Schneeflocken vor dem grünlichen Licht der Straßenlaterne ansehe, wird mir schwindlig, Kohlen werden aus dem Keller geholt, der Boden des dritten Hinterhofs ist mit Beton ausgegossen, und um die Aschetonnen herum, die dort stehen, sind Schnee oder Pfützen immer schäbig und rötlich. Gebadet wird in diesem Haushalt nur einmal pro Woche, denn dafür muss der Badeofen geheizt werden. Das winzige Fenster zum Lüften des Badezimmers öffnet man mit einer mir unendlich lang scheinenden Metallstange, die oberhalb der Toilette zu greifen ist. Sie führt über die Speisekammer hinweg, die von der Küche her abgeteilt ist, durch einen hochgelegenen Tunnel bis zu diesem mir niemals sichtbaren winzigen Fenster. In der Küche steht auf dem Boden eine große, bauchige Flasche mit gärendem Traubensaft, aus dem Wein werden soll, aber manchmal wird daraus Essig. Auf dem Küchenbuffet sehe ich ein Einweckglas mit Blutegeln, die meine Großmutter sich wegen Thrombosegefahr selbst ansetzen muss. Wenn ich das Birnenkompott auslöffele, das es als Nachspeise gibt, blicke ich mit leichter Beunruhigung auf die Egel und den Verschluss dieser Gläser. Das Geschirr wäscht meine Großmutter nicht unter fließendem Wasser ab, sondern in zwei Schüsseln, die sie wie Schubladen aus dem Küchentisch zieht. Im Schlafzimmer meiner Urgroßmutter, wo auch ich schlafe, wenn ich dort übernachte, tickt meine ganze Kindheit hindurch eine lackierte hölzerne Uhr mit goldenen Ziffern. In diesem Zimmer, das nie geheizt wird, bewahrt meine Urgroßmutter ihren Pepsinwein auf, und im Fenster des Ofens ihr Strickzeug. In dieses Ofenfach, neben das Strickzeug, legt sie vor dem Zubettgehen, nachdem sie ihren Haarknoten gelöst hat, auch die Nadeln aus ihrem Haar, dann fällt ein langer, grauer Zopf bis auf ihren Rücken hinab. Wenn ich vom Schlafzimmer oder auch vom Wohnzimmer hinunter blicke auf die Straße, die keine Straße mehr ist, kann ich die patrouillierenden Soldaten beobachten, oder die in Sichtweite nach links oder rechts fahrenden S-Bahnen zählen. Den Sandweg sehe ich, die Neonleuchten, die Schneeflocken vor dem grünlichen Licht, dann die Spanischen Reiter, die Wachtürme und die Mauer, dahinter die Schienen, hinter den Schienen Kleingärten, und hinter den Kleingärten ein riesiges Gebäude mit vielen Fenstern, das vielleicht eine Schule ist, vielleicht auch eine Kaserne. In dem Haus, in dem meine Großmutter mit ihrem Mann und ihrer Mutter wohnt, riecht es, wenn ich sonntags komme, immer nach Schweinebraten, Dampfkartoffeln und Blumenkohl, es kann sein, dass es der Schweinebraten, die Dampfkartoffeln und der Blumenkohl sind, die meine Großmutter zubereitet hat, aber es können auch die der Nachbarn sein. Das weiß man nie.
Kurz bevor ich eingeschult werde, ziehen wir um, in die Leipziger 47. Ein blauweiß gewürfeltes Hochhaus-Doppel, 23 Etagen das unsere, 26 Etagen das Nebenhaus. Das erste fertige Haus in der großen sozialistischen Magistrale, von der man heute sagen würde, sie führe auf den Potsdamer Platz zu. Damals führt die Leipziger Straße nicht auf den Potsdamer Platz zu, sondern ist kurz vor dem Potsdamer Platz, nämlich dort, wo die Mauer einen Knick macht, sehr plötzlich beendet. Links von unserem Haus ist also der Westen, und weiter vorn, dort, wo die Mauer den Knick macht, ist auch der Westen, kurz vorher hat die Buslinie 32 ihre Endhaltestelle. Das kenne ich schon von der Wollankstraße in Berlin-Pankow. Manches andere kenne ich nicht von Pankow. In der Leipziger Straße gibt es, als wir einziehen, nur unser Haus, eine Kaufhalle, eine Schule, zwei vom Krieg schwer beschädigte Häuser, und sonst gar nichts. Im Pankower Bürgerpark habe ich Fahrradfahren gelernt, im Schlosspark die Enten gefüttert, in der Schönholzer Heide das Herbstlaub mit den Füßen vor mir hergeschoben beim sonntäglichen Spaziergang. Jetzt ist ringsum Schlamm. Mein Weg zur Schule im Schlamm der Großbaustelle, mein Weg zur Kaufhalle im Schlamm der Großbaustelle, mein Weg zum Klavierunterricht im Schlamm der Großbaustelle. Im Schlamm finde ich einen Zwanzigmarkschein, grün. Hätte ich ihn nicht im Schlamm gefunden, ein Wunder!, wüsste ich längst nicht mehr, wie damals ein Zwanzigmarkschein aussah. Der Sonntagsspaziergang führt uns in die kleinen Straßen, die in Richtung Westen von der Friedrichstraße abzweigen, denn nur dort gibt es Asphalt zum Rollschuhlaufen für mich, der Asphalt ist hellgrau und glatt, und wir können mitten auf der Fahrbahn spazieren, denn Verkehr gibt es hier nicht. Was will ein Autofahrer in einer Sackgasse.
Die Häuser wachsen und füllen sich mit Menschen, darunter Kindern, die meine Schulfreunde werden. Wenn meine Freundin verschläft, im Haus gegenüber, sehen wir zwischen unzähligen hellen Würfelchen das dunkelgebliebene Fenster in Zeile sieben und rufen an, um sie zu wecken. Der Aufbau des Sozialismus ist für mich immer mit dieser Baustelle, auf der ich wohne, verknüpft. Links von unserem Haus steht das Hochhaus des Springer-Verlags, allerdings hinter der Mauer, gespiegelt an ihr wie ein verfeindeter Zwilling. Und weiter vorn Richtung Knick, etwa auf Höhe meines Schulhofs, ist jenseits der Mauer die obere Hälfte eines Gebäudes zu sehen, an dem außer zwei leuchtenden Buchstaben in Schreibschrift, auch eine leuchtende Zeitanzeige angebracht ist. Meine ganze Schulzeit über lese ich die Zeit für mein sozialistisches Leben von dieser Uhr in der anderen Welt ab.
Wir wohnen im dreizehnten Stock. Im dreizehnten Stock fragt sich ein Kind so manches, zum Beispiel, ob es wohl möglich wäre, auf der Balustrade des Balkons zu balancieren. Ich entscheide mich aus Gründen, an die ich mich heute nicht mehr erinnere, knapp dagegen. Wenn ich meinen Wohnungsschlüssel vergessen habe und meine Mutter noch nicht zu Haus ist, stehe ich am Fenster des Etagenflurs, das nach Westen zeigt, warte und zähle zum Zeitvertreib die Doppelstockbusse, die beim Springerhochhaus verkehren. Im Osten gibt es keine Doppelstockbusse. Vom dreizehnten Stock aus habe ich einen guten Überblick. Je nach Tageszeit verkehren sie im Abstand von fünf oder zehn Minuten. Mein Rekord im Warten ist 26. Irgendwann ziehen wir in eine größere Wohnung um, das heißt, wir ziehen in die sechste Etage. Ein so riesiges Hochhaus ist selbst wie eine Stadt, und wenn man die Wohnung tauschen möchte, würfelt man sich einfach ein paar Etagen weiter hinauf oder hinunter und stellt seine Möbel in den Fahrstuhl. In der sechsten Etage zu wohnen, ist nicht nur für mein Überleben von Vorteil, weil der Schwindel an Reiz verliert, es ist auch von Vorteil, dass, wenn alle drei Fahrstühle steckengeblieben sind, das Treppensteigen nicht so lange dauert. Immer, wenn ich in diesem rostrot gestrichenen Treppenhaus, das nach Pisse und Staub riecht, die flachen Stufen aufwärts steige oder abwärts springe, denke ich an den Hinweis unseres Erdkundelehrers, dass wir uns im Falle eines Atomschlags in einem Treppenhaus beim Geländer hinkauern sollen, um uns zu schützen. Während ich in der Leipziger Straße wohne, trifft...
| Erscheint lt. Verlag | 24.9.2018 |
|---|---|
| Verlagsort | München |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Literatur ► Biografien / Erfahrungsberichte |
| Literatur ► Essays / Feuilleton | |
| Literatur ► Romane / Erzählungen | |
| Schlagworte | Aller Tage Abend • Booker-Preisträgerin • booker prize shortlist • eBooks • Gehen, ging, gegangen • Heimsuchung • International Booker Prize • Joseph-Breitbach-Preis • Preisgekrönte Autorin |
| ISBN-10 | 3-641-23422-0 / 3641234220 |
| ISBN-13 | 978-3-641-23422-5 / 9783641234225 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 12,2 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich