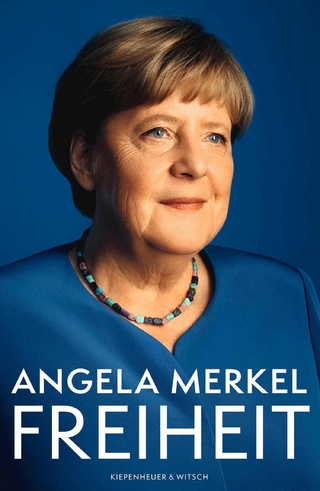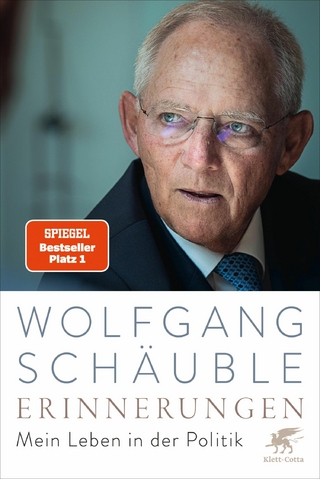Maud Gonne (eBook)
344 Seiten
Insel Verlag
978-3-458-74538-9 (ISBN)
Sie war der Paradiesvogel des irischen Freiheitskampfs: Maud Gonne, sehr groß, sehr glamourös und sehr eigensinnig. Sie wurde 1866 als Tochter eines englischen Offiziers geboren - und so wie sie Irland liebte, so hasste sie das britische Empire.
Für die Rechtlosen war sie die »Frau von den Feen«, die Wunder bewirkte, für ihre Feinde eine »unkontrollierbare Revolutionärin«. Sie kämpfte auf Seiten der Pachtbauern gegen die Truppen der Landlords, stritt für republikanische Häftlinge, saß selbst im Gefängnis und gründete die erste politische Frauenorganisation Irlands. Unübersehbar und unüberhörbar forderte sie die Kolonialmacht heraus und riskierte jederzeit eine Kugel oder einen Schlag mit dem Gewehrkolben.
Sie war die große Liebe des Dichters und Nobelpreisträgers W. B. Yeats - und sie führte ein geheimes Doppelleben in Paris als Geliebte eines rechten Politikers und Mutter einer kapriziösen Tochter. Ihre spätere Ehe mit einem irischen Helden wurde zum Fiasko, aber ihr Kampfgeist blieb ungebrochen.
100 Jahre nach dem Oster-Aufstand, dem Fanal der irischen Unabhängigkeit, ist Maud Gonne noch immer eine Ikone des geistigen und militanten Widerstands. Elsemarie Maletzke erzählt anschaulich und unterhaltsam, wie aus der schönen Offizierstochter eine Revolutionärin und Irlands »heilige Johanna« wurde.
<br />Elsemarie Maletzke wurde 1947 in Oberhessen geboren und wuchs in Bad Kreuznach auf. 1968 begann sie in der Redaktion der Satire-Zeitschrift <em>Pardon</em> zu arbeiten. 1974 ging sie als Deutschlehrerin nach Irland. Zurück in Deutschland war sie Redakteurin bei <em>Titanic</em> und beim <em>Pflasterstrand</em>. Anfang der 80er Jahre erschienen Reiseführer und Anthologien über Irland und Dublin. Es folgten ihre großen Biographien über die Brontës, George Eliot, Jane Austen, Elizabeth Bowen, Elizabeth Barrett und Robert Browning. 2013 erschien ihr Gartenkrimi <em>Giftiges Grün</em>. Elsemarie Maletzke lebt und arbeitet als Autorin, Herausgeberin und freie Journalistin mit den Schwerpunkten Reisen und Garten in Frankfurt am Main.
Elsemarie Maletzke wurde 1947 in Oberhessen geboren und wuchs in Bad Kreuznach auf. 1968 begann sie in der Redaktion der Satire-Zeitschrift Pardon zu arbeiten. 1974 ging sie als Deutschlehrerin nach Irland. Zurück in Deutschland war sie Redakteurin bei Titanic und beim Pflasterstrand. Anfang der 80er Jahre erschienen Reiseführer und Anthologien über Irland und Dublin. Es folgten ihre großen Biographien über die Brontës, George Eliot, Jane Austen, Elizabeth Bowen, Elizabeth Barrett und Robert Browning. 2013 erschien ihr Gartenkrimi Giftiges Grün. Elsemarie Maletzke lebt und arbeitet als Autorin, Herausgeberin und freie Journalistin mit den Schwerpunkten Reisen und Garten in Frankfurt am Main.
II
Thomas und Edith Gonne – Eine stark verkürzte Geschichte Irlands als englische Kolonie – Hungersnot – Tod der Mutter
Edith Maud Gonne, die Irland über alles liebte und das Britische Empire über alles hasste, war Engländerin. Sie wurde am 21. Dezember 1866 in Tongham bei Aldershot in der Grafschaft Surrey geboren. Ihr Vater, Hauptmann Thomas Gonne war dort mit seinem Kavallerieregiment stationiert. Er stammte aus einer wohlhabenden Londoner Weinhändler-Familie, die sich der besseren Gesellschaft zurechnete. Auch die Vorfahren der Mutter Edith Frith Cook waren Londoner und noch ein bisschen reicher und vornehmer als die Gonnes. Mauds Urgroßvater Cook hinterließ einen Velasquez, einen van Dyck und zwei Millionen Pfund, ein Vermögen, das, obwohl mit heutigen Gütern und Leistungen nicht wirklich kompatibel, etwa zwanzig Millionen Euro entsprechen würde.
Edith, das einzige Kind seines ältesten Sohns William, war früh verwaist und auf das Wohlwollen dreier Tanten angewiesen, die ihr zu verstehen gaben, dass mit keiner von ihnen zu rechnen sei. Die Elfjährige wurde in eine viktorianische Bildungsanstalt eingewiesen, die junge Mädchen für den Heiratsmarkt erzog, ohne sie dabei intellektuell zu überfordern. Ihre Ehe mit Thomas Gonne währte nur fünf Jahre. »Sie starb, ehe der Zauber ihrer Liebe verblasste.«1 Maud erinnerte sich an die traurigen Augen ihrer Mutter und dass sie »so schön und gerade gewachsen war wie eine Lilie«.
Die Erinnerung an ihren Vater war sehr viel ausgeprägter. Thomas Gonne stellte in einer Zeit, da Kinder der Oberschicht ihre Väter als eine Art Würdenträger wahrnahmen, die sie mit Sir ansprachen, eine Ausnahmeerscheinung dar; liberal und liebenswürdig, ein in sechs Sprachen geläufiger Kosmopolit. Für Maud war er Tommy. Er brachte Geschenke mit und schrieb lustige Briefe aus Wien, Kalkutta oder St. Petersburg, wo er – inzwischen zum Oberst befördert – stationiert war. Zu Hause zeigte er der Vierjährigen, wie man Hunde anfasste, Samenkörner in Töpfe steckte und Ableger zog. Tommy nannte seine Älteste »Schäfchen«, obwohl Maud niemals sanft war und selten tat, was man von ihr erwartete – anders als ihre jüngere Schwester Kathleen, ein braves kleines Mädchen, das vom Vater »Bär« gerufen wurde. Zum Haushalt gehörten auch echte Tiere, darunter ein Esel, auf dem die Kinder reiten lernten und an den Maud sich als »besonders engen Freund« erinnerte. Wenn er auf der Koppel in der Sonne lag, kuschelte sie sich an ihn und steckte den Kopf in sein würzig riechendes Fell. Bei Auseinandersetzungen mit dem Kindermädchen kam er zum Haus getrottet und plärrte zum Fenster herein, »als wolle er mir helfen, noch mehr Lärm zu machen«2.
1868 wurde ihr Vater nach Irland versetzt und auf dem Curragh, einem großen Militärstützpunkt westlich von Dublin stationiert. »Hier atmete ich zum ersten Mal die Luft der Freiheit«, schreibt sie – ungeachtet der Tatsache, dass Irland eine Kolonie war und die Briten die Männer, die für Irlands Freiheit kämpften, einsperrten. Doch wie viele ihrer Landsleute, die im Lauf der Jahrhunderte irischer als die Iren selbst geworden waren – redseliger, widerständiger, leichter entflammbar – und darüber allmählich ihrer steifen Oberlippe verlustig gingen, verfiel auch Maud dem Zauber ihrer Wahlheimat. Mit der Vehemenz einer Konvertitin würde sie sich später gegen ihre englische Herkunft wenden und einen irischen Urgroßvater reklamieren – ein Zweig ihres Stammbaums, der indes historisch als nicht sehr belastbar gilt.
Gesellschaftlich gehörten die Neuankömmlinge zur Kaste der Anglo-Iren, Nachfahren anglo-normannischer Invasoren und protestantischer englischer Siedler, die von den Eingesessenen durch Konfession, Status, Landbesitz und Treue zur Krone in einer Art Apartheid geschieden waren. Ihr Akzent, der sich der gälischen Kadenzen ihrer Umgebung enthielt, wurde als englisch empfunden, und obwohl viele seit längerer Zeit am Platze waren, gönnten ihnen die »echten« Iren den Begriff Heimat nicht. Wer Maud kränken wollte – wie der Dramatiker Sean O’Casey –, nannte sie die »Tochter des Obristen«, die in Irland immer eine Fremde bleiben würde.
Dabei war ein einig Land der Gälen eine romantische Fiktion. Auch bevor der erste Engländer seinen gepanzerten Fuß auf die Insel gesetzt hatte, war Irland keine geeinte Nation, sondern aufgeteilt in die Hoheitsgebiete gälischer Clanchefs, die sich gegenseitig bekriegten. Tatsächlich war es einer der ihren, der König von Leinster, der im Jahr 1169 einen normannischen Baron namens Strongbow einlud, ihm in Liebeshändeln beizustehen. Der nahm die Bitte um tätige Nachbarschaftshilfe zum Anlass für einen Eroberungszug. Eine Vorhut von zehn Rittern und siebzig Bogenschützen landete im Südosten und trieb dreitausend Verteidiger über die Klippen. Die Iren kannten weder Taktik noch Schlachtordnung, und ihre Tragik war, dass sie bis ins 20. Jahrhundert das Kriegsglück niemals lange genug wenden konnten, um die Herren, die sie überfallen hatten, wieder loszuwerden. Bereits Anfang des 16. Jahrhunderts wurde der Großteil der Insel von einer Handvoll »alt-englischer« Familien regiert, die sich dort wie auf ihren privaten Ländereien zu Hause und kaum noch als Untertanen der Krone fühlten. Heinrich VIII., seit 1541 auch König von Irland, erinnerte sie daran, als er ihre Rebellion blutig niederschlug.
Den gälischen Iren kamen in den folgenden Jahrhunderten Stück für Stück ihr Land, ihre Rechte, ihre Sprache und ihre Kultur abhanden. 1649 überrannte Oliver Cromwell die Insel, massakrierte ein Drittel der Bewohner und verbannte den Rest in den kahlen Westen der Insel. Englische und schottische Siedler verdrängten die Bauern aus den fruchtbaren Grafschaften. Zwangsgesetze, nach denen Katholiken kein Land erwerben, kein Amt bekleiden und ihre Religion nicht ausüben durften, stießen sie in Armut und Abhängigkeit. Ein von französischen Truppen unterstützter Aufstand war 1798 nur kurzfristig erfolgreich. Zwei Jahre später drückte Premierminister William Pitt d.J. den Act of Union durch, der Irland das bisschen Selbstbestimmung wieder entzog, das es zwanzig Jahre zuvor durch die schrittweise Rücknahme der Strafgesetze erlangt hatte. Das nationale Parlament schaffte sich selbst ab, als die Abgeordneten – mit einer dreiviertel Million Pfund bestochen – der Union mit England zustimmten, und Irland wieder von Westminster aus regiert wurde.
Auf hohen Sockeln stehen heute in Dublin die Statuen der tapferen Männer, die dafür geliebt werden, dass sie an den Briten, den eigenen Landsleuten oder, nach einem Zitat von Friedrich Nietzsche, an der »schauerlichen Herrschaft des Unsinns und Zufalls« scheiterten. Auf dem zentralen Monument am Anfang der Straße, die seit 1925 seinen Namen trägt, steht Daniel O’Connell; das obere Ende beherrscht Charles Stewart Parnell – beide keine Männer des Schwerts, sondern Politiker, die Reformen ansteuerten, die Irland unter eigene Verwaltung gestellt hätten, ohne das Band zum Britischen Empire zu durchschlagen. Beide führten eine Massenbewegung an. O’Connell scheiterte an der Aufhebung des Act of Union; Parnell an seinem Verhältnis zu einer verheirateten Frau.
Um die Mitte des 19. Jahrhunderts durchlitt Irland das größte Trauma seiner Geschichte: eine Hungersnot, in der rund eine Million Menschen umkamen. Noch zwanzig Jahre vor Mauds Geburt war die grüne Insel ein dicht besiedeltes Agrarland, das nicht nur seine über acht Millionen Einwohner ernähren konnte, sondern mehr Lebensmittel aus- als einführte. Die Üppigkeit betraf allerdings nicht die westlichen Grafschaften, wo das Pachtland in unzählige winzige Kartoffeläcker unterteilt war, die immer mehr Menschen ernähren mussten. Noch heute sieht man dort in den Bergen die Bodenwellen der »lazy beds«, der ehemaligen Hügelbeete, mit denen die Abhänge bis hinauf ins steile, steinige Gelände onduliert sind.
Es war ein Wirtschaften von der Hand in den Mund. Als in den Jahren zwischen 1845 und 1851 die Kraut- und Knollenfäule übers Land zog und die Kartoffeln in eine stinkende schleimige Masse verwandelte, hatten nur die Großbauern etwas zuzusetzen. England, das eine Politik des laissez faire betrieb, eine Art Nichteinmischungspakt in die Wirtschaft, ließ seine Kolonie weitgehend im Stich. Während aus Irlands fruchtbarer Mitte noch immer Getreide und Vieh nach England exportiert wurden, verhungerten im Westen die Menschen auf ihren Äckern. Betteln war bei Strafe verboten. Auf den Diebstahl von zwölf Kartoffeln standen sieben Jahre Deportation nach Australien, auch für Mütter und Kinder. Selbstverständlich kehrten sie nie zurück.
Mit Hunger und Not kamen die Epidemien, Ruhr und Typhus. Der Autor William Carleton beschrieb die »ängstliche Verzweiflung« im Land, die gebeugten Gestalten »die Augen wild und hohl, der Gang schwach und schwankend«, die Straßen schwarz von Begräbnissen, und in den Suppenküchen strömten »wilde Meuten« zusammen, »zerlumpt, krank und ausgemergelt auf Haut und Knochen«3. Im County Sligo gingen im März 1847 sechshundert dieser Elendsgestalten bei Regen und Schnee fünfzehn Kilometer über die Berge, um in Delphi Lodge, dem Haus des Marquis von Sligo um Unterstützung zu bitten. Als sie eintrafen, saß das Hilfskomitee...
| Erscheint lt. Verlag | 11.4.2016 |
|---|---|
| Verlagsort | Berlin |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Literatur ► Biografien / Erfahrungsberichte |
| Sozialwissenschaften ► Politik / Verwaltung | |
| Schlagworte | 50plus • Ben Witter Preis 2023 • Best Ager • Biografie • Dublin • Frauenrechte • Freiheitskampf • Generation Gold • Golden Ager • Irische Literatur • Irische Unabhängigkeit • Irland • Osteraufstand • Rentner • Rentnerdasein • Robert-Gernhardt-Preis 2009 • Ruhestand • Senioren • William Butler Yeats |
| ISBN-10 | 3-458-74538-6 / 3458745386 |
| ISBN-13 | 978-3-458-74538-9 / 9783458745389 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 6,4 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich