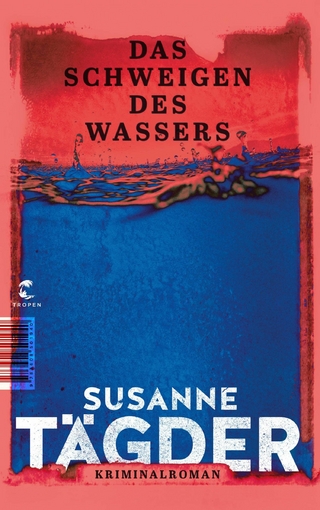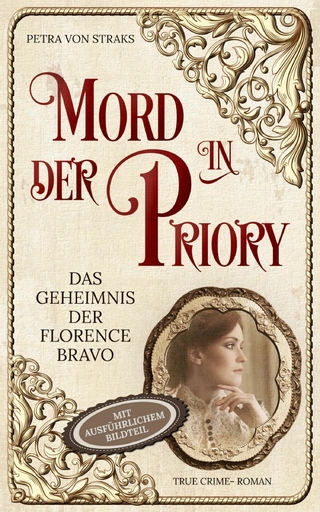Das Feuer der Freiheit (eBook)
496 Seiten
dtv Deutscher Taschenbuch Verlag
978-3-423-42825-5 (ISBN)
Lyndsay Faye gehört zu den authentischsten New Yorkern, nämlich denen, die woanders geboren wurden. Sie lebt in Manhatten.
Lyndsay Faye gehört zu den authentischsten New Yorkern, nämlich denen, die woanders geboren wurden. Sie lebt in Manhatten.
Prolog
Dunfhlaith ó Dufaigh, wie sie in der grünen Heimat ihrer Mutter genannt wurde, in der die Felsen das Grasland durchstachen und aussahen wie die mageren Schlüsselbeine der friedlich schlummernden Leichname auf den Straßen, erinnerte sich wieder daran, wie es sich anfühlte, Hunger zu leiden. Wie es sich anfühlte, sich nach einer dicken braunen Brotscheibe mit Salz zu sehnen, nach dem Pfeifenrauch auf der Zunge, der wie ein handfestes Stück gegrilltes Rindfleisch schmeckte. Wie es war, auf Baumstümpfen nach Pilzen zu suchen und sie für Whiskey zu verhökern – nicht weil sie eine Säuferin gewesen wäre, sondern weil Pilze sie nicht satt machen konnten, während ein Pint Whiskey ihr half, den knurrenden Magen einen ganzen Tag lang zu vergessen. Wenn sie sich Mühe gab, vielleicht auch zwei.
Dunla Duffy, wie sie in New York City genannt wurde, erinnerte sich mit einer Liebe an Irland, die so hartnäckig war wie die wabernden Nebelschwaden, die zuckend von der Schwelle ihrer armseligen Hütte wichen, sobald die unbarmherzige Sonne aufging. Denn Dunla Duffy war nicht mehr hungrig.
Dunla Duffy war am Verhungern.
Als ich noch eine jüngere Ausgabe des Timothy Wilde war, nicht der Kupfersternträger Nr. 107 des New York City Police Department, sondern ein Schraz, der wild durch die Straßen streunte, da kannte ich den Hunger so gut wie meinen eigenen Namen. Aber wie es ist, am Verhungern zu sein, das musste ich nie erfahren – und hätte mein Bruder Valentine mir in seinem verrückten Leben auch nur diesen einen Liebesdienst erwiesen, es wäre genug gewesen.
Natürlich hat er mehr als das für mich getan. Aber wenn ich jetzt schon vorgreife, wird es mir nie gelingen, auch nur irgendetwas von alldem zu Papier zu bringen.
Kurz vor Morgengrauen, an jenem Tag, an dem Dunla und ich uns begegnet sind, saß sie in der Pell Street, lustlos Fußmanschetten säumend, in der Ecke eines angemieteten Erdgeschoss-raumes, den sie mit anderen Frauen teilte, die wie sie als Heimarbeiterinnen für die Fabrik tätig waren. Die Hosen waren zu hohen Türmen gestapelt und warteten auf den gnadenlosen Sonnenaufgang, der die Frauen jäh aus dem Schlaf reißen würde. Die Arbeiterinnen lagen direkt auf den rauen Planken neben der Ware, denn Möbel waren Luxus. Nach Manhattaner Standard war das eine wie das andere völlig wertlos, denn wir schrieben das Jahr 1848, und auf den Britischen Inseln hatte man seit 1845 keine Kartoffel mehr zu Gesicht bekommen, die nicht lepraschwarz gewesen wäre. Im Morgengrauen würden weitere Frauen wie Dunla kommen. Frauen wie sie glichen den sich an unseren Straßenecken auftürmenden Müllhaufen.
Niemand wollte sie anschauen. Und am folgenden Tag würden es noch mehr sein.
»Du Diebin«, fauchte wütend eine schrullige alte Frau aus der gegenüberliegenden Ecke.
Dunla, gequält von einem Ausschlag, der erst vor Kurzem wie wilde Frühlingsblumen auf ihren Gliedern erblüht war, antwortete nicht.
»Eine Diebin bist du.«
Die zwölf anderen Frauen im Raum zuckten bei dem Lärm kurz zusammen.
Dunla schaffte es mit für ihre Begriffe unmenschlicher Anstrengung, den Kopf zu heben. Sie erzählte uns später, sie sei vierzehn Jahre alt. Ihre riesigen Augen strahlten in einem blassen Grün aus den gleichermaßen grünen und fettigen Locken heraus, die ihr rundes Gesicht umrahmten. Früher waren ihre Zöpfe von der Farbe blassen Kupfers gewesen, und sie konnte sich nicht recht erklären, wieso sie die Farbe verfaulender Maisgrannen angenommen hatten – ich konnte das Geheimnis ihrer blassen Seetang-Locken am Ende lösen, schließlich habe ich am Lösen von Puzzeln einen Narren gefressen. Meinen Bekannten habe ich damit beileibe nicht immer nur Gutes getan. Dunla erinnerte sich, dass die Leute im Dorf sie als Kind wegen ihres drollig leeren Gesichtsausdrucks und des verstörenden Blicks etwas skeptisch beäugt hatten. Aber ihre Mutter hatte sie einmal in die Luft geworfen, hoch hinauf zum silbernen Vollmond, und gesagt, Dunla sei ihr hellstes Licht, heller noch als der gealach lán über ihren Köpfen. Immer wenn Dunla versuchte, sich frische Butter vorzustellen, und es ihr nicht gelingen wollte, stellte sie sich vor, sie sei eines Menschen Mond.
Um ehrlich zu sein – denn eine so finstere Geschichte kann weiß Gott nichts anderes sein als die Wahrheit – war Dunla nicht sehr schlau. Aber sie kam trotzdem ganz gut zurecht.
Der Mond scheint ganz weit weg, gell, sagte sie zu mir an dem Tag, an dem sie mir dabei zusah, wie mein Herz brach, aber die Flut kommt trotzdem. Gell, so wie jetzt?
Von Dunla lernte ich, dass Menschen sich auf geheimnisvolle Weise bewegen können, wie Götter.
»Diebin.«
»Was?«, sagte sie zu der rostigen Stimme.
»Ich hab gesehen, was für eine metzenhafte, nichtsnutzige, scheißefressende Diebin du bist«, keifte die alte Frau.
Dunla blinzelte überrascht.
Die Hexe nähte weiter. Sie stach schnell und ohne Feingefühl in den Stoff, das Haar bauschte sich wie Stahlwolle in gewittrigen Wolken unter einem Kopftuch, das sich langsam löste. Die anderen wisperten, die Hexe sei verrückt. Dunla hatte nie Ursache gehabt, ihr Urteil anzuzweifeln. Sie hatte die Hexe ohnehin schon einmal gesehen, noch bevor sie sich dieses stickige Fegefeuer in der Pell Street geteilt hatten – sie hatte Flammen aus einem Kessel gezaubert, da war Dunla sich ganz sicher.
Sie hatte entsetzt das Kreuz über der Brust geschlagen und war davongelaufen.
»Es gibt Gesetze in diesem Land«, erklärte die Hexe.
Im Monat zuvor war die Hexe in den vorderen Raum umgezogen, denn sie hatte sieben lausige Kerzen mitgebracht, die sie aus ranzigem Speck und Zwirn in Tontassen hergestellt hatte. Wenn man die Lichter anzündete, kokelten die schwelenden Gedärme ihres billigen Machwerks. Eines brannte gerade, und Dunla nutzte den teuflischen letzten Rest des schwachen Scheins zum Nähen. Sie erwachte in dem Moment, als der Glanz ihre Augenlider berührt hatte. Sie hatte ihn fälschlicherweise für das Morgengrauen gehalten.
»Gesetze, sagen Sie?«, wiederholte Dunla verängstigt. Sie hatte noch nie ein Gesetz gebrochen.
»Ja, genau. Gesetze gegen das Stehlen von Licht.«
Zwölf weitere Augenpaare verengten sich zu abschätzigen Schlitzen. Die junge Mutter und ihre Tochter. Die beiden Schwestern. Die Hure und ihre beste Freundin, die auch eine Hure war. Die drei deutschen Frauen, die immer weinten, die Wand anstarrten und einander an den Händen hielten. Die schwangere junge Frau, zusammengerollt auf einem Stapel Zeitungen. Das Mädchen aus der Besserungsanstalt mit dem kahl geschorenen Kopf. Die elfjährige Kindermetze.
»Das ist mein Licht«, zischte die Hexe. »Wenn du es benutzen willst, dann bezahl es mir. Was kannst du mir dafür zahlen, du kleine Ratte?«
Als Dunla sah, dass die anderen Frauen herüberstarrten, begann sie am ganzen Leib zu zittern. Die einen sahen verärgert aus, die anderen mitleidig. Allen konnte man die Angst vor der Hexe an den Augen ablesen.
Plötzlich hielt sie ein Messer in der Hand. Es glänzte im Schein des brutzelnden Tierfetts.
»Bezahl es mir jetzt, Goldstück«, flüsterte die Hexe, »sonst schneid ich mir mein Abendessen aus deinem Rücken.«
»Morgen«, quiekte Dunla, »morgen kann ich dich ganz sicher bezahlen.«
»Bis morgen habe ich auch die allerletzte von euch an einem Spieß geröstet.«
»Bitte …«
»Zahl jetzt oder trag die Konsequenzen.«
Etwa eine Minute später fand Dunla sich auf der Pell Street wieder, nach viel Gekreische und Durcheinander und Geschrei Raus hier um Himmels willen – ohne Schuhe, wie seit Monaten –, die Arme voll mit unfertigen Hosen. Begrüßt von einem mickrigen Nieselregen.
Halb unter den Kleidern kauernd, blieb Dunla auf den Stufen vorm Haus sitzen, bis die kraftlosen Wolken sich aufgelöst hatten und die Aprilsonne dumpf auf sie und die Horden von Afrikanern und Emigranten herabschien, die im Sechsten Bezirk hin und her eilten – einem Viertel, das weltweit berüchtigt war als die schwärende Wunde im Angesicht New Yorks.
Sicher, es ist auch mein Viertel. Ich meine das also nicht persönlich.
Dunla wankte durch Pferdeäpfel und weit Schlimmeres, vorbei an den bewusstlosen Säufern, über deren grogbesudelten Hemden die Fliegen summten, vorbei an den schiefen Holzhäusern, die nur in sich selbst Halt fanden, vorbei an einem beinlosen Veteranen, der an einer Veranda lehnte, heimgekehrt vom ruhmreichen Kampf um Mexiko. Wir alle nennen sie die »heimgekehrten Freiwilligen«, weil wir uns dann besser fühlen, als wenn wir sie »menschliche Wracks« nennen würden. Der hier hatte an den Knien Knoten in seine Uniform gemacht und nippte unablässig an einer Flasche Morphium. Hämisch grabschte er nach Dunlas Kleid, war aber selbst fast so schwach wie sie. Also wankte sie mit ihrem Hosenstapel im Arm weiter in die Chatham Street und bog dann Richtung Süden ab.
In der Chatham Street lässt sich unmöglich sagen, wo die Läden aufhören und die Straße beginnt. Die Grenzen sind fließend, so durchlässig und unbeständig wie unsere Gesetze. Die Auslage vor WILLIAM DOWNIES EISENWARENLADEN ergoss sich in Form zweier mit Werkzeugen vollgepackter Tische und einem Dutzend offener Schachteln mit Zimmermannsnägeln in den Verkehr. Dunla hätte um ein Haar eine wacklige Hutpyramide umgeworfen, die sich vor der Kurzwarenhandlung von P.J. COPPINGER stapelte, doch der...
| Erscheint lt. Verlag | 19.2.2016 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Timothy Wilde |
| Übersetzer | Michaela Meßner |
| Verlagsort | München |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Literatur ► Historische Romane |
| Literatur ► Krimi / Thriller / Horror ► Historische Kriminalromane | |
| Schlagworte | 3. Band • Abschlussband • Ausbeutung • Band 3 • Brandstiftung • Frauenrechtsbewegung • historischer Krimi • Historischer Roman • Mitte 19. Jahrhundert • New York • New-York-Trilogie • NYPD • Timothy Wilde • Versicherungsbetrug |
| ISBN-10 | 3-423-42825-2 / 3423428252 |
| ISBN-13 | 978-3-423-42825-5 / 9783423428255 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 1,2 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich