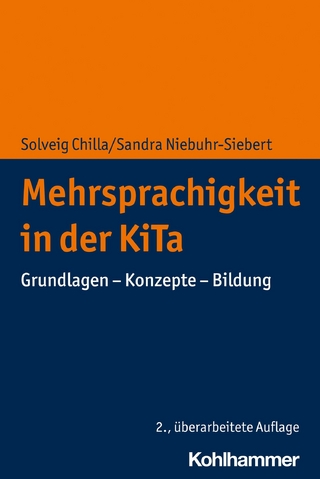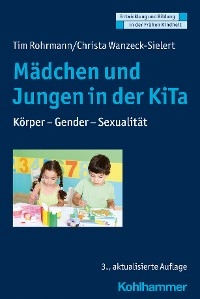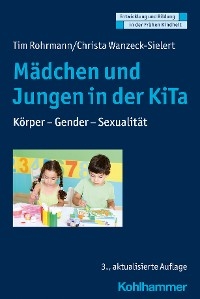Bilingualer Erstspracherwerb (eBook)
315 Seiten
UTB GmbH (Verlag)
978-3-8463-4348-7 (ISBN)
Prof. Stefan Schneider lehrt Romanische Sprachwissenschaften an der Universität Graz.
Vorwort8
1 Einleitung9
1.1 Mehrsprachigkeit: ein alltägliches Phänomen9
1.2 Aufbau des Buches und Lesehinweise12
2 Grundlegende Konzepte15
2.1 Bilingualität, Bilingualismus und Diglossie15
2.2 Bilingualität und Multilingualität16
2.3 Bilingualer Erstspracherwerb und früher Zweitspracherwerb18
2.4 Bilinguale Kommunikation in der Familie und in ihrem Umfeld20
2.5 Artifizielle Bilingualität27
2.6 Semilingualität, unvollständiger Spracherwerb und Sprachabbau29
2.7 Verschiedene ‚Sprachen‘32
3 Fragestellungen, Hypothesen und Methoden35
3.1 Fragestellungen35
3.2 Hypothesen40
3.3 Untersuchungs- und Forschungsmethoden50
4 Forschungsüberblick: frühe Studien65
4.1 Ronjat (1913)65
4.2 Leopold (1939 – 1949)69
4.3 Weitere Studien75
5 Forschungsüberblick: neuere Studien78
5.1 Forschung bis 197878
5.2 Volterra und Taeschner (1978) und Taeschner (1983)80
5.3 Deutsch und Französisch – Doppelter Erstspracherwerb (DUFDE)90
5.4 De Houwer (1990)97
5.5 Genesee (1989) und Paradis und Genesee (1996)99
5.6 Gawlitzek-Maiwald und Tracy (1996)106
5.7 Lanza (1997)110
5.8 Deuchar und Quay (2000)113
5.9 Yip und Matthews (2007)121
5.10 Hamburg und Wuppertal127
5.11 Itani-Adams (2013)131
5.12 Weitere Studien132
6 Die bilinguale Sprachentwicklung135
6.1 Grundsätzliches zum Erstspracherwerb135
6.2 Perzeption und Verarbeitung von Lauten139
6.3 Das Erkennen von Wortgrenzen144
6.4 Vom frühkindlichen Lallen zu den ersten Wörtern147
6.5 Entwicklung des Wortschatzes156
6.6 Äquivalente167
6.7 Erste Mehrwortäußerungen173
6.8 Quantität und Qualität des Inputs187
7 Die bilinguale Sprachentwicklung im Vergleich zur monolingualen192
7.1 Was ist die Norm?192
7.2 Bilingualer und monolingualer Wortschatz197
7.3 Sprachstörungen aufgrund von Bilingualität?206
8 Sprachmischung211
8.1 Ausmaß der Sprachmischung211
8.2 Ursachen und Richtung der Sprachmischung213
8.3 Matrixsprache und eingebettete Sprache222
8.4 Arten der Sprachmischung225
8.5 Sprachmischung bei Erwachsenen und bei Kindern234
9 Kognitive Aspekte236
9.1 Neuronale Grundlagen236
9.2 Sprache und Denken240
9.3 Intelligenz und Denkfähigkeiten248
9.4 Mentalisierung253
9.5 Metalinguistisches Bewusstsein255
9.6 Der Erwerb weiterer Sprachen259
10 Soziale Aspekte264
10.1 Erziehung264
10.2 Kulturelle Zugehörigkeit268
Literatur274
Gesamtregister305
2 Grundlegende Konzepte
2.1 Bilingualität, Bilingualismus und Diglossie
Bevor wir uns genauer mit dem Phänomen des bilingualen Erstspracherwerbs auseinandersetzen, ist es hilfreich, drei Termini oder Begriffe zu klären. Die Termini Bilingualität und Bilingualismus (gelegentlich auch Bilinguismus, Müller et al. 2011, 15; Rizzi 2013, 9) bezeichnen im Deutschen sowohl das individuelle Beherrschen zweier Sprachen seit der Kindheit als auch das kollektive Phänomen einer Gesellschaft, die in allen wichtigen kommunikativen Interaktionen zwei Sprachen verwendet. Die Wörter Zweisprachigkeit und Mehrsprachigkeit sind ähnlich mehrdeutig. Hamers und Blanc (2000 [1983], 6) unterscheiden jedoch terminologisch das individuelle Phänomen der bilingualité oder bilinguality vom gesellschaftlichen Phänomen des bilingualisme oder bilingualism. Ebenso finden wir in Hélot (2007, 27) die Unterscheidung zwischen dem individuellen Phänomen des Multilingualismus und dem kollektiven Plurilingualismus. Ich greife diesen Vorschlag auf und verwende im vorliegenden Buch Bilingualität für das individuelle und Bilingualismus für das gesellschaftliche Phänomen. Gleichermaßen bezeichne ich daher das individuelle Phänomen der Mehrsprachigkeit mit Multilingualität (oder auch Plurilingualität) und die gesellschaftliche Mehrsprachigkeit mit Multilingualismus (oder auch Plurilingualismus). Die Bilingualität kann, muss aber keine Voraussetzung für den Bilingualismus sein; ein zweisprachiges Individuum kann genauso gut in einer einsprachigen Gesellschaft leben, so wie umgekehrt in einer bilingualen Gesellschaft in der Regel nicht jedes Mitglied beide Sprachen beherrscht. Im diesem Buch beschäftige ich mich in erster Linie mit der individuellen Bilingualität und weise nur wo nötig auf die gesellschaftliche Erscheinung und die eventuellen Einflüsse eines bilingualen Umfeldes hin.
Ebenfalls eine gesellschaftliche und soziolinguistische Bedeutung besitzt der vom Bilingualismus zu unterscheidende Begriff der Diglossie. Mit diesem auf Ferguson (1959) zurückgehenden Terminus wird eine zweisprachige Situation in einer Gesellschaft bezeichnet, in der eine funktionale Differenzierung zwischen zwei Sprachen oder Varietäten besteht, so dass jeder der beiden ein sozial, thematisch und situationell definierter Anwendungsbereich vorbehalten ist. Häufig steht eine der Sprachen oder Varietäten sozial höher als die andere, es besteht eine Asymmetrie (Bolonyai 2009, 257). Die höher stehende Sprache oder Varietät zeichnet sich durch ein hohes Maß an grammatischer Explizitheit, durch Normierung, formellen Charakter, Schriftlichkeit und schulbasierte Vermittlung aus. Vor allem in der Kreolistik wird die sozial hohe Varietät oder Sprache manchmal Akrolekt und die soziale niedrigere Basilekt bezeichnet (eventuell mit einem dazwischen liegenden Mesolekt). In Fergusons (1959) ursprünglichem Verständnis handelt es sich immer um zwei Varietäten der gleichen Sprache, wie z. B. klassisches Arabisch und ägyptisches Arabisch, Standarddeutsch und Schweizerdeutsch oder Standardfranzösisch und Kreolisch in Haiti. Fishman (1967) weist jedoch darauf hin, dass viele bilinguale Gesellschaften diglossisch sind oder, anders gesagt, auch zwei vollkommen verschiedene Sprachen in einem diglossischen Verhältnis zueinander stehen können. Der sehr reduzierte deutsch-slowenische Bilingualismus im Bundesland Kärnten ist de facto diglossisch, auch wenn Slowenisch eine hoch entwickelte Kultursprache ist, es in Kärnten slowenischsprachige Schulen und Radiosendungen gibt und slowenischsprachige Kärntner in einem beschränkten Rahmen das gesetzliche Recht haben, ihre Anliegen bei den Ämtern auf Slowenisch vorzubringen. Dieses Recht hat allerdings vor allem theoretische und politische Bedeutung. In der Praxis wird Slowenisch in einem engen sozial und lokal definierten Bereich gesprochen, der zumeist aus der Familie, dem Freundeskreis und den oft weit verstreuten Angehörigen der Minderheit besteht. Hinzu kommt noch das Gefälle zwischen Stadt- und Landbevölkerung. Die slowenischsprachigen Kärntner leben vornehmlich auf dem Land. Wenn sie in die Stadt kommen, wechseln sie oft automatisch ins Deutsche.
2.2 Bilingualität und Multilingualität
Die Situationen frühkindlicher Mehrsprachigkeit sind höchst unterschiedlich. Einige Kriterien ermöglichen jedoch eine erste Differenzierung und Typologie der Fälle. Ein naheliegendes Kriterium ist die Anzahl der involvierten Sprachen. Ein weiteres brauchbares Kriterium ist die Zeit, zu der der Spracherwerb einsetzt. Außerdem kann man die unterschiedlichen kommunikativen Situationen anhand der in der Familie und in ihrem Umfeld üblichen Verteilung der Sprachen unterscheiden.
Im vorhergehenden Abschnitt habe ich von Bi- und Multilingualität und von Bi- und Multilingualismus gesprochen. In Laufe des Buches wird allerdings klar werden, dass mein Augenmerk aufgrund der größeren Verbreitung des Phänomens vornehmlich der frühkindlichen Bilingualität gilt. Die aktuelle Forschungslage trägt ebenfalls dazu bei: Obwohl es eine Reihe von Untersuchungen zum gleichzeitigen Erwerb von drei oder sogar mehr Sprachen gibt, beschäftigen sich die meisten Studien mit dem Erwerb zweier Sprachen. Ich verfahre deshalb dem heutigen Stand der Dinge entsprechend und berichte primär über die frühkindliche Bilingualität.
Zur Trilingualität oder Dreisprachigkeit kann es schnell kommen; im Grunde sobald zu den zwei Sprachen als dritte der lokale Dialekt einer der beiden Sprachen tritt – eine Situation, die in den schon angesprochenen zweisprachigen Gebieten des Bundeslandes Kärnten keine Seltenheit ist. Auch der Erwerb von drei ganz vollkommen unterschiedlichen Sprachen im Kindesalter ist selbstverständlich möglich, wie die Studien von Murrell (1966), Francescato (1971), Oksaar (1977), De Matteis (1978), Kadar-Hoffmann (1983), Hoffmann (1985, 2001), Navracsics (1985), Mikeš (1990), Stavans (1990, 1992), Faingold (1999), Quay (2001), Cruz-Ferreira (2006), Wang (2008) und Arnaus Gil (2013) dokumentieren. Barnes (2006) enthält einen Überblick über die Forschung zur frühkindlichen Dreisprachigkeit.
Hagège (1996, 259) erwähnt eine Reihe von bekannten zwei- oder mehrsprachigen Schriftstellern. Der in der Donaustadt Ruse in Bulgarien geborene Schriftsteller Elias Canetti (1905–1994) berichtet ebenso in der Autobiografie Die gerettete Zunge (1977) von seiner Kindheit in einer mehrsprachigen Umgebung. Seine Eltern waren sephardisch-jüdischer Herkunft und über die Türkei in Bulgarien eingewandert. Im Elternhaus wurde in vier Sprachen kommuniziert: Judenspanisch, Bulgarisch, Deutsch, später noch Englisch. Diese Seiten sind nicht nur von sprachwissenschaftlichem und psychologischem Interesse, sondern gewähren auch einen geistreich verfassten Einblick in das Leben der multilingualen und multiethnischen altösterreichischen Gesellschaft Südosteuropas.
2.3 Bilingualer Erstspracherwerb und früher Zweitspracherwerb
Das Kriterium der Zeit erlaubt es uns, zwischen dem gleichzeitigen (simultanen) (Sprache X/Sprache Y) und dem sukzessiven (konsekutiven oder sequenziellen) Erwerb mehrerer Sprachen zu unterscheiden (Sprache X → Sprache Y) (McLaughlin 1978). Im ersten Fall ist das Kind von Geburt an regelmäßig mit zwei oder mehreren Sprachen konfrontiert und nur hier kann man streng genommen von bilingualem Erstspracherwerb sprechen. Im zweiten Fall sollte man von frühem Zweitspracherwerb sprechen.
In den Lebenssituationen von vielen sprachlichen Minderheiten ist es in der Regel so, dass die Kinder anfangs mit einer Sprache aufwachsen und erst später im Zuge der ersten außerfamiliären Kontakte, auf dem Spielplatz, im Kindergarten oder in der Schule, die zweite Sprache erwerben. Grundsätzlich gilt hier das Gleiche wie für den bilingualen Erstspracherwerb: Stimmen die sozialen und kognitiven Voraussetzungen und erhält das Kind ausreichende Zuwendung seitens der erwachsenen Ansprechpartner, kann man davon ausgehen, dass der etwas später einsetzende Erwerb einer zweiten Sprache zu einer gelungenen Zweisprachigkeit führt.
Die in der Theorie klare Unterscheidung zwischen gleichzeitigem und sukzessivem Erwerb ist in der konkreten Anwendung nicht ohne Kompromisse haltbar. Sie läuft auf die Frage hinaus, wie strikt Gleichzeitigkeit zu verstehen ist. Von ihr hängt die Definition des bilingualen Erstspracherwerbs ab. Obgleich er sich der Arbitrarität dieses Kriteriums bewusst ist, schlägt McLaughlin (1978, 9, 73, 99) drei Jahre als Altersgrenze vor. Wenn das Kind bis dahin regelmäßig mit zwei Sprachen Kontakt hatte, könne man das als bilingualen Erstspracherwerb betrachten. Deuchar und Quay (2000, 2) setzen diese Grenze auf ein Jahr herunter. De Houwer (1995, 223) legt sie bei einem Monat fest, wobei allerdings später in De Houwer (2009, 2) ein solches Limit nicht mehr erwähnt wird. Romaine (1999, 252) spricht sich hingegen für eine strikte Interpretation von Gleichzeitigkeit aus: Nur wenn ab der Geburt mit dem Kind zwei Sprachen gesprochen werden, könne man von bilingualem Erstspracherwerb sprechen. Die gleiche Auffassung finden wir bei Müller et al. (2011, 15). Ich definiere in diesem Buch den bilingualen Erstspracherwerb ebenfalls als...
| Erscheint lt. Verlag | 11.3.2015 |
|---|---|
| Verlagsort | Stuttgart |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sozialwissenschaften ► Pädagogik ► Vorschulpädagogik |
| Schlagworte | Bilingual • Bilingualismus • Einführung • Entwicklungspsychologie • Erstsprache • Erstspracherwerb • Heilpädagogik • Kinder • Linguistik • Mehrsprachigkeit • Pädagogik • Psycholinguistik • Sprache • Spracherwerb • Sprachheilpädagogik • Zweisprachigkeit |
| ISBN-10 | 3-8463-4348-X / 384634348X |
| ISBN-13 | 978-3-8463-4348-7 / 9783846343487 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 7,8 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich