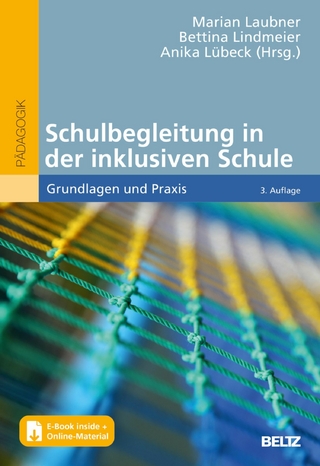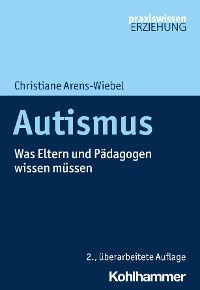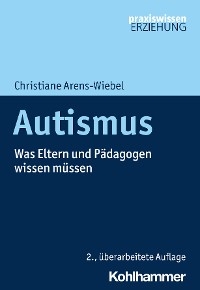Innovationen im Bildungswesen (eBook)
VII, 345 Seiten
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (Verlag)
978-3-531-19701-2 (ISBN)
Das Ziel des Bandes ist ein Versuch, die Educational Governance-Perspektive systematisch mit der sich in der Erziehungswissenschaft nunmehr etablierenden Innovationsforschung zu verknüpfen. Der Band möchte die Produktivität möglicher Verknüpfungen von Educational Governance und sozialwissenschaftlicher Innovationsforschung eruieren. Verbunden mit dieser Themenstellung ist die grundlegende These, dass der Begriff der Innovation eine bisherige Leerstelle im Begriffsgebäude der Educational Governance zu markieren und füllen vermag. Im Band konzeptionell zusammengestellt sind Forschungsbeiträge, die sich dem Thema des Entstehens und Etablierens von Neuerungen im Bildungswesen aus unterschiedlichen theoretischen Perspektiven und verschiedenen forschungsmethodischen Ansätzen nähern. So bietet der Band auch einen systematischen Überblick über aktuelle Felder und Befunde der bildungssystembezogenen Innovationsforschung.
Dr. Matthias Rürup ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Bildungsforschung in der School of Education der Bergischen Universität Wuppertal.
Dr. Inka Bormann ist Professorin für Allgemeine Erziehungswissenschaft an der Philipps-Universität Marburg.
Dr. Matthias Rürup ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Bildungsforschung in der School of Education der Bergischen Universität Wuppertal.Dr. Inka Bormann ist Professorin für Allgemeine Erziehungswissenschaft an der Philipps-Universität Marburg.
Inhalt 6
I Einführung 9
Innovation als Thema und Theoriebaustein der Educational Governance Forschung - Zur Einführung in den Herausgeberband 10
1. Educational Governance und Innovationsforschung 10
2. Vielfalt von ,Innovation' 14
3. Eine Heuristik der Innovation: Differente Forschungsgegenstände 17
4. Struktur des Bandes und Einordnung der einzelnen Beiträge 19
5. Innovation der Education Governance Perspektive durch Innovationsforschung? Integrierbares und Differentes 29
1. Differente Begrifflichkeiten für ähnliche Diagnosen: Die institutionelle Einbettung eigenständiger Akteure als vergleichbare analytischeAusgangsposition 29
2. Integration der heteronomen Konzepte und Befunde für eine Innovationstheorie mittlerer Reichweite 30
3. Vergleichbare Erwartungen bezüglich der Tiefe und Reichweite von Innovation und Wandel 32
4. Methodenpluralität als Kennzeichen und Verknüpfungsmöglichkeit von erziehungswissenschaftlicher Innovationsforschung und EducationalGovernance-Perspektive 33
Literatur 34
II Bestandsaufnahmen zur Innovationsforschung 41
Innovation in Schulen - Theorieansätze und Forschungsbefunde zur Schulentwicklung 42
1. Theoretische Ansätze zur Initiation von Innovationen: Wie kommt es zu Innovationen? 42
2. Prozessmodelle der Innovation – theoretische Ansätze und Forschungsbefunde 46
2.1 Theoretische Prozessmodelle für Innovationen 46
2.2 Studien zu Innovationsprozessen in Schulen 50
3. Voraussetzungen, Einflussfaktoren und Gelingensbedingungen 52
3.1 Schule als lernende Organisation – Theoretische Rahmenkonzeption und Forschungsstand 52
3.2 Visionen und Zielorientierungen 54
3.3 Infrastruktur der Innovation 55
3.4 Verfahren und Strategien für erfolgreiche Innovationsprozesse 58
4. Fazit 62
Literatur 62
Innovation als soziales Phänomen 67
1. Innovation in der Gesellschaft 67
2. Das Ende technisch-ökonomischer Deutungsdominanz 68
3. Grenzbegriffe und Bezeichnungspraxis 72
4. Sozialer Wandel und Erfolg 75
5. Entschiedener Wandlungsprozess und Innovationssemantik 77
Literatur 81
III Forschungsbeiträge zu Innovation als veränderter Inhalt 83
Wissensbezogene Innovationsanalyse - ein Beitrag zur Erweiterung von Forschungstraditionen 84
1. Innovation als soziale Innovation 85
2. Innovation als Vorgang kontextspezifischer Situierung von Sinn 86
2.1 Diffusion von Innovationen 87
2.2 Situierung von Sinn als Politikum: Aushandlung tolerabler Abweichungen 88
3. Medium und Dimensionen sozialer Innovationen 89
3.1 Zum Medium von Innovation 89
3.2 Innovationen als mehrdimensionale ‚Wissenspassagen‘ 90
4. Zur Analyse von ‚Wissenspassagen‘ 92
4.1 Diskursanalyse als Innovationsanalyse 93
4.1.1 Exemplarische Vorstellung und Diskussion zweier Diskurstypen 95
4.1.2 Interpretation der Ergebnisse aus der Governance-Perspektive: Zwei Formen von Wissenspassagen 98
5. Zusammenfassender Ausblick: Wissensbezogene Innovationsanalyse aus der Governance-Perspektive 100
Literatur 101
Der Einfluss dezentraler Entscheidungsebenen auf den schulischen Systemwandel in Schleswig-Holstein 105
1. Der formale Rahmen des Einrichtungsverfahrens 107
2. Das methodische Vorgehen zur Erfassung der relativen Effekte der beteiligten Handlungsebenen 109
3. Die Ergebnisse 111
4. Zusammenfassung und Interpretation 114
Literatur 117
IV Forschungsbeiträge zu Innovation als zielgerichteter Tätigkeit 119
Steuerung durch Bildungsstandards – Bildungsstandards als Innovation zwischen Implementation und Rezeption 120
1. Einführung in den Forschungskontext 120
2. Implementation von Innovationen in der Schule 123
3. Maßnahmen zur Implementation der Bildungsstandards und das Verständnis, das die Anwenderinnen und Anwender von der Innovation entwickeln 126
4. Innovation durch Implementation? – Kohärente Politik und Beteiligung der Akteure 134
5. Zusammenfassung und Fazit 136
Literatur 139
Implementation von Schulinnovationen 141
1. Einleitung 141
2. Definition: Innovation und Implementation 143
3. Schulorganisation in systemtheoretischer Perspektive: Entscheidungen und Entscheidungsprämissen 145
4. Theoretisches Modell und Fragestellungen 148
5. Methodik 151
6. Empirische Befunde 155
6.1 Einflussfaktoren auf die Innovationsverbreitung 155
6.2 Einflussfaktoren auf die Implementationstiefe 157
6.3 Zusammenfassung 158
7. Diskussion und Zusammenfassung 159
Literatur 162
Die Abnehmerperspektive: Rückmeldeforschung im Kontext schulischer Evaluation mittels zentraler Lernstandserhebungen 165
1. Einleitung 165
2. Innerschulische Innovationen durch Rückmeldungen aus zentralen Lernstandserhebungen – konzeptionelle Grundlagen und empirisch Befundlage 166
3. Innerschulische Innovationen durch Rückmeldungen aus zentralen Lernstandserhebungen – Konzeptionelle Weiterentwicklungen und empirische Befunde zur Innovationsqualität der Nutzung zentralerLernstandserhehungen 171
4. Diskussion und Resümee 177
Literatur 179
V Forschungsbeiträge zu Innovation als (emergenter) Wandel 181
Dispositive des Schöpferischen: Genealogie und Analyse gesellschaftlicher Innovationsdiskurse und institutioneller Strategien de Genese des Neuen 182
1. Zur diskursanalytischen Perspektive Michel Foucaults 184
1.1 Das Schöpferische aus der Diskursperspektive 185
1.2 Die Analyse der Dispositive der Macht 187
1.3 Genealogische Dispositivanalyse 188
2. Genealogie der Dispositive – Bilder des Schöpferischen 190
2.1 Das Dispositiv zyklischer Generativität 191
2.2 Das Dispositiv der Schöpfung als Akt 191
2.3 Das Dispositiv menschlicher Schöpferkraft 192
2.4 Das Dispositiv kollektiver Schöpferkraft 193
3. Strategien des Innovierens als Regieren des Schöpferischen – und der Zukunft 194
3.1 Vom „menschlichen Schöpfer“ zum „Unternehmer seiner Selbst“: Strategie der Freisetzung und Begleitung 195
3.2 Von „Schöpfung als Akt“ zu Experten, Evidenz, Prognose: Strategie der Berechenbarkeit und Versicherung 198
3.3 Systemische Transformation als Strategie kollektiver Zukunftsgestaltung 201
3.4 Ästhetische Reflexivität und ethische Kreativität: Strategie der Transzendenz des Subjekts 203
4. Zukunftsstrategien des Neuen, mixed governance, Kämpfe um Rationalität in epistemischen Terrains 205
4.1 „Mixed governance“ und die Herausforderungen „epistemischer Terrains“ 207
4.2 An den Wurzeln institutioneller Rationalisierungen: Dispositive des Schöpferischen als radikale Analyse von Machtwissensbeziehungen 208
Literatur 209
Schulinspektorinnen und Schulinspektoren zwischen Schulentwicklung und bildungspolitischer Innovation 213
1. Einleitung 213
2. Schulinspektionen als Teil einer bildungspolitischen Innovationsstrategie 216
2.1 Schulinspektion in Deutschland: Entwicklung, Kontrolle, Implementation 216
2.2 Schulinspektor/inn/en als neue Akteure im Schulsystem 219
2.3 Das Fallbeispiel: Die Fremdevaluation in Baden-Württemberg3 221
3. Empirische Explorationen: Die erste Generation der Fremdevaluator/ inn/en in Baden-Württemberg 223
3.1 Evaluator/inn/en oder Inspektor/inn/en? 224
3.2 Konzept vs. Verfahren: Tun und tun sollen 226
3.3 Zur Empfehlungspraxis der Fremdevaluator/inn/en 229
4. Innovieren als Vermittlung zwischen Schulentwicklung und bildungspolitischer Innovation: Diskussion der Ergebnisse 231
Literatur 235
Transformation der Schule – praxistheoretisch gesehen. Rekonstruktionen am Beispiel von Familiarisierungspraktiken 238
1. Einleitung 238
2. Praktiken und Lernkultur 239
3. Familie und Ganztagsschule 241
4. Familiarisierung im Ganztag: Symbolische Konstruktionen und pädagogische Praktiken 243
5. Resümee: Familiarisierung und die praxistheoretische Analyse der Transformation 249
Literatur 251
VI Forschungsbeiträge zu Innovation als Eigenschaft (Innovativität) 255
Graswurzelbewegungen der Innovation - Zur Innovativität von Schulen und Lehrkräften „At-the-Bottom“ der Schullandschaft 256
1. Einleitung 256
2. Begriffsbestimmungen: Innovation, Reform und Wandel 257
2.1 Konzeptionelle Abgrenzungen 257
2.2 Bezugspunkte in der aktuellen Bildungsforschung 260
3. Unvollständige Gegensätze: Top-Down und Bottom-Up 262
4. Graswurzelbewegungen der schulischen Innovation als Forschungsansatz 269
4.1 At-the-Bottom-Innovation im Schulwesen als Theorie und Operationalisierung 270
4.2 Untersuchungsmodell zu Innovationsdiffusion 274
4.3 Forschungsstrategie zu At-the-Bottom-Innovationen im deutschen Schulwesen 275
5. Graswurzelinnovationen – Hinweise aus einem Lehrfoschungsprojekt 278
5.1 Gibt es schulische Innovationen ohne administrative Unterstützung? 279
5.2 Sind nicht nur die sowieso schon Innovativen innovativ? 283
5.3 Sind die Innovationen wesentlich unabhängig von externen Einflüssen und Anreizen? 284
6. Ausblick 285
Literatur 285
Innovationskompetenz als Element der Lehrerausbildung Befunde und Perspektiven 289
1. Einleitung 289
2. Theoretischer Hintergrund 290
2.1 Pragmatistisches Begriffsverständnis von Innovation 290
2.2 Aktivitäten und Ansätze zur Erfassung und Ausbildung von Innovationskompetenz 292
3. Forschungsfragen 296
4. Methodisches Vorgehen 296
4.1 Anlage der Untersuchung 296
4.2 Quantitative Hauptuntersuchung 297
4.2.1 Erhebungsinstrumente' 297
4.2.2 Stichprobe 298
4.2.3 Statistische Auswertung 299
4.3 Qualitative Ergänzungsuntersuchung 299
4.3.1 Durchführung von Experteninterviews 299
4.3.2 Die Experten 299
4.3.3 Auswertung des qualitativen Datenmaterials 300
5. Empirische Befunde 300
5.1 Einschätzung der Standards 300
5.2 Lernorte der Standards 302
5.3 Einflussfaktoren auf die Fähigkeitseinschätzung 305
6. Perspektiven zur Förderung von Innovationskompetenz in der Lehrerausbildung 306
Literatur 310
Der Einfluss der Motivation von Lehrpersonen auf den Transfer von Innovationen 314
1. Einleitung 314
2. Stand der Forschung 315
2.1 Transfererfolg 315
2.2 Einflussfaktoren auf den Transfer 316
2.3 Die Motivation von Lehrerinnen und Lehrern 317
2.4 Bildung für nachhaltige Entwicklung, Gestaltungskompetenz und Innovation 319
2.5 Fragestellungen 320
3. Methode 320
3.1 Durchführung 320
3.2 Beschreibung der Stichprobe 321
3.3 Aufbau des Erhebungsinstruments und Beschreibung der Skalen 321
4. Ergebnisse 323
4.1 Prädiktoren der Motivationsformen 324
4.2 Der Einfluss der Motivationsformen auf den Transfer einer Innovationsidee 326
5. Diskussion 327
5.1 Ergebnisse zur Motivation von Lehrkräften 327
5.2 Ergebnisse zum Transfererfolg 328
6. Fazit 329
Literatur 330
Autorinnen und Autoren 333
| Erscheint lt. Verlag | 20.10.2012 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Educational Governance |
| Educational Governance | |
| Zusatzinfo | VII, 345 S. 12 Abb. |
| Verlagsort | Wiesbaden |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Geisteswissenschaften |
| Sozialwissenschaften ► Pädagogik | |
| Technik | |
| Schlagworte | Bildungsforschung • Educational Governance • Innovationsforschung • Schulentwicklung |
| ISBN-10 | 3-531-19701-0 / 3531197010 |
| ISBN-13 | 978-3-531-19701-2 / 9783531197012 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 239,5 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: PDF (Portable Document Format)
Mit einem festen Seitenlayout eignet sich die PDF besonders für Fachbücher mit Spalten, Tabellen und Abbildungen. Eine PDF kann auf fast allen Geräten angezeigt werden, ist aber für kleine Displays (Smartphone, eReader) nur eingeschränkt geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. den Adobe Reader oder Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. die kostenlose Adobe Digital Editions-App.
Zusätzliches Feature: Online Lesen
Dieses eBook können Sie zusätzlich zum Download auch online im Webbrowser lesen.
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich