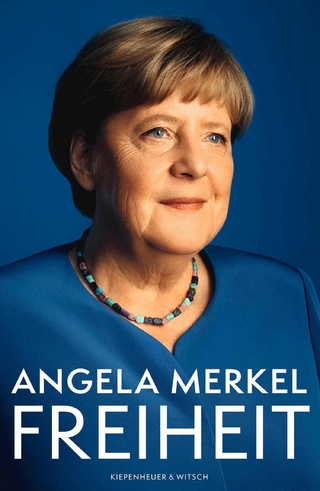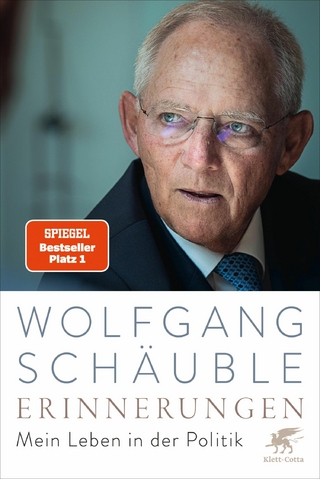Arletty und ihr deutscher Offizier (eBook)
448 Seiten
S. Fischer Verlag GmbH
978-3-10-400761-8 (ISBN)
Klaus Harpprecht (1927-2016) arbeitete viele Jahre als Journalist, u.a. für den RIAS Berlin, SFB und WDR. Er war der erste Amerika-Korrespondent für das ZDF und fertigte mehr als fünfzig Fernsehdokumentationen. 1966 bis 1969 Leiter des S. Fischer Verlags, 1972 bis 1974 Redenschreiber und Berater von Bundeskanzler Willy Brandt. Regelmäßige Beiträge für die »Süddeutsche Zeitung«, »Frankfurter Allgemeine Zeitung« und vor allem »Die Zeit«. Klaus Harpprecht ist Autor und Herausgeber vieler erfolgreicher Bücher, darunter seine hoch gerühmte Biographie Thomas Manns, eine Biographie Marion Gräfin Dönhoffs und zuletzt die Geschichte einer Liebe in Zeiten des Krieges: ?Arletty und ihr deutscher Offizier?. Zu seinen vielfachen Auszeichnungen gehören der Lessing-Preis der Hansestadt Hamburg, der Theodor-Wolff-Preis und der Schlag zum Ritter der französischen Ehrenlegion. Mit seiner Frau Renate Lasker-Harpprecht lebte er seit 1982 im südfranzösischen La Croix-Valmer.
Klaus Harpprecht (1927-2016) arbeitete viele Jahre als Journalist, u.a. für den RIAS Berlin, SFB und WDR. Er war der erste Amerika-Korrespondent für das ZDF und fertigte mehr als fünfzig Fernsehdokumentationen. 1966 bis 1969 Leiter des S. Fischer Verlags, 1972 bis 1974 Redenschreiber und Berater von Bundeskanzler Willy Brandt. Regelmäßige Beiträge für die »Süddeutsche Zeitung«, »Frankfurter Allgemeine Zeitung« und vor allem »Die Zeit«. Klaus Harpprecht ist Autor und Herausgeber vieler erfolgreicher Bücher, darunter seine hoch gerühmte Biographie Thomas Manns, eine Biographie Marion Gräfin Dönhoffs und zuletzt die Geschichte einer Liebe in Zeiten des Krieges: ›Arletty und ihr deutscher Offizier‹. Zu seinen vielfachen Auszeichnungen gehören der Lessing-Preis der Hansestadt Hamburg, der Theodor-Wolff-Preis und der Schlag zum Ritter der französischen Ehrenlegion. Mit seiner Frau Renate Lasker-Harpprecht lebte er seit 1982 im südfranzösischen La Croix-Valmer.
Das Mädchen aus der Vorstadt
Arletty hasste den Krieg. Sie hasste ihn seit dem schrecklichen August 1914, als in Europa die Lichter zu verlöschen begannen, in jenen dramatischen Tagen, als die Deutschen – die Mehrheit ihrer Dichter und Denker voran – und nicht anders die Franzosen – auch sie samt ihren Eliten – im patriotischen Rausch zu Hunderttausenden, ja Millionen zu den Waffen eilten, angetrieben von jauchzenden Frauen, die ihre Gewehre mit Blumen schmückten.
Léonie Bathiat, die einige Jahre später Arletty heißen würde, zählte sechzehn Jahre, aufgewachsen in dem grauen Vorort Courbevoie am Ufer der Seine, einem Quartier der Arbeiterschaft, einer »kleinen Welt der Wäscherinnen und Büglerinnen«, wie sie sagte; auch die Mutter wusch ihre Wäsche im Fluss. Sie spielte in den Gärten und im Gesträuch des Nachbargeländes, wo heute die gläsernen Türme der Konzern-Hauptquartiere »La Defense« aufragen, das Manhattan von Paris, nach dem alten Fort und der Kaserne benannt, in der die Schweizer Garden der Könige lagen. Als der Vater, ein gelernter Bergmann, zum technischen Chef des Straßenbahn-Depots avancierte, in dem er seit zwei Jahrzehnten sein Geld verdiente, zog die Familie zunächst ins nahe Puteaux, was eine Stufe des Aufstiegs bedeutete, dann wieder zurück ins heimatliche Courbevoie, in eine größere und hellere Wohnung in einem modernen Klinkerbau, in dem es elektrisches Licht gab – ein Luxus in jenen Zeiten.
Die erste Liebe: ein hübscher junger Mann mit leuchtend blauen Augen, den sie darum »Ciel« nannte, den Himmel. In Courbevoie, sagte sie hernach, ließen die Mädchen sich ihre Unberührtheit nicht abkaufen – sie verschenkten sie. Wurde »Ciel« die Liebesgabe zuteil? Er fiel am fünfzehnten August 1914, der erste im Lebenskreis Léonies und weiß Gott nicht der letzte. Seitdem hasste sie den Krieg. Und sie schwor sich, niemals zu heiraten und niemals Kinder zu haben, denn der nächste Krieg, sagte sie, würde sie zur Witwe machen oder ihre Söhne töten – wie es in Frankreich, in Deutschland, in England, in Russland nun millionenfach geschah. Das sollte ihr nicht widerfahren.
Im September 1914 wurde sie von einer Sekretariatsschule diplomiert. Sie bewarb sich um eine Stelle im Justizministerium unter Aristide Briand, dessen Blick so gern auf den Röcken der Mädchen weilte (wenn er denn weilte) – und sie wurde angenommen. Sie liebte die sonore und so musikalische Stimme des Chefs, den man dank seiner Rhetorik, die den Ohren schmeichelte, »das Cello« genannt hat. Wie lange sie es im Ministerium aushielt, weiß man nicht. Sie wechselte die Positionen oft, ungeduldig und schnell gelangweilt.
Das hübsche Mädchen mit den dunklen Augen, dem leichten Lachen und der raschen Bereitschaft zum Flirt schien von einer merkwürdigen Unruhe getrieben zu sein. Sein Gemüt, ohnedies von schwankenden Stimmungen heimgesucht, verdüsterte sich, als der geliebte Vater am Abend des ersten Dezember 1916 schwer verletzt in die Wohnung geschleppt wurde: Eine Straßenbahn (ausgerechnet) hatte ihn auf der Brücke von Neuilly überfahren. Im Hospital konnte ihm keiner mehr helfen. Er starb in der Nacht gegen zwei Uhr, vierundvierzig Jahre alt, ein stattlicher, männlicher Mann, freundlich, nüchtern, politisch eher zur Linken neigend – ein Vetter assistierte dem großen Sozialistenführer Jean Jaurès, der am Vorabend des Krieges ermordet wurde –, antiklerikal, bekennender Atheist. »Dreyfusiard«, seit Emile Zolas großer Anklage von der Unschuld des jüdischen Offiziers überzeugt – im Gegensatz zu seiner Frau, die zur anderen der beiden Grundparteien gehörte, von denen Frankreichs Gesellschaft geteilt war: eine unbelehrbare »Anti-Dreyfusiarde«, fromm, katholisch, wie die schönen, klaren Züge des Gesichtes vermuten lassen eher streng mit der Tochter, die als kleines Mädchen von plötzlichen Konvulsionen heimgesucht worden war, vielleicht einer Art Epilepsie.
Arlettys Vater Michel Bathiat –
1916 tödlich verunglückt
Der Hausarzt riet damals dringend zum Luftwechsel. Also wurde Léonie in die Auvergne, die Heimat der Familie geschickt, zunächst unter die Fittiche des Onkels Abbé Dautreix, der als geistlicher Hirte eines Konvents in Montferrand bei Clermont wirkte. Bei den Nonnen lernte Léonie Lesen und Schreiben – und, das betonte sie wieder und wieder, die Disziplin, die sie im Beruf bewies, auch im Alltag (wenn es ihr behagte). Nach einigen Monaten wurde sie weitergereicht zur Großmutter in den Bergen. In den nächsten Jahren wechselte das Kind im Sechsmonatsrhythmus von der Stadt aufs Land und zurück.
Erste Kommunion, sie war elf Jahre alt. Für ihren Biographen Denis Demonpion entwarf sie mehr als ein halbes Jahrhundert später ein ironisches Bild der kleinen Katholikin: »Bleiches und ernstes Gesicht, schwarzes Band im Haar, die Augen auf das Messbuch in meinen Händen gesenkt. Nichts ließ meine Ungläubigkeit erraten … Ich bin Atheistin, Gott sei Dank«. Sie war es schon damals unterm Kommunionsschleier. »Gut, Gott hat Himmel und Erde geschaffen, aber wer hat Gott geschaffen?«, fragte sie einen kleinen Freund. Statt einer Antwort verpasste ihr das fromme Bürschchen eine missionarische Ohrfeige. Sie zeigte keine Wirkung. Fröhlich hielt Léonie an ihrem Unglauben fest, unbeirrt auch in Stunden der Not und der Traurigkeit, wenn andere Zuflucht im Gebet suchen.
Geldsorgen nach dem Tod des Vaters. Die Tramway-Gesellschaft zahlte erst nach Jahren eine winzige Rente aus. Die Frau und die Kinder mussten die bequeme Betriebswohnung räumen. Unterschlupf in einer dürftigen, dunklen, engen Behausung. Die Mutter verdingte sich als Granatendreherin in einer Munitionsfabrik, Léonie fand eine Arbeit im gleichen Unternehmen am Kontrollstand. Hastig rettete sie sich drei Monate später aus dem Stumpfsinn der Geschossproduktion in die Stelle einer Stenotypistin, doch nach wenigen Wochen, als der Vorgesetzte ihr krumm kam, rannte sie davon.
Was trieb sie danach? Sie gab darüber niemals präzise Auskunft. Einmal noch, das war ihr zu entlocken, versuchte sie sich im Büro, beim Rüstungskonzern Schneider-Creusot. Nach drei oder vier Monaten beschloss Léonie, sie habe mit der Welt der Underwood-Schreibmaschinen und der Stenographie nach der Methode Prévost-Delaunay nichts mehr zu schaffen. Und dann? Womit vertrieb sie sich die Zeit? Schlenderte sie nur durch die Straßen von Paris, die eleganten Schaufenster musternd?
Ihrem ersten dauerhaften »amant« begegnete sie zwischen der Porte Maillot und der Brücke von Neuilly. Er erwies sich als der geradezu ideale Liebhaber, der ihr die Sorge ums tägliche Brot abnahm. Ein freundlich-höflicher, wohl gekleideter Mann, der etwas dahermachte, dunkle Haare, blaue Augen, ein gutes Stück älter als sie (sie war neunzehn), der weltmännisch gebildete Sohn einer Basler Bankiersfamilie, jüdisch, in Paris weiß der Himmel welche Geschäfte betreibend. Sprach er sie an? Oder sie ihn? Wie immer es gewesen sein mag: M. Lévy erwies sich als ein unterhaltsamer und musischer Mensch, kein ordinärer Kaufmann. Sein Französisch war untadelig, ja elegant, doch es ließ einen leichten deutsch-schweizerischen Akzent erkennen. Seiner helvetischen Herkunft wegen nannte ihn Léonie »Edelweiß«, ein für alle Mal. (Woher hatte sie den Namen? Könnte es sein, dass sie als Kind an die französische Übersetzung von Johanna Spirys Heidi geraten war? Oder fand sie ihn in einem Roman von Maupassant, der »die bleiche Blume der Gletscher«, die »Schneeblüten«, die »immortelle des neiges« mit ihrer alpenländischen Bezeichnung beschrieb, die sich so poetisch ausnahm?) »Edelweiß« führte sie in die koscheren Restaurants der rue des Rosiers, nicht weit von den »Folies Bergère«, die eher das Ziel ihrer Neugier waren. Sie lernte bei ihm einige jiddische Worte, zum Beispiel »pill-pull« – ein Begriff, der die haarspalterischen Argumentationen um die rechte Auslegung der Thora in den Yeshiven, den Rabbinatsschulen, bildhaft und drastisch charakterisierte.
Jacques-Georges Lévy bot ihr an, ein Zimmer in seiner Villa in Garges, einem noblen Quartier hinter St. Cloud, zu beziehen, damit sie der häuslichen Enge entkomme. In La Defense, ihrer aperçuhaft knappen Autobiographie, bemerkte sie über die erste Nacht im Hause »Edelweiß« kurz angebunden: »Ich schlüpfte als Jungfrau ins Bett und verließ es als Frau«. Und in den Jahren davor? War sie das, was die Amerikaner nicht allzu schmeichelhaft eine »tease« nennen, eine Verführerin, die vor dem natürlichen Ziel der Lockungen eisern die Knie zusammenklammert und sich dann eilends davonmacht? Wie auch immer, »Edelweiß« bot ihr eine kurzweilige Existenz. Es störte sie nicht, »ausgehalten« zu werden und als die Maitresse des M. Lévy zu gelten, der im gemeinsamen Alltag und in Gesellschaft Takt und Sensibilität bewies. Als Maitressen fristeten Tausende junger und nicht mehr ganz junger Frauen in Paris ihr Leben. Trotz der materiellen Abhängigkeit sah Léonie ihre innere Freiheit niemals bedroht. Sie äußerte sich weder damals noch später zur Frage der Emanzipation (oder doch nur beiläufig). Das Thema interessierte sie nicht. Sie war emanzipiert. Und was die Liebe, was die amourösen Affären anging: sie betonte immer aufs Neue, dass sie es sei, die den Mann auswähle, nicht der Mann sie. Es war so. Für manchen Herrn schien es eher schmerzhaft zu sein, das zu begreifen.
Als sie die Mutter wissen ließ, dass sie bei ihrem Verehrer wohnen werde, fuhr der heilige katholische Zorn auf sie hernieder. Sie solle sofort verschwinden, zeterte die Mama, es gebe nun kein Zurück mehr....
| Erscheint lt. Verlag | 12.5.2011 |
|---|---|
| Verlagsort | Frankfurt am Main |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Literatur ► Biografien / Erfahrungsberichte |
| Literatur ► Romane / Erzählungen | |
| Schlagworte | Arletty • Berlin • Besatzung • Deutsche Besatzung • Deutschland • Die Kinder des Olymp • Ernst Jünger • Frankreich • Französischer Film • Französisches Kino • Gerhard Heller • Gestapo • Hans Jürgen Soehring • Jean Louis Barrault • Kino • Kollaboration • Leonie Biathat • Les enfants du paradis • Marcel Carné • Michel Camé • Michel Carné • München • Okkupation • Paris • Sachbuch • Vichy |
| ISBN-10 | 3-10-400761-6 / 3104007616 |
| ISBN-13 | 978-3-10-400761-8 / 9783104007618 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 2,4 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich