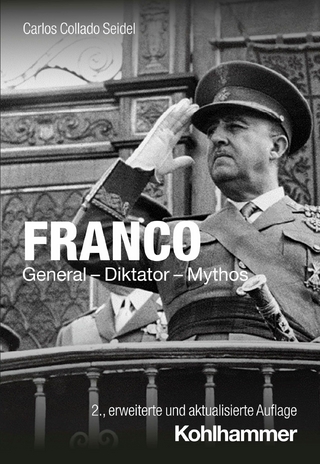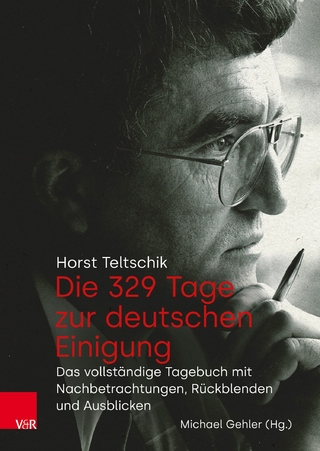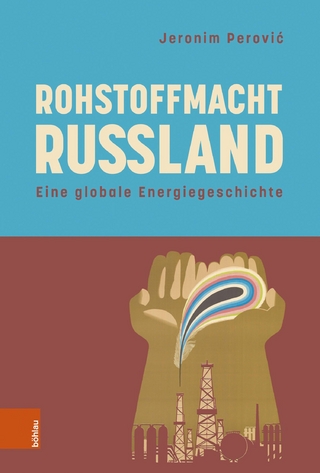Ich harre aus im Land und geh, ihm fremd (eBook)
547 Seiten
Campus Verlag
978-3-593-40763-0 (ISBN)
Heike Wolter, Dr. phil., promovierte an der Technischen Universität Dresden.
Heike Wolter, Dr. phil., promovierte an der Technischen Universität Dresden.
Inhalt 8
Danksagung 12
Vorwort 14
I Einleitung 17
I.1 Problemstellung und zeitliche Abgrenzung 17
I.2 Begrifflichkeiten 23
I.3 Quellenlage 27
I.4 Forschungsstand 36
I.5 Aufbau und methodischer Zugang 42
II Einordnung der touristischen Entwicklung in das System der DDR 51
II.1 Historische Entwicklung 51
II.2 Rechtliche Grundlagen 73
II.3 Staatliche Tourismuspolitik: Leitung, Planung, Finanzierung und Organisation 88
III Reisen von DDR-Bürgern 119
III.1 Reiseformen 119
III.1.1 Institutionell organisierte Reisen 119
III.1.2 Individuell organisierte Reisen 121
III.2 Reiseziele 124
III.2.1 Inlandsreisen 124
III.2.2 Auslandsreisen 143
III.2.3 Sonderfall: Reisen in die Bundesrepublik Deutschland 177
IV Reiseveranstalter 182
IV.1 Freier Deutscher Gewerkschaftsbund (FDGB) 185
IV.2 Betriebe 212
IV.3 Reisebüro der DDR 220
IV.4 Jugendtourist 227
IV.5 Reiseangebote anderer gesellschaftlicher Institutionen 259
V Weitere (Teil-)Leistungsanbieter 267
V.1 Camping 267
V.2 Freies Beherbergungswesen 281
V.3 Privatquartiere 285
V.4 Kinder- und Jugenderholung 286
V.5 Gastronomie 299
V.6 Touristische Informationseinrichtungen (TIE) 305
V.7 Kleingärten, Datschen und Ferienhäuser 306
VI Reiseverkehrsmittel 309
VI.1 Pkw 312
VI.2 Omnibus 316
VI.3 Deutsche Reichsbahn 317
VI.4 Interflug 324
VI.5 Schiff 326
VII Wahrnehmungen 333
VII.1 Zeitgenössische Bedarfsforschung 333
VII.2 Zeitgenössische mediale Formungen 336
VII.3 Zeitgenössische individuelle Aneignungen 369
VII.4 Eingaben und Ausreiseanträge 376
VII.5 Retrospektive Interviews und Erinnerungsliteratur 384
VII.6 Ausblick: Tourismus in der Systemtransformation 390
VIII Tourismusgeschichte als Spiegel der DDR-Geschichte 396
VIII.1 Totalitarismustheorien 398
VIII.2 Modernisierungstheorien 404
VIII.3 Typen legitimer Herrschaft nach Max Weber 411
VIII.4 Handlungstheoretische Mikrotheorien 414
VIII.6 Eine Theorie des Tourismus von DDR-Bürgern? 425
IX Komparatistische Ansätze: Bisherige Forschungen und Desiderate 426
IX.1 Vergleich, Transfer, histoire croisée 426
IX.2 Diachrone Vergleiche 431
IX.2.1 Kontinuitäten – Strukturen langer Dauer 431
IX.2.2 DDR – Weimarer Republik 433
IX.2.3 DDR – Nationalsozialismus 434
IX.3 Synchrone Vergleiche 437
IX.3.1 DDR – Bundesrepublik Deutschland 437
IX.3.2 DDR – Osteuropäische Länder 442
IX.3.3 DDR – Westeuropäische Länder 445
X Schlussbetrachtung 446
X.1 Offene Fragen 446
X.2 Resümee 450
Quellen und Literatur 460
Archivbestände 460
Bundesarchiv, Berlin 460
Sächsisches Hauptstaatsarchiv, Dresden 469
Anordnungen, Beschlüsse, Erlässe, Gesetze, Ordnungen, Pläne, Verträge und Vorschriften 470
Literatur 475
Internetquellen 534
Audiovisuelle Materialien 539
Dokumente in Privatbesitz 539
Interviews 541
Abkürzungsverzeichnis 542
Tabellenverzeichnis 544
Abbildungsverzeichnis 545
Anhänge 546
Versorgung Mit dem Erhalt einer Reise vom Feriendienst des FDGB verband sich für den Urlauber nicht nur Unterbringung am Ferienort, sondern auch Vollpension. Es ist zu vermuten, dass diese Regelung es im planwirtschaftlichen System der DDR am besten ermöglichte, die Erfordernisse des Nahrungsbedarfs berechenbar zu kanalisieren. Da die freien gastronomischen Einrichtungen nur über unzureichende räumliche und zeitliche Kapazitäten sowie begrenzte Lebensmittelmengen verfügten, konnte die Versorgung der Urlauber nur auf diesem Wege sichergestellt werden. Die Verpflegung beim Feriendienst erfolgte zumeist in groß angelegten, zentral im Ferienort gelegenen Gaststätten, die meist durch den FDGB vertraglich gebunden waren und somit nicht zum öffentlichen Gastronomieangebot zählten. Die Kantinen-Qualität des dortigen Essens sowie die Bedingungen der Einnahme der Mahlzeiten stellten den am häufigsten kritisierten Bereich des Feriendienstes dar. 'Mit der Verpflegung wurde es im Laufe der Zeit allerdings immer mieser. Oft mußten wir uns vor dem Öffnen des Speisesaales an eine Schlange anstellen, um noch das Beste zu erwischen. Vor allem abends hatten wir zu tun, noch eine gewisse Auswahl an Wurstsorten vorzufinden, sonst konnte es passieren, daß wir nur noch Blutwurst am kalten Bufett fanden.' Zwar war die Problematik bei den verantwortlichen Stellen bekannt, doch schien es wenig konkrete Verbesserungen zu geben. So wurde immer wieder gemahnt, 'auf ein abwechslungsreiches, schmackhaftes und gesundheitsförderndes Angebot an Speisen und Getränken sowie eine kulturelle Atmosphäre in den gastronomischen Einrichtungen' zu achten. Dies war angesichts der Verpflegungssätze für gastronomische Einrichtungen der Vertragspartner nicht immer einfach, denn je nach Qualitätsstufe der Reise lagen die Preise für Vollverpflegung 1985 zum Beispiel zwischen 6,65 Mark und 9,60 Mark pro Tag und Urlauber. Sie wurden nach Rahmenspeiseplänen berechnet und entsprachen manchmal nicht den realen Bedingungen beziehungsweise erlaubten nur die Bereitstellung eines Basissortiments. Innerhalb der verschiedenen Bereitstellungssysteme schien sich die Ausgabe von Wertmarken größter Beliebtheit zu erfreuen, denn dieses Vorgehen stellte zumindest eine gewisse Flexibilisierung dar. Die Vorgaben für die Urlauber waren insgesamt recht eng und bestimmten - vor allem in den siebziger Jahren - angesichts der Vollverpflegung oft den Tagesablauf. So war Folgendes üblich: 'Bei FDGB-Reisen war das manchmal mit Essenszeiten: 18 bis 19 oder 19 bis 20 [Uhr, H.W.]. Weil's eigentlich nicht anders ging.' Die zunehmende Flexibilisierung der Essenszeiten - angesichts des Arbeitskräftemangels in der Gastronomie beim Feriendienst schwierig zu organisieren - stellte eine wichtige Verbesserung in vielen gastronomischen Einrichtungen des FDGB in den achtziger Jahren dar. So erklärte Willibald Scholz vom FDGB-Feriendienstobjekt Schmiedefeld 1988 auf die Frage, was bei den Urlaubern besonders ankäme: '[...] haben wir die Essenszeiten auf eineinhalb bis zweieinhalb Stunden verlängert. Diese Freizügigkeit findet große Resonanz, die Wartezeiten verkürzten sich wesentlich. Prima finden die Urlauber auch das Wanderbonsystem, welches ihnen gestattet, ein vorbestelltes Mittagessen in anderen Erholungsheimen des Bezirkes einzunehmen.' Reisebegleitprogramm Ein vielseitiges sportliches und kulturelles Programm galt als fester Bestandteil der Reisen des FDGB. Es wurde sowohl von den Mitarbeitern der einzelnen Ferienobjekte veranstaltet als auch in Zusammenarbeit mit anderen gesellschaftlichen Organisationen, wie der Urania oder dem Deutschen Turn- und Sportbund, angeboten. Besonders in den fünfziger und sechziger Jahren schien die ideologische Einflussnahme durch entsprechende Veranstaltungen noch recht stark zu sein. Der Zwang zu kollektiver Urlaubsgestaltung ließ vor allem ab den siebziger Jahren stark nach, doch noch im April 1982 hielt es der Vorsitzende des FDGB, Harry Tisch, für notwendig, auf dem 10. FDGB-Kongress darauf hinzuweisen: 'Eine Bemerkung zur Urlaubsgestaltung. Dafür gibt es ein weitgefächertes Angebot in den Ferienheimen. Doch sollten wir bei all den Aktivitäten nicht außer acht lassen, daß der Urlauber sich ganz so erholen soll, wie er es selbst gerne möchte. Wenn er laufen will, mag er laufen; aber möchte er schlafen, dann soll man ihn nicht stören (Beifall).' Zwar waren weiterhin die Förderung des Gemeinschaftsgefühls, möglichst auch sozialistische Inhalte und eine dem Inhalt entsprechende Form der Veranstaltungen das Ziel aller Betreuungsangebote, doch sollte nun mehr auf die Bedürfnisse des Gastes Rücksicht genommen werden. Daher rückte seit den siebziger Jahren die sportliche Betreuung der Urlauber im Sinne einer aktiven Reproduktion der Arbeitskraft in den Mittelpunkt der Bemühungen. In den neuerbauten oder rekonstruierten FDGB-Ferienkomplexen waren (Klein-)Sportanlagen, Räume mit Geräten für sportliche Betätigung und die Ausleihe von Sportgeräten meist selbstverständlicher Bestandteil der Betreuungsleistungen. Zudem wurden - organisiert von Instrukteuren für Urlaubersport bei den jeweiligen FDGB-Bezirksvorständen und von lokal arbeitenden Sportorganisatoren der einzelnen FDGB-Ferienobjekte - verschiedenste kollektive Sportveranstaltungen (zum Beispiel Morgengymnastik, Wanderungen und Urlaubersportfeste) angeboten. Seit 1968 gab es zudem landesweit Urlauberolympiaden. Ab 1971 führte der FDGB gemeinsam mit der Redaktion des Deutschen Sportechos und der Tribüne die Aktion ?Mein Urlaub - kein Urlaub vom Sport? durch und ließ sie entsprechend propagandistisch unterstützen: 'Wenn Alfons Dickbier mit seinem FDGB-Ferienscheck in der Hand eines unserer Urlauberheime betritt und nun glaubt, dreizehn Tage faulenzen, träumen, schlafen zu können, ist er ein bissel auf'm Holzweg. Denn, Bürger Dickbier, das ist keine aktive Erholung!' Das Ziel lautete: 'Die sportlichste Erholungseinrichtung wird gesucht.' Innerhalb des kulturellen Rahmenprogramms gab es beispielsweise Lesungen und (Lichtbilder-) Vorträge in öffentlichen und heimeigenen Bibliotheken sowie Mal-, Strick- und Bastelkurse.
| Erscheint lt. Verlag | 5.10.2009 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Beiträge zur Historischen Verkehrsforschung des Deutschen Museums |
| Beiträge zur Historischen Verkehrsforschung des Deutschen Museums | |
| Zusatzinfo | 21 Tabellen, 10 Abbildungen |
| Verlagsort | Frankfurt am Main |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Geschichte ► Allgemeine Geschichte ► Zeitgeschichte |
| Sozialwissenschaften ► Politik / Verwaltung | |
| Schlagworte | DDR • Reisen • Tourismusgeschichte |
| ISBN-10 | 3-593-40763-9 / 3593407639 |
| ISBN-13 | 978-3-593-40763-0 / 9783593407630 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 3,6 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: PDF (Portable Document Format)
Mit einem festen Seitenlayout eignet sich die PDF besonders für Fachbücher mit Spalten, Tabellen und Abbildungen. Eine PDF kann auf fast allen Geräten angezeigt werden, ist aber für kleine Displays (Smartphone, eReader) nur eingeschränkt geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. den Adobe Reader oder Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. die kostenlose Adobe Digital Editions-App.
Zusätzliches Feature: Online Lesen
Dieses eBook können Sie zusätzlich zum Download auch online im Webbrowser lesen.
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich