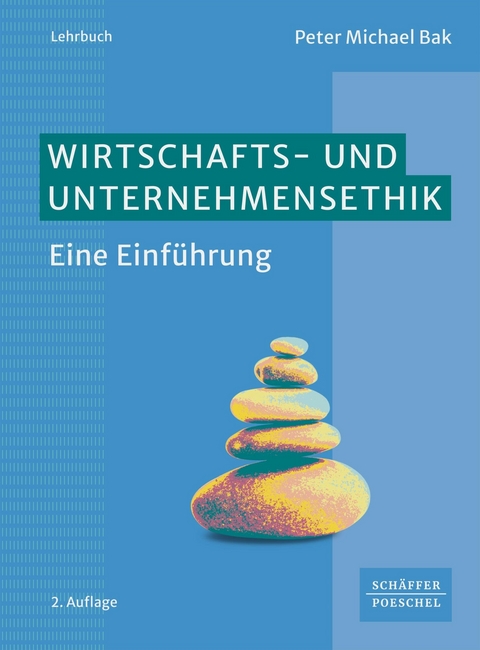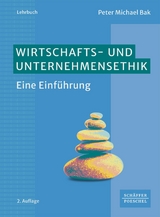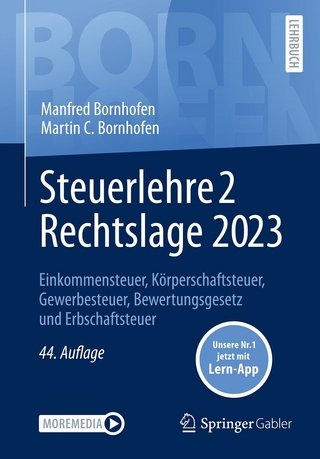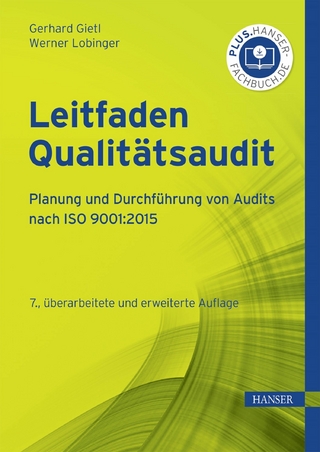Wirtschafts- und Unternehmensethik (eBook)
172 Seiten
Schäffer-Poeschel Verlag
978-3-7910-6321-8 (ISBN)
Diplom-Psychologe Prof. Dr. Peter Michael Bak lehrt an der Hochschule Fresenius in Köln und anderen nationalen wie internationalen Hochschulen. Er ist als Berater für Unternehmer sowie als Coach für Fach- und Führungskräfte tätig.
Peter Michael Bak Diplom-Psychologe Prof. Dr. Peter Michael Bak lehrt an der Hochschule Fresenius in Köln und anderen nationalen wie internationalen Hochschulen. Er ist als Berater für Unternehmer sowie als Coach für Fach- und Führungskräfte tätig.
2.5 Gerechtigkeit
Es gibt wohl kaum einen Begriff, der so eng mit unseren moralischen Vorstellungen verbunden ist, wie der der Gerechtigkeit (umfassend dazu siehe Goppel, A., Mieth, C./Neuhäuser, C. 2016). Für den berühmten griechischen Philosophen Platon (428/427-348/347 vor unserer Zeitrechnung) ist sie eine der Kardinaltugenden, also eine Art Schlüsselmerkmal für den moralischen Menschen. Gerechtigkeit ist ein übergeordnetes Konzept, das den bisher betrachteten Perspektiven vorangestellt werden kann:
-
Gerecht zu sein, ist ein Wesensmerkmal einer moralisch integren Person (Gesinnungsethik).
-
Gerecht zu sein, gebietet uns die Vernunft (Pflichtenethik).
-
Gerecht zu sein, schließt die Berücksichtigung von Handlungs- und Entscheidungsfolgen ein (Folgenethik).
-
Gerecht zu sein, nutzt allen (Utilitarismus).
Gerechtigkeit, wen wundert es, ist ein wichtiges Ziel unserer sozialen Regeln und Normen, die den Umgang miteinander innerhalb unserer sozialen Gemeinschaft und zwischen sozialen Gemeinschaften regeln. Gerechtigkeit gehört zu den zentralen Prinzipien, an denen wir uns bei der Gestaltung des Gemeinwesens orientieren. So wird beispielsweise das Prinzip der Gleichheit, ein wichtiges Kriterium von Gerechtigkeit, schon in Artikel 1 der Erklärung der Menschenrechte festgehalten: »Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren« (siehe Vertiefung 1).
Ganz allgemein kann man Gerechtigkeit zum einen als eine Art Vergleichsprinzip auffassen, anhand dessen zwei oder mehrere Dinge, Sachverhalte oder Ereignisse miteinander hinsichtlich eines bestimmten Verhältnisses zueinander verglichen werden. Gerechtigkeit kann zum anderen als der Zustand angesehen werden, in dem in Bezug auf einen Vergleichsmaßstab Gleichheit herrscht.
Grundsätzlich wird u. a. unterschieden zwischen der retributiven Gerechtigkeit, bei der es um gerechte Bestrafung, gerechte Sanktionen für Regelverstöße oder Normverletzungen geht, der distributiven Gerechtigkeit, bei der es um die gerechte Verteilung von materiellen wie immateriellen Gütern geht, und der Verfahrensgerechtigkeit, bei der es um die gerechte Entscheidungsprozesse bzw. Prozeduren, z. B. der Güterverteilung, geht. Daneben verwenden wir den Gerechtigkeitsbegriff in ganz unterschiedlichen Situationen und bei verschiedenen Anlässen. Zum Beispiel sprechen wir von sozialer Gerechtigkeit, wenn wir die gesellschaftliche Verteilung materieller wie immaterieller Ressourcen meinen, von Lohngerechtigkeit, wenn wir für die gleiche Arbeit die gleiche Bezahlung fordern, und von Generationengerechtigkeit, wenn wir beispielsweise fordern, dass unsere Kinder nicht für die Schulden, die wir anhäufen, zahlen sollen. Auch die Forderung nach Chancengleichheit oder Gleichberechtigung beziehen sich auf das Gerechtigkeitskonzept.
Was aber ist eigentlich gerecht, an welchen Kriterien machen wir fest, ob etwas sozial gerecht oder leistungsgerecht ist? Zur Beantwortung dieser Fragen lassen sich zahlreiche Kriterien und Prinzipien anführen: Nach dem Bedürfnisprinzip ist beispielsweise der Lohn in einer Gesellschaft dann gerecht, wenn er den jeweiligen Bedürfnissen der Gesellschaftsmitglieder entspricht. Problematisch dabei ist, dieses Bedürfnis genau zu definieren. An dem Leistungsprinzip orientiert man sich dagegen dann, wenn die gleiche Leistung gleich honoriert/sanktioniert wird. Hier besteht das Problem, die Äquivalenz von Leistungen zu bestimmen. Das Gleichheitsprinzip wiederum orientiert sich an der Maxime, dass alle gleichbehandelt werden. Die Schwierigkeit hier ist die Feststellung, dass Menschen eben nicht gleich sind. Ist eine Gleichbehandlung dann überhaupt sinnvoll? Auch das Zufallsprinzip kann angewendet werden, um für Chancengleichheit bei der Güterverteilung zu sorgen. Das ist ein gerechtes Verfahren, berücksichtigt aber z. B. nicht den faktischen unterschiedlichen Bedarf, was dann wieder ungerecht sein kann. Und das Vertragsprinzip schafft Gerechtigkeit durch Vereinbarung. Das Problem dabei ist, ob diese Vereinbarung auch tatsächlich freiwillig zustande gekommen ist.
Vertiefung 6
Diskriminierung
Unter Diskriminierung versteht man allgemein Benachteiligung bzw. Bevorzugung aufgrund von Gruppenzugehörigkeit. Diskriminierung ist demnach ungerecht, da sich in der Regel allein aufgrund einer Gruppenmitgliedschaft keine Ungleichbehandlung ableiten lässt. Eine Ungleichbehandlung verstößt auch gegen das Grundgesetz, in dem es in Artikel 3 heißt: »(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. (2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. (3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.«
Faktisch findet jedoch Diskriminierung alltäglich in unterschiedlichen Kontexten statt. Zahlen dazu liefert eine Studie zur Diskriminierung in Europa. In der Umfrage geben 61 % der Befragten an, dass Diskriminierung von Roma, 59 % aufgrund ethnischer Zugehörigkeit und 53 % wegen ihrer sexuellen Orientierung in ihrem Land weit verbreitet ist (European Commission 2019, S. 493-495).
Doch aufgepasst, Diskriminierung ist nicht per se und immer verwerflich. Wenn ich beispielsweise für einen Übersetzungsjob bilingual aufgewachsene Bewerber bevorzuge, dann stellt das ebenfalls eine »Bevorzugung aufgrund von Gruppenzugehörigkeit« dar, erfüllt also den Tatbestand der Diskriminierung. In diesem Fall geht die Gruppenzugehörigkeit allerdings mit dem relevanten Jobmerkmal einher, nämlich zwei Sprachen perfekt zu beherrschen. Diskriminierung ist dann unmoralisch, wenn sie sich auf Pauschalisierungen und Vorurteile gründet und den Einzelfall nicht angemessen berücksichtigt. Auch die Bezugnahme auf empirisch ermittelte mittlere Gruppenunterschiede (z. B. Männer sind im Durchschnitt stärker als Frauen) ist kein Grund für einseitige und ungeprüfte Bevorzugung, denn Mittelwerte sagen bekanntlich nichts über den konkreten Einzelfall aus (vgl. Baggini, J. 2014).
Besonders einflussreich ist die von John Rawls, amerikanischer Philosoph (1921-2002), im Jahr 1971 entwickelte Vorstellung von Gerechtigkeit als eine Art Gesellschaftsvertrag (vgl. auch Höffe, O. 2006). Rawls sieht eine Gesellschaft als einen Zusammenschluss von Personen, die sich bestimmte Verhaltensregeln geben und sich größtenteils auch daran halten. Obwohl die Gesellschaft ein kooperatives Unternehmen ist, gibt es sowohl Interessenübereinkünfte wie auch Interessenkonflikte. Ersteres ergibt sich aus dem Vorteil, die alle von der Kooperation haben, Letzteres daraus, dass es nicht gleichgültig ist, wie der größere Nutzen, der durch die Kooperation entsteht, verteilt werden soll. Daher bedarf es Grundsätze, die diese Verteilung regeln, in dem Fall die soziale Gerechtigkeit, die die Rechte und Pflichten und die angemessene Verteilung der Vorteile und Lasten der sozialen Zusammenarbeit regelt.
Eine Gesellschaft ist dann gut aufgestellt, wenn jeder die gleichen Gerechtigkeitsprinzipien akzeptiert und auch weiß, dass die anderen sie akzeptieren und außerdem die grundlegenden sozialen Institutionen diesen Grundsätzen entsprechen und das auch jedem bekannt ist. Willkür kann nicht (sozial) gerecht sein, daher gilt auch der Anspruch, dass keine Person Institutionen, Regeln oder anderen Umständen auf willkürliche Art und Weise unterworfen sein darf (Rawls, J. 1971, S. 4 f.). Vor diesem Hintergrund leitet Rawls eine Konzeption von Gerechtigkeit ab, die die Idee des Gesellschaftsvertrags aufgreift. Diese Idee ist bereits bei John Locke, englischer Philosoph (1632-1704), Jean-Jacques Rousseau, französisch-schweizerischer Philosoph und Komponist (1712-1778), und Kant zu finden. Freie und vernünftige Personen, die ihre eigenen Interessen fördern wollen, einigen sich auf die Grundsätze der Gerechtigkeit und zwar aus einer anfänglichen Position der Gleichheit. Faktische soziale und ökonomische Unterschiede, z. B. aufgrund von Intelligenz, für die der Intelligente ebenso viel kann wie der weniger Intelligente, sind dann zu rechtfertigen, wenn sie den am schlechtesten Gestellten die besten Aussichten bieten (Differenzprinzip; Rawls, J. 1971, S. 75 ff.).
Wie das bewerkstelligt werden kann, erläutert Rawls an einem Gedankenexperiment. Gehen wir davon aus, dass sich die Vertragspartner zu Beginn der Verhandlungen zum Gesellschaftsvertrag in einem hypothetischen »Urzustand« befinden, der durch einen »Schleier des Nichtwissens« (Rawls, J. 1971, S. 136 ff.) gekennzeichnet ist. In dieser Situation wird nun über die Gerechtigkeitsprinzipien entschieden, die dann zukünftigen Gesellschaftsordnungen zugrunde liegen sollen. Die Vertragspartner wissen...
| Erscheint lt. Verlag | 10.7.2024 |
|---|---|
| Verlagsort | Freiburg |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Unternehmensführung / Management |
| Schlagworte | Agiles Arbeiten • Autonomes Fahren • Corona-Pandemie • Datenschutz • Digitalisierung • Ethik • geschlechterungerechtigkeit • Globaler Süden • Homeoffice • Klimawandel • Künstliche Intelligenz • Me-Too • Nachhaltigkeit • Peter Michael Bak • Unternehmensethik • Unternehmensverantwortung • Wertemanagement • Wirtschaftsethik |
| ISBN-10 | 3-7910-6321-9 / 3791063219 |
| ISBN-13 | 978-3-7910-6321-8 / 9783791063218 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 1,2 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich