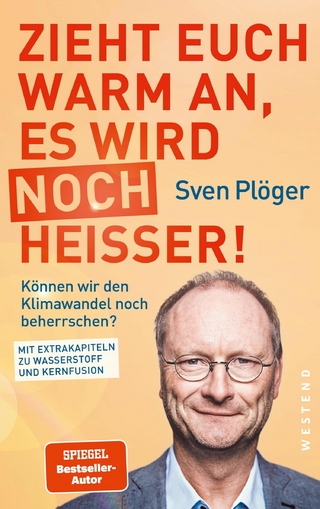Der Ruf der Kraniche (eBook)
416 Seiten
Goldmann Verlag
978-3-641-24914-4 (ISBN)
Bernhard Weßling, Jahrgang 1951, ist promovierter Chemiker und erfolgreicher Unternehmer. Schon als Jugendlicher fühlte er sich von der Natur angezogen. Vor über 30 Jahren begann er im Duvenstedter und Hansdorfer Brook am Nordrand von Hamburg mit der Beobachtung von Kranichen und organisierte dort mehrere Jahre den Kranichschutz. Durch seine Forschungen gilt er längst als international gefragter Kranichexperte und war am bisher größten und komplexesten Auswilderungsprojekt der extrem bedrohten Schreikraniche in Nordamerika beteiligt.
Vorwort
Es war ein langer Weg aus dem engen und verschmutzten Ruhrgebiet, in dem ich aufwuchs und studierte, bis in den Duvenstedter Brook bei Hamburg, wo ich erstmals Kraniche sah. Noch länger und beschwerlicher war meine Expedition in die verborgene, rätselhafte Welt der Kraniche, ihr Leben und Denken.
Schon sehr früh kam ich mit den Themen Umweltverschmutzung und Bedrohung der Natur in Berührung. Als Kind erlebte ich oft, wie die saubere Wäsche der achtköpfigen Familie draußen im Garten hing und sich plötzlich eine Rußwolke aus den Schloten der nahe gelegenen Kokerei in Herne erhob und hässliche schwarze Flecken auf der Wäsche hinterließ. Als Jugendlicher liebte ich die späten Herbstabende, in denen der dichte Nebel die damals noch wenigen Autos zum Schritttempo zwang, während ich mit meinem Rad und zusätzlich angebrachten starken Lampen kräftige Lichtkegel in den Nebel zauberte, der in Wirklichkeit Smog war.
Als Chemiestudent im dritten Semester meldete ich mich 1971 auf einen Aushang, in dem Chemiker zur Analyse von illegal abgelagerten Fässern1 gesucht wurden. Diese enthielten zum großen Teil Cyanidverbindungen, zum kleineren Teil andere Stoffe, in einigen befand sich Schwefelsäure. Die Fässer waren in ein eigens ausgehobenes Loch gekippt worden, das sich nach und nach mit Wasser gefüllt hatte. Die Schwefelsäurefässer verrotteten zuerst, sodass dieser Tümpel inzwischen stark sauer war, was im Kontakt mit Cyanidsalzen zur Freisetzung von Blausäuregas führte. Um den Tümpel herum lagen und auf dem Wasser schwammen tote Tiere. Es war ein »Doomsday«-Szenario. Als Student ohne finanzielle Mittel benötigte ich dringend Geld für meinen Lebensunterhalt. Der schwere und gefährliche Job wurde gut bezahlt. So fand ich mich in den Semesterferien bei brütender Hitze in Vollatemschutzkleidung wieder. Ich analysierte wochenlang täglich, oftmals in hochgiftige Staubwolken eingehüllt, sechs bis acht Stunden lang verrottende Fässer darauf hin, ob sie Cyanide (»nach links auf den großen Fassberg«) oder andere, weniger giftige Abfallsalze enthielten (»nach rechts zu dem anderen Giftmüll«).
Es war drückend heiß. Aus allen Richtungen zogen bedrohliche Staubwolken über uns hinweg. Die notwendige Vollschutzkleidung und Gasmasken waren eigentlich unerträglich. Das verführte einige Arbeiter dazu, ohne Atemschutz zu arbeiten. Einer davon saß vor mir oben auf seinem Bagger. Ich sollte die Fässer, die er ausgrub, untersuchen. Seine Schaufel erfasste ein Fass mit Pulver, das verrottete Fass zerbrach, eine Staubwolke umhüllte mich und den Bagger, der Baggerfahrer brach vor meinen Augen oben auf dem Fahrersitz sofort tot zusammen. Ich alarmierte den Notarzt, der Arbeiter wurde schnellstens in die auf dem Gelände installierte mobile Notfallklinik gebracht, bekam innerhalb von Sekunden ein Gegenmittel gespritzt, wurde dadurch wiederbelebt und zusätzlich beatmet. Am nächsten Tag saß er wieder auf dem Bagger, nun aber mit Gasmaske und Vollschutzkleidung. Keiner der Arbeiter verweigerte von nun an die notwendigen Schutzmaßnahmen. Der wochenlange Studentenjob hat meine Haltung zum Umwelt- und später Naturschutz geprägt. Ein Jahr später, 1972, erschien der erste Bericht des Club of Rome Die Grenzen des Wachstums, der unter uns Chemiestudenten heiß diskutiert wurde. Für mich wurde immer klarer: Wir müssen diesen Planeten und seine Ökosysteme mit viel mehr Respekt behandeln. Als Chemiker wollte ich durch Forschung meinen Beitrag dazu leisten.
Schon als etwa 14-jähriger Junge hatte ich mich intensiv mit Naturwissenschaften befasst, unter anderem mit Astronomie. Wenn ich durch mein mühsam erspartes Teleskop in den Weltraum schaute, empfand ich neben unstillbarer Neugierde und grenzenloser Ehrfurcht auch eine tiefsitzende Furcht vor der Unendlichkeit des Universums. Mich befiel daraufhin eine schwere Depression: Wir sind mit unserer Erde allein im lebensfeindlichen Weltraum, so empfand ich es, und ich selbst fühlte mich einsam, hatte in der Familie wenig Rückhalt und war ein Einzelgänger.
Als ich wieder einmal ziellos durch einen kleinen Wald in Herne stromerte, fand ich eine winzige, bläulich schimmernde Feder. Ich fand heraus, dass es eine Eichelhäherfeder war, und legte sie in ein kleines Kästchen. Bei weiteren Ausflügen sammelte ich immer mehr Federn, unter anderem sogar eine Adlerfeder. Ich befestigte sie auf einer weißen Pappe, die ich in meinem Zimmer an die Wand hängte; ich therapierte mich durch die Beschäftigung mit Vogelfedern und bei Aufenthalten in der Natur selbst und fand aus meinen Ängsten und meiner tiefen Niedergeschlagenheit heraus. Wald und Feld waren für mich Rückzugsorte geworden, in denen ich mich entspannen, über mich selbst und die Welt nachdenken konnte. Die Natur – als von Menschen geformte Landschaft gleichermaßen wie wilde, raue, schwer zugängliche und einsame Gegenden – ist seitdem regelmäßig Quelle der Entspannung und der Linderung von beruflichem und privatem Stress gewesen. (Um diesen Effekt festzustellen, scheint man heute aufwändige Forschung zu benötigen, aber immerhin bestätigen die neuesten Studien aus den USA und Japan meine Erfahrungen aus den letzten über fünf Jahrzehnten.)
Als junger Familienvater brachte ich meine Kinder von Anfang an mit der Natur in Kontakt. Insbesondere beobachteten wir Vögel und entdeckten dabei die Kraniche für uns. Zusammen mit meinen heranwachsenden Söhnen erkannte ich ihre Verletzlichkeit, und mir wurde bewusst, wie schwierig es ist, ihren Lebensraum zu schützen beziehungsweise wiederherzustellen, und dass Natur- und Artenschutz immer Hand in Hand mit Umweltschutz gehen muss. Ich beschloss, am Kranichschutzprogramm teilzunehmen, das ich später etwa fünf Jahre lang leiten sollte.
Bei meiner intensiven Beobachtung der Kraniche stellte ich fest, dass über das Leben und Verhalten dieser eindrucksvollen Vögel erschütternd wenig bekannt war. Mit ihrem rätselhaften Wesen weckten sie meine naturwissenschaftlich geschulte Neugierde und regten mich zum Forschen außerhalb meines angestammten Berufs an.
Es wird kaum einen anderen Ort auf der Welt geben, an dem freie und wilde Kraniche in so enger Nachbarschaft mit Menschen leben und brüten, wie den Duvenstedter und den Hansdorfer Brook. Beide befinden sich am Nordrand der Millionenstadt Hamburg, von deren Einwohnern jährlich Zehntausende das Naturschutzgebiet besuchen, wandern, sich erholen und die Natur beobachten. (Leider störte eine nicht zu vernachlässigende Minderheit der Besucher durch Picknicks, Ostereiersuchen und Fotografieren abseits der Wege, einige Male sogar mit Wilderei und Eierdiebstahl, das Naturschutzgebiet empfindlich. Das hat sich inzwischen aufgrund unserer beharrlichen Arbeit stark verbessert.)
Vielleicht waren Kranichbeobachter nirgendwo sonst so intensiv mit »ihren« Kranichen verbunden wie wir. Die Aufgabe der »Kranichbewacher«, wie wir uns selbst nannten und von den Besuchern genannt wurden, war es, Störungen zu verhindern. So »bewachten« wir eigentlich nicht die Kraniche, sondern die Besucher, zumindest diejenigen, die bewusst oder unbewusst zu Störern wurden.
Während der Brutzeit waren zumeist zwei Kranichbewacher jeweils für eine Woche täglich ganztägig im Brook. Viele von uns übernachteten dort sogar. Wir standen in aller Herrgottsfrühe auf und gingen erst nach dem »Waldschnepfenstrich« schlafen (so nennt man das Verhalten der Waldschnepfen, die in der Dämmerung am Waldrand oder über die Wiesen in ihrem Revier hinweg »streichen«).
Von Mitte Februar bis Mitte November sind die Kraniche »bei uns«. Bis Ende der 1990er Jahre waren es vier bis sechs Kranich-Brutpaare und jedes Jahr einige »Junggesellen«, die sich in unserem Gebiet herumtrieben. Anfang der 2000er-Jahre und um 2016 herum besetzten etwa ein Dutzend Kranichpaare je ein Revier. Im Jahre 2019 hielten sich neben einem Dutzend Revierpaaren und weiteren Reviere suchenden Paaren zeitweilig über 20 Jungkraniche, zum Teil als eine große Gruppe, im Brook auf. An einem Tag im Mai sah ich auf einer Wiese im Kern des Brooks 65 Kraniche. Die Reviere im engeren Sinn sind übrigens nicht größer als ca. einen halben Quadratkilometer und an manchen Stellen gut einzusehen (zum Vorteil der Kraniche aber größtenteils sehr unübersichtlich). Die Revierpaare verteidigen allerdings gegen andere Kraniche ein weit größeres Gebiet, die Reviere umfassen also eine Kernzone mit Brutplatz und Nahrungsaufnahmegebiet sowie eine Pufferzone.
So waren mir über Jahre hinweg – vielleicht einzigartig auf der Welt – nur wenige Minuten von meiner Wohnung und meinem Arbeitsplatz entfernt sehr viele Kranich-Beobachtungen unter Freilandbedingungen möglich. Im Sinne unserer Schutzaufgabe beobachteten wir die Tiere von weitem, von außerhalb der Fluchtdistanz, sodass die Beobachtung selbst nicht störend wirkte.
Ich führte keine Verhaltens-Experimente mit Kranichen durch, sondern beobachtete sie nur. Das bedeutet jedoch nicht, dass ich »von Menschen unbeeinflusste Kraniche« beobachten und beschreiben kann. Die Menschen schränken durch Wanderwege, Straßen oder landwirtschaftliche Nutzflächen die Brut- und Nahrungsräume und die Beweglichkeit der Tiere ein. Diese haben ihr Verhalten angepasst, und so beobachtet man immer auch die Reaktionen der Vögel auf menschliche Einflüsse. Das Verhalten der Tiere in einer Kulturlandschaft wie dem Brook ist sicher nicht dasselbe wie in der Wildnis, in der weitgehend ungestörten sibirischen Tundra, der mittelschwedischen Wald- oder der finnischen Seenlandschaft, wenngleich inzwischen in unserem Naturschutzgebiet einige kleinere Stellen wieder ihrer natürlichen Entwicklung überlassen bleiben....
| Erscheint lt. Verlag | 23.3.2020 |
|---|---|
| Zusatzinfo | farb. Bildteil 16 S. |
| Verlagsort | München |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Natur / Technik ► Natur / Ökologie |
| Technik | |
| Schlagworte | Ablenkung • Alexander von Humboldt • andrea wulf • Artenschutz • Biologie • Das geheime Leben der Bäume • Die Genies der Lüfte • eBooks • Elli Radinger • Flucht • Genies der Lüfte • Geschenk Vatertag • H wie Habicht • Klimaschutz • Kommunikation • Kosmos • Lagerkoller • LIEBE ZUR NATUR • Nachhaltigkeit • Nature writing • Naturfoschung • Naturwissenschaft • Ökologie • Ökosystem • Ornithologie • Peter Wohlleben • SPIEGEL-Bestseller • Sprache der Vögel • Tiere • Vater Papi Papa • Vögel • Vogelbestimmungsbuch • Vögel des Glücks • Wolf • Wölfe • Zugvögel |
| ISBN-10 | 3-641-24914-7 / 3641249147 |
| ISBN-13 | 978-3-641-24914-4 / 9783641249144 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 13,4 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich