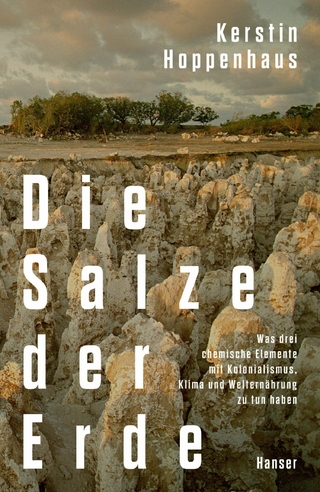Das geheime Band zwischen Mensch und Natur (eBook)

199 Seiten
Ludwig Buchverlag
978-3-641-20706-9 (ISBN)
Peter Wohlleben, Jahrgang 1964, wollte schon als kleines Kind Naturschützer werden. Er studierte Forstwirtschaft und war über zwanzig Jahre lang Beamter der Landesforstverwaltung. Heute arbeitet er in der von ihm gegründeten Waldakademie in der Eifel und setzt sich weltweit für die Rückkehr der Urwälder ein. Er ist Gast in zahlreichen TV-Sendungen, hält Vorträge und Seminare und ist Autor von Büchern zu Themen rund um den Wald und den Naturschutz, die sich allein im deutschsprachigen Raum 2,5 Millionen Mal verkauft haben. Für seine emotionale und unkonventionelle Wissensvermittlung wurde Peter Wohlleben 2019 die Bayerische Naturschutzmedaille verliehen. Seine Bücher sind in über 46 Ländern erschienen.
Warum ist der Wald eigentlich grün?
Es gibt mehr und mehr naturbegeisterte Menschen, die den Wald nicht nur sehen, sondern auch intensiv spüren möchten, mich selbst eingeschlossen. Oft beneiden wir dabei die Tiere um ihre unverfälschten Sinne. Doch wie sieht es eigentlich mit unseren eigenen Sinnen aus? Wozu sind wir nach Jahrhunderten einer Zivilisation, die uns im Alltag der Notwendigkeit einer wachen Aufmerksamkeit der Natur gegenüber beraubt, überhaupt noch fähig?
Wenn man den vielen vergleichenden Berichten über die fantastischen Fähigkeiten von Tieren Glauben schenken darf, dann sind wir eine Art, die außer ihrem scharfen Verstand nicht mehr viel zu bieten hat. Gegen fast jede andere Spezies scheinen wir in Bezug auf die Sinne schlecht abzuschneiden, und fast hat man den Eindruck, wir gefallen uns sogar noch in der Rolle der evolutionären Verlierer. Das Band der Natur zu uns Menschen scheint unwiderruflich gerissen, und wir können nur noch neidisch auf die Fähigkeiten der Tiere schielen.
Dieser Eindruck ist allerdings absolut falsch: Der Mensch ist durchaus in der Lage, mit seiner belebten Umwelt mitzuhalten. Schließlich mussten sich unsere Vorfahren vor gar nicht allzu langer Zeit noch durch die Wälder schlagen und dabei jede mögliche Gefahr oder Beute frühzeitig registrieren. Und weil sich seither unser Bauplan nicht geändert hat, können wir getrost davon ausgehen, dass alle Sinne noch intakt sind. Das Einzige, was vielleicht fehlt, ist etwas Training, und das kann man nachholen.
Widmen wir uns zuerst unseren Augen und hier zunächst der Frage, wodurch wir überhaupt in der Lage sind, Bäume farbig zu sehen.
Der Anblick grüner Bäume ist entspannend und sogar gesundheitsfördernd, so viel ist gewiss, doch warum sehen wir sie überhaupt grün? Schließlich haben die meisten anderen Säugetierarten diese Fähigkeit nicht. Ihre Welt ist farblich recht beschränkt, wie etwa die der hochintelligenten Delfine: Sie sehen nur schwarz-weiß, da sie in ihren Augen (wie alle Wale, aber auch Robben) nur einen Zapfentyp in der Netzhaut haben. Zapfen sind Zellen, die das Farbsehen ermöglichen. Um jedoch zwischen zwei Farben unterscheiden zu können, braucht es mindestens zwei verschiedene Zapfenarten. Delfine und Co. besitzen paradoxerweise lediglich einen Zapfen für Grün. Das reicht gerade mal zur Unterscheidung verschiedener Helligkeitsstufen, und Delfine sind damit noch nicht einmal in der Lage, blaues Licht zu verarbeiten, das im Meerwasser nicht nur reichlich vorhanden ist, sondern auch besonders tief ins Wasser eindringt.
Unsere vierbeinigen Mitgeschöpfe wie Hunde und Katzen oder Waldtiere wie Rehe, Hirsche oder Wildschweine können schon deutlich mehr als ein Delfin. Bei ihnen gesellen sich zu den grünen auch noch blaue Zapfen, was immerhin schon ein schwaches Farbenspektrum ermöglicht. Allerdings verschmelzen Rot, Gelb und Grün in all ihren Abstufungen zu einer einzigen Farbe. Um Grün sehen zu können, reicht das allerdings immer noch nicht. Dazu bräuchten sie noch rotempfindliche Zapfen – so wie wir und viele Affenarten sie haben. Die Erkenntnis, dass die Farbe Grün beruhigend für die Psyche und unterstützend bei Heilungsprozessen ist, kann bei den meisten Säugetieren also keine Rolle spielen.
Doch warum braucht man grün- und rotempfindliche Zapfen, um Grün zu sehen? Es liegt an der Wellenlänge des Lichts. Blaue Farbtöne sind kurzwellig, grüne und rote langwellig. »Langwellige« Farbtöne stimulieren also nur die Grünzapfen – egal ob grünes, gelbes oder rotes Licht auf sie trifft. Die Blauzapfen werden gar nicht angeregt. Ein Tier, das nur Zapfen für Blau oder Grün besitzt, kann also streng genommen nur zwischen »Blau« und »nicht Blau« unterscheiden. Erst wenn ein weiterer Zapfentyp hinzukommt, der in einem anderen Bereich des langwelligen Lichts empfindlich ist, kann ein Wald grün werden. Und – o Wunder – wir Menschen besitzen in unserer Netzhaut einen solchen Zapfentyp.1 Er ist empfindlich für rotes Licht, und erst so können wir klar sagen, ob das Laub der Bäume grün, gelb oder rot ist. Nicht umsonst sind die kleinen LED-Punkte in Ihrem Computer- oder TV-Bildschirm aus winzigen Blau-grün-rot-Zellen zusammengesetzt. Damit lassen sich alle Farben darstellen.
Wälder grün sehen zu können ist also eine echte Besonderheit im Reich der Säugetiere. Doch warum haben ausgerechnet wir Menschen diese Fähigkeit entwickelt? Forscher vermuten, dass es weniger mit der Farbe Grün als vielmehr mit Rot zu tun hat. Rot sind zum Beispiel viele reife Früchte, die sich zwischen den Blättern von Bäumen und Sträuchern befinden. Auf die haben es allerdings nicht nur wir abgesehen, sondern auch viele Vogelarten, die Rot noch viel besser sehen können als wir. Auf diesen Umstand haben die Pflanzen reagiert: So gehen Früchte, die von Säugetieren gefressen werden, mehr ins grünliche Rot, während die Früchte, die für Vögel als Nahrung dienen, intensiv rot gefärbt sind.2
Dass wir Rot sehen können, klingt also plausibel. Aber warum finden wir gerade Grün so schön, warum bemerken wir es überhaupt? Verwirrt Sie diese Frage? Denn immerhin besitzen wir in unseren Augen ja Zapfen für Grün; es erscheint also logisch, dass wir es im Wald permanent und bewusst registrieren. Doch das muss nicht so sein, wie das Beispiel der Farbe Blau zeigt: Unsere Vorfahren haben sie möglicherweise überhaupt nicht bemerkt oder sie für unwichtig erachtet. Lazarus Geiger, ein deutscher Sprachforscher des 19. Jahrhunderts, fand heraus, dass es in vielen alten Sprachen gar kein Wort für Blau gab. Selbst in den Texten Homers, eines geheimnisumwitterten griechischen Dichters, der vermutlich im 8. Jahrhundert vor Christi gelebt hat, war die Farbe des Meers weindunkel; andere Texte späterer Jahrhunderte definierten Blau als Schattierung von Grün. Erst die Entwicklung und der Handel mit blauen Farbstoffen läuteten die Geburt des Begriffs »Blau« ein, seitdem unterscheiden wir es als eigenständige Farbe und nehmen es bewusst wahr.
Sehen wir also manche Farben nur, weil es dafür einen kulturellen Grund gibt? Oder anders ausgedrückt: Können wir Blau nur deshalb sehen, weil es ein Wort dafür gibt? Jules Davidoff, Professor der Psychologie an der Goldsmiths University of London, veröffentlichte dazu ein beeindruckendes Experiment. Er reiste mit seinem Team zu den Himba, einem Stamm in Namibia, der kein Wort für Blau kennt. Dort zeigte er den Probanden auf einem Monitor einen Kreis mit 12 Quadraten. Elf waren grün, eines sehr deutlich blau. Die Himba hatten große Schwierigkeiten, das blaue Quadrat ausfindig zu machen. Nun kam die Gegenprobe. Davidoff zeigte Menschen mit Englisch als Muttersprache ebenfalls einen Kreis mit zwölf Quadraten, diesmal alle in Grün. Nur ein einziges hatte einen winzigen Gelbstich, der auch mir nicht aufgefallen ist. Den Test können Sie übrigens selbst im Internet machen, die Seite ist über die Quellenangabe auffindbar.3 Die englischsprachigen Teilnehmer hatten erhebliche Probleme, das fragliche Quadrat ausfindig zu machen. Nicht so die Himba. Ihnen fehlt zwar das Wort für Blau, dafür haben sie jedoch wesentlich mehr Wörter für Grün als wir. Dadurch sind sie in der Lage, selbst kleinste Farbunterschiede zu beschreiben, und offenbar erleichterte ihnen diese Fähigkeit auch beim Experiment die sofortige Identifizierung des leicht abweichenden Quadrats.4
Auch aus dem europäischen Sprachraum gibt es Hinweise, dass das Farbsehen eng mit der Kultur verknüpft ist. So können etwa Menschen mit Russisch als Muttersprache viel schneller verschiedene Blautöne wahrnehmen, weil im Russischen eine schärfere Trennung zwischen Hellblau und Dunkelblau gemacht wird als in anderen Sprachen. Ein Forscherteam um den New Yorker Psychologen Jonathan Winawer fand heraus, dass Mitarbeiter mit dieser Muttersprache Blautöne besser unterscheiden konnten als ihre englischsprachigen Kollegen.
Leider kenne ich nur Untersuchungen zur Farbe Blau. Doch gerade für mich als Förster ist es natürlich interessant herauszufinden, wie es sich mit der Farbe Grün verhält. Wenn ich aus dem Fenster meines Büros in den Garten des Forsthauses schaue, dann sehe ich unzählige Varianten von Grün. Das bläulich-graue Grün der Flechten an der alten Birke, das gelbliche Grün des winterlichen Grases, das kräftige Blaugrün der Nadeln an den Zweigen der großen Douglasien, das warme gelbgraue Grün der Algenbeläge auf der Rinde junger Buchenstämme – all das subsumiere ich unter Grün.
Gewiss fallen mir Unterschiede zwischen den verschiedenen Pflanzen und Materialien auf, gibt es Farbtöne mit Namen wie Tannengrün, Lindgrün oder Maigrün. Doch im Alltag werden diese Begriffe kaum gebraucht, sondern eher vage Umschreibungen wie Hell- oder Dunkelgrün genutzt.
Andererseits spricht sehr viel dafür, dass unsere Vorfahren schon sehr lange bewusst sämtliche Farbnuancen von Grün und Rot wahrnehmen konnten. Denn wenn, wie bereits geschildert, Rot für unsere Ernährung wegen des Erkennens reifer Früchte wichtig war, dann sicher auch alle Varianten von Grün bis hin zu Gelb. Wie sonst etwa sollten unsere Ahnen reifes, gelbes Korn bemerken, wie das Verdorren mühsam angelegter Gemüsefelder, deren einst saftiges Grün im Verwelken verblasst, oder auch Früchte, deren Reifegrad ebenfalls der Farbwechsel von Grün (unreif) zu Gelb oder Rot anzeigt? Sogar der noch weiter in die Vergangenheit gerichtete Blick zeigt die Notwendigkeit einer Unterscheidung. Wurde etwa ein...
| Erscheint lt. Verlag | 12.8.2019 |
|---|---|
| Verlagsort | München |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Natur / Technik ► Natur / Ökologie |
| Technik | |
| Schlagworte | Bäume • eBooks • Einklang mit der Natur • Gesundheit aus der Natur • Klima • Mensch als Teil der Natur • Natur • Naturverbundenheit • Verbundenheit Mensch und Natur • Wald • Wetter |
| ISBN-10 | 3-641-20706-1 / 3641207061 |
| ISBN-13 | 978-3-641-20706-9 / 9783641207069 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 1,9 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich