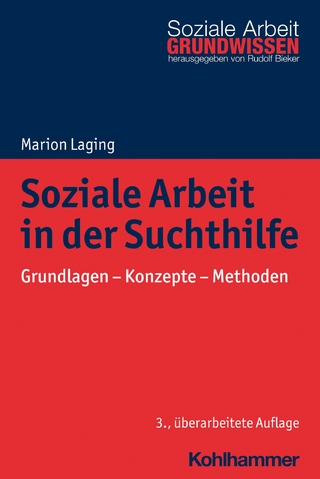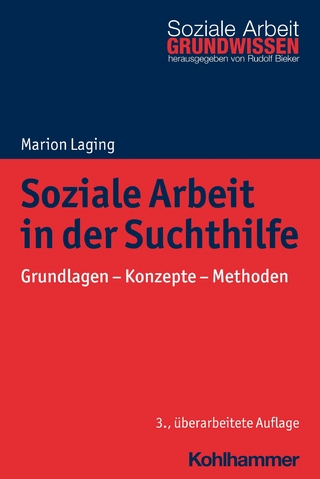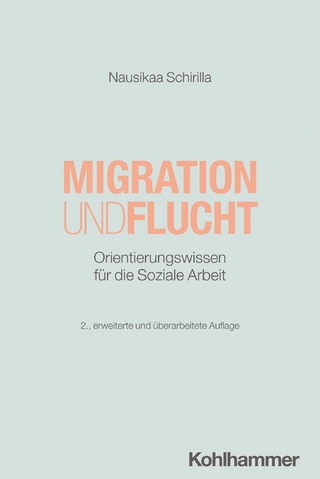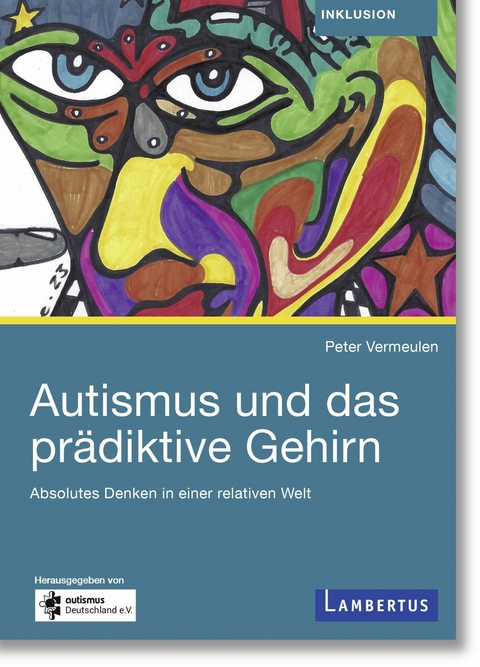
Autismus und das prädiktive Gehirn (eBook)
226 Seiten
Lambertus Verlag
978-3-7841-3764-3 (ISBN)
Peter Vermeulen, PhD, ist ein international renommierter Dozent/Ausbilder im Bereich Autismus und hat mehrere Bücher geschrieben. Im Jahr 2019 erhielt Peter Vermeulen in Belgien den Passwerk Lifetime Achievement Award für seine mehr als 30-jährige Arbeit im Bereich Autismus.
Peter Vermeulen, PhD, ist ein international renommierter Dozent/Ausbilder im Bereich Autismus und hat mehrere Bücher geschrieben. Im Jahr 2019 erhielt Peter Vermeulen in Belgien den Passwerk Lifetime Achievement Award für seine mehr als 30-jährige Arbeit im Bereich Autismus.
Vorwort zur deutschen Ausgabe
Peter Vermeulen ist ein belgischer Pädagoge und Psychologe, der sich seit mehr als 30 Jahren mit Autismus befasst. Zum einen ist er in Gent (Belgien) als Lehrender, Trainer sowie Therapeut an einem von ihm mitgegründeten Autismus-Zentrum (Autisme Centraal) leitend tätig, an dem er bis heute wertvolle Erfahrungen in der Arbeit mit Menschen aus dem Autismus-Spektrum und Familien mit autistischen Kindern gewonnen hat. Zum anderen ist er ein vor allem im europäischen Raum bekannter und anerkannter Autismus-Experte und Autor zahlreicher Schriften, die sich insbesondere durch ein wissenschaftlich gestütztes, innovatives Nachdenken über die Sicht auf Autismus auszeichnen. Dazu zählt das viel beachtete Buch „Autismus als Kontextblindheit“ (2016). Wenngleich dieser Buchtitel zu einer einseitigen (negativen) und engen Sicht auf Autismus verleiten kann und daher kritisch gesehen werden sollte, werden wichtige Beobachtungen, Befunde und Erfahrungen zusammengetragen, die dazu sensibilisieren, Menschen aus dem Autismus-Spektrum angesichts ihrer Schwierigkeiten, Situationen oder Informationen kontextbezogen zu erfassen und zu nutzen, besser zu verstehen und ihnen mehr Lebensqualität durch geeignete Unterstützungsformen für ein inklusives ‚Leben mit Autismus‘ zu ermöglichen.
Ebenso innovativ und richtungsweisend kann die vorliegende Schrift betrachtet werden, die eine wichtige Ergänzung, ja Weiterentwicklung von „Autismus als Kontextblindheit“ darstellt.
Mit dem Begriff des „prädiktiven Gehirns“ wird eine bedeutsame Erkenntnis der kognitiven Neurowissenschaften aufgegriffen, die davon ausgeht, dass die Informationsverarbeitung des Gehirns nicht linear verläuft (z. B. nach dem Prinzip: Input – Verarbeitung – Output oder als Kette aus Stimuli und Reaktionen). Vielmehr trifft das Gehirn stets Vorhersagen darüber, was es in einer bestimmten Situation wahrnehmen und erwarten wird. Das bedeutet, dass es als eine vorausschauende Instanz operiert, indem es die Realität (z. B. tatsächliche Ereignisse oder Erlebnisse) mit seiner Vorhersage abgleicht und bei Abweichungen von Reizen (z. B. Überraschungen, unvorhergesehenen Situationen) eine Überarbeitung (Fehlerkorrektur durch Kontextsensitivität) seiner bisherigen Antizipation oder Erwartung vornimmt. Würde das Gehirn jedem Vorhersagefehler Aufmerksamkeit widmen, käme es „schnell zu einer mentalen Überbelastung“, weshalb es immer zwischen ‚relevanten‘ und ‚irrelevanten‘ Abweichungen (Stimuli) unterscheiden und entscheiden muss. Ein solcher vorausschauender Prozess (auch als predictive coding bezeichnet) profitiert von individuellen Erfahrungen und vollzieht sich als ein extrem schnelles, sofortiges und unbewusstes Reagieren auf eine neue Situation oder Information, einen neuen Stimulus oder Gedanken. Manche sprechen in dem Zusammenhang von einer Überlebensstrategie. Demgegenüber gibt es freilich auch Situationen, in denen keine rasche Reaktion oder Antwort notwendig ist, was dann zu bewussten (überlegten) Entscheidungen führt, bei denen gleichfalls ein im Gedächtnis gespeichertes Erfahrungswissen eine wichtige Rolle spielt, das wie die Entscheidungen nicht von unbewussten (emotionalen) Einflüssen losgelöst betrachtet werden darf.
Vor dem Hintergrund dieser Erkenntnisse führt uns P. Vermeulen mit gut nachvollziehbaren und interessanten Beispielen, Konzepten und Forschungsergebnissen aus den kognitiven Neurowissenschaften vor Augen, dass die Gehirne nicht-autistischer Menschen und Autist*innen auf Vorhersagen oft unterschiedlich reagieren. Das ist mit Blick auf Autismus nicht per se pathologisch, sondern ein Hinweis auf Neurodiversität. Diese Einsicht hat P. Vermeulen dazu veranlasst, im vorliegenden Buch den Ausdruck „Kontextblindheit“ weithin zu vermeiden und einen neutraleren Begriff wie „absolutes Denken“ zu nutzen, der nicht unmittelbar auf eine Beeinträchtigung verweist.
Gleichwohl sind einige Schwierigkeiten zu beachten, die sich nicht selten bei autistischen Menschen beobachten lassen, so z. B. soziale Handlungen kontextbezogen vorherzusagen, das eigene Wissen intuitiv und flexibel kontextspezifisch einzusetzen, zwischen wichtigen und unwichtigen Kontextelementen zu unterscheiden oder schnelle kontextabhängige Vorhersagen zu machen, die benötigt werden, um „sich reibungslos und flexibel in der Welt zurechtzufinden“.
Solche Beobachtungen stehen mit der neurowissenschaftlichen Erkenntnis im Einklang, dass die Wahrnehmung autistischer Menschen von Natur aus auf die Erfassung lokaler Reize ausgerichtet ist, was einerseits als besondere Stärke betrachtet und beruflich genutzt werden kann. Andererseits kann eine solche autistische Fähigkeit nachteilige Effekte haben, wenn bereits winzige Details in einer Situation viel Aufmerksamkeit erfahren und nicht ignoriert werden können. Dem Anschein nach verlassen sich viele autistische Menschen weniger auf Verallgemeinerungen (z. B. Oberbegriffe, Eindrücke), sondern eher auf konkrete Informationen, die sie unmittelbar wahrnehmen (z. B. Dinge, die sie sehen). Hierzu ein Beispiel:
Vor etwa 10 Jahren lernte ich den Autisten Herrn K., einen ‚Detail-Denker‘ mit einem ‚fotografischen Gedächtnis‘ kennen, der im Rahmen seiner Arbeit zwei Mal Unterlagen in das Büro eines Vorgesetzten bringen sollte. Beim ersten Mal hatte dies gut geklappt, indem er im Büro die Unterlagen direkt dem Vorgesetzten überreichen konnte. Neun Tage später sollte er erneut Unterlagen zum Büro bringen und übergeben. Als Herr K. diesmal das Büro betrat, war er unmittelbar irritiert, indem er annahm, in einem falschen Raum zu sein. Da der Vorgesetzte nicht anwesend war und sich die Anordnung von zwei Pflanzen an einem Fenster verändert hatte, geriet er in Stress. Zunächst zitterte er am ganzen Körper, sodass ihm die Unterlagen aus den Händen entglitten, und dann steigerte er sich in einen panischen Erregungszustand (verzweifeltes Schreien, mit Füßen auf den Boden stampfen und Arme schütteln) mit dem Gefühl eines Kontrollverlusts. Nach gut drei Minuten hatte sich dieser ‚Overload‘-Effekt gelegt, als der Vorgesetzte erschien und ihn beruhigen konnte.
An diesem Beispiel merken wir, dass Probleme durch emotional bestimmte Reaktionen des Gehirns auf unvorhersehbare Veränderungen (Reize) entstehen können, auf die sich das Gehirn nicht eingestellt hat und dass Vorhersagefehlern zu viel Bedeutung verliehen wird, sodass das Wesentliche (Auftrag, Ziel) aus dem Blick gerät und die betroffene Person letztlich „nicht mehr richtig funktionieren“ kann (zit. n. T. Grandin „Ich sehe die Welt wie ein frohes Tier“, Berlin 2008, S. 79).
Daraus zieht P. Vermeulen den weisen Schluss für die Praxis, sich weniger auf Stimuli (Schaffung einer reizarmen Umgebung) als vielmehr auf den Umgang mit der Hyperreaktivität zu konzentrierten, die durch Reize im Gehirn erzeugt wird und sich vor allem im limbischen System (Amygdala) abspielt. Das bedeutet, dass es zunächst einmal darauf ankommt, autistischen Menschen z. B. durch Angebote zur Entspannung oder von Aktivitäten, die den individuellen Interessen entsprechen, zum emotionalen Wohlbefinden, zu einem Selbstwertgefühl, zu Freude und Glücksgefühlen (Flow-Erleben) zu verhelfen. Dadurch soll zugleich Momenten einer Hyperreaktivität vorgebeugt werden. Als hilfreich gilt zudem die kognitive Verhaltenstherapie, wenn es darum geht, Ängste abzubauen oder anders als bisher über unangenehme Stimuli (Geräusche, Gerüche etc.) zu denken. Ferner zielen P. Vermeulens Vorschläge darauf ab, eine autistische Person darin zu unterstützen, als Akteur der eigenen Entwicklung selbst Reize zu erzeugen, um Ereignisse besser vorhersehbar zu machen, ein Gefühl der Kontrolle über die eigenen Lebensumstände zu gewinnen sowie Vorhersagefehler verringern zu können. Einen wichtigen Stellenwert haben darüber hinaus Angebote einer kontextbezogenen Emotionserkennung sowie kontextualisierte Sozialgeschichten oder Skripte, bei denen Kontextvariationen fokussiert werden. Solche Unterstützungsformen sind den derzeit weit verbreiteten entkontextualisierten Übungsbehandlungen durch ein bloßes Benennen isolierter Gesichtsausdrücke (Emotionslernen) oder den diskreten Lernformaten im Rahmen von ABA überlegen. Das gilt ebenso für Trainingsprogramme, die soziale Fähigkeiten als isolierte, einzuübende Verhaltensweisen betrachten, anstatt den Kontext, die Komplexität und wechselseitige Dynamik von Interaktionen und sozialen Kommunikationen aufzubereiten, wie es z. B. die Theorie des doppelten Empathie- und Interaktionsproblems bei Autismus (dazu I. Heuer/H. Seng/G. Theunissen, Autismus – über vernachlässigte Themen, Freiburg i. Br.: Lambertus-Verlag 2024, i. E.) nahelegt.
Mit diesen Hinweisen wendet sich P. Vermeulen an Menschen aus dem Autismus-Spektrum sowie an Angehörige und professionelle Unterstützungspersonen, an die das Buch vorrangig adressiert ist. Diesbezüglich ist es ihm gelungen, neuere wissenschaftliche Erkenntnisse insbesondere auch jenseits der Autismusforschung für eine verstehende Sicht auf Autismus sowie für ein positives Denken und Handeln auf eine erfrischende Art und durch eine lebendige Diktion leicht zugänglich und verständlich gemacht zu haben. Damit passt die Schrift mit ihrem innovativen Gehalt nahtlos in die Reihe der vom Lambertus-Verlag publizierten Autismus-Bücher.
Freilich wäre es ein Missverständnis anzunehmen, Autismus nunmehr restlos durch den Ansatz des „prädiktiven Gehirns“ oder ‚predictive processing‘ verstehen zu können. Wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass komplexe Phänomene wie Autismus, bei denen immer auch soziale...
| Erscheint lt. Verlag | 1.7.2024 |
|---|---|
| Übersetzer | Reinhard Rudolph |
| Verlagsort | Freiburg |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sozialwissenschaften ► Pädagogik ► Sozialpädagogik |
| Schlagworte | Angehörige • Autismus • Betroffene • Familie • Gehirn • Gesellschaft • Jugendliche • Kinder • prädiktives Gehirn • Verhalten |
| ISBN-10 | 3-7841-3764-4 / 3784137644 |
| ISBN-13 | 978-3-7841-3764-3 / 9783784137643 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 7,7 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich