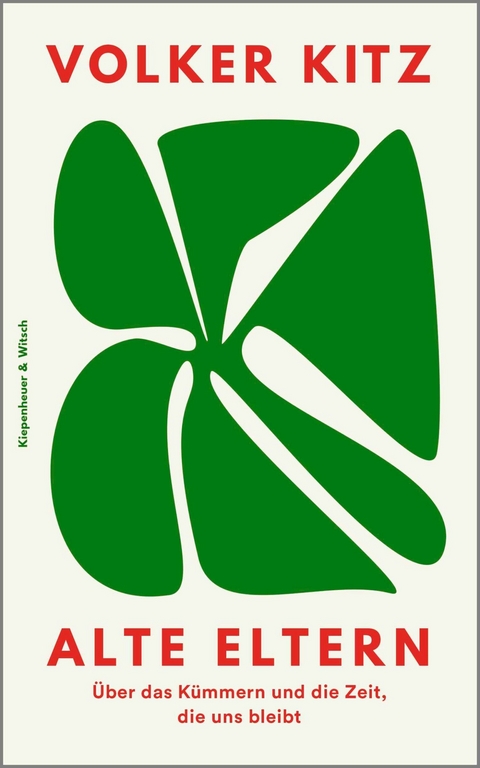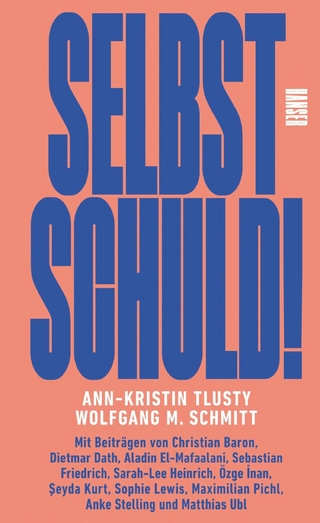Alte Eltern (eBook)

240 Seiten
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH
978-3-462-31137-2 (ISBN)
Volker Kitz, 1975 geboren, studierte Jura in Köln und New York. Seine Bücher wurden in zehn Sprachen übersetzt und stehen regelmäßig auf der SPIEGEL-Bestsellerliste, zuletzt »Feierabend« und »Konzentration«. Er lebt in Berlin.
Volker Kitz, 1975 geboren, studierte Jura in Köln und New York. Seine Bücher wurden in zehn Sprachen übersetzt und stehen regelmäßig auf der SPIEGEL-Bestsellerliste, zuletzt »Feierabend« und »Konzentration«. Er lebt in Berlin.
Sammeln, bewahren
Unsere Mutter hinterließ, als sie starb, auf ihrem Nachttisch einige Gegenstände: ein Familiengebetbuch mit starken Gebrauchsspuren, eine zusammengeklappte Brille, eine Lampe mit Stoffschirm und Kabeldruckschalter sowie eine Blechdose, in der sie den wenigen Schmuck verwahrte, den sie besaß. Das waren vor allem zwei Ketten, eine mit Steinen, die sie oft trug, und eine goldene, die ihr mein Vater, sonst kein großer Schenker, im Jahr zuvor zum fünfundsechzigsten Geburtstag gekauft hatte; »das ist doch viel zu teuer«, hatte sie erschrocken gemurmelt.
Fünfzehn Jahre verharrten diese Gegenstände nach ihrem Tod auf dem Nachttisch, als wären sie selbst gestorben; sie formten ein Stillleben, dessen Anordnung niemand zu stören wagte, und Jahr über Jahr wuchs das Stillleben um eine Staubschicht, wie ein Baumstamm Ring über Ring seinen Durchmesser weitet. Der Staub machte die Brillengläser undurchsichtig und verschneite das Gold der schweren Fassung. Abend für Abend schlief mein Vater neben der Anordnung ein und wachte Morgen für Morgen neben ihr auf. Irgendwann verschwand das Stillleben von einem Tag auf den anderen.
Über die Jahre veränderten sich meine Gefühle gegenüber den Gegenständen in dem Haus, in dem ich aufgewachsen war, und erst heute, im Rückblick, erkläre ich es mir damit, dass die Gegenstände selbst immer wieder ihre Bedeutung verändert haben.
Am Anfang war es Überforderung; wohin auf die Schnelle mit den Sachen eines Menschen, der plötzlich nicht mehr da ist? Man macht sie nicht einfach zu Müll, man hat ohnehin viel zu tun, so blieben sie, wo sie waren. Später, als in das Haus ein Alltag zurückkehrte, der Tod aber noch jung war, gebot die Pietät gegenüber der Verstorbenen, nichts anzurühren.
Als die Pietätsfrist verstrichen war, wurden die Gegenstände zu Objekten der Erinnerung. Sah ich die Brille auf dem Nachttisch, dann sah ich in der Erinnerung meine Mutter auf ihrer Doppelbettseite, die Decke immer bis zum Hals, heraus ragten nur der Kopf auf dem Kissen und zwei Hände, die ein Buch hielten. Mein Schlafzimmer war nebenan, abends klopfte sie zweimal schnell hintereinander gegen die Wand, es klang wie ein Geheimzeichen und war ihr Gutenachtgruß an mich, wenn sie Buch und Brille weglegte und sich auf die Seite drehte. Kam ich nach ihrem Tod zu Besuch, hörte ich das Klopfen in meiner Erinnerung.
Wie oft mag mein Vater, vor dem Einschlafen, nach dem Aufwachen, mitten in der Nacht, das Erinnerungsensemble betrachtet haben? Was mag er gesehen haben, gehört, gerochen?
Die Phase, in der die Gegenstände Erinnerungsobjekte waren, nahm die meisten der fünfzehn Jahre ein. Irgendwann aber ging auch diese Ära zu Ende. Es kam der Zeitpunkt, an dem sich das Stillleben von seinem Verweis auf die Vergangenheit löste und in einen unscharfen Hintergrund trat, wo es endgültig zum Staubfang und Störelement wurde. Da hätte man den Nachttisch räumen müssen. Dass mein Vater auch jetzt nichts anrührte, erkläre ich mir mit Bequemlichkeit. Zum Glück willigte er irgendwann, viel, viel später, ein, wenigstens an einem Vormittag in der Woche eine Putzhilfe ins Haus zu lassen. Auch sie tastete den Tisch der Toten lange nicht an.
Eines Tages aber war der Nachttisch geräumt und gesäubert. Die Putzhilfe hatte uns nicht gefragt. Sie hatte auch nichts entsorgt. Sie hatte einen Weg gefunden, mit den Gegenständen umzugehen, die Erinnerung verkörperten. Sie hatte sie an einen anderen Ort im selben Haus geschafft: Sie stehen jetzt auf der Treppe zum Dachboden. Wir können alles hervorholen, wann immer wir wollen. Aber es stört nicht mehr und staubt nicht mehr.
Damals musste ich an ein Museum denken. Es kam mir vor, als hätten wir die Sachen unserer Mutter von der Ausstellung ins Depot geschafft, damit man die Ausstellungsfläche neu nutzen konnte.
Der Museumsvergleich drängt sich auf, denn unser Familienhaus ist alt. Das geschmiedete Balkongitter trägt die Initialen meines Opas, des Vaters meiner Mutter, und die Jahreszahl »1937«. Er hat das Haus gebaut, die Familienheimat begründet, in einer Zeit, in der noch Pferdegespanne über die Dorfstraße fuhren; so hat es unsere Mutter erzählt. Mit vier Geschwistern, drei Brüdern und einer Schwester, wuchs sie in dem Haus auf, dessen Garten sich zu allen Seiten erstreckt. In einem Zimmer gleich hinter dem Eingang befand sich das erste Büro des Familienbetriebs meines Opas. Es war ein Granitsteinbruch im Odenwald, den die Familie meines Onkels heute als viel größeres Unternehmen fortführt; auch sie wohnte einmal in dem Haus. Klopft man gegen die Wand hinter der Garderobe, hört man das Holz, das unter der Tapete die Türöffnung von damals verdeckt. Als Kinder haben wir in einem Einbauschrank auf dem Dachboden Gasmasken aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden.
Drei Jahre nach meiner Geburt zogen wir in das Familienhaus. Es war jetzt auch das Haus meines Vaters. Der Wald wenige Minuten entfernt war jetzt auch der Spazierwald meines Vaters; die Rehe, die wir dort beobachteten, waren auch seine. Das Moos, das wir in diesem Wald sammelten, lagert in den Kisten mit den Krippenfiguren auf dem Dachboden. Der Schreibtisch, an dem ich meine Hausaufgaben machte und in dessen Schublade ich mein erstes Sparbuch in einer Geldkassette aufbewahrte, lehnt zerlegt in der Garage. Man muss aufpassen, dass man ihn mit dem Auto nicht streift.
Viele Jahre war unser Haus ein unhinterfragter Ort des Sammelns und Bewahrens gewesen. Ich war vor dem Tod unserer Mutter ausgezogen, nach Abitur und Zivildienst. Doch unser Vater bewohnte das Haus weiter, die Rehe im Wald beobachtete er nun alleine, und im Obergeschoss sind die Zimmer für meinen Bruder und mich bis heute eingerichtet. Das Haus war Anlaufort der Familie geblieben, und wir besuchten unseren Vater regelmäßig.
Im Jahr 2020, als die Pandemie begonnen hatte, verdichteten sich für mich erstmals Hinweise darauf, dass es nicht immer so weitergehen würde. Ein Ausnahmezustand hatte eingesetzt, den niemand für möglich gehalten hatte. Wir reisten monatelang nicht zum Vater. Reisen war nicht verboten, aber es galten zahlreiche, sich ständig ändernde Einschränkungen. Vor allem wollten wir unseren Vater nicht anstecken. Überall wurde davor gewarnt, Menschen aus »vulnerablen Gruppen« zu treffen. Unser Vater war in mehrfacher Hinsicht »vulnerabel«, wegen seines Alters und seiner Krankheiten. Im Jahr zuvor hatte er eine künstliche Herzklappe bekommen und Stents, sein Blutdruck war hoch. Inzwischen war er auch zu dem Neurologen gegangen. Erst vorsichtig, dann immer deutlicher, hatte der Neurologe eine Diagnose gestellt. Sie lautete: »demenzielles Syndrom«. Mein Vater bekam nun Donepezil, eines der wenigen Medikamente zur Behandlung von Demenz. Doch der Arzt dämpfte die Hoffnung. Die Tablette, eine am Tag, heile Demenz nicht und halte sie nicht an. Sie verlängere nur den Zeitraum, in dem jemand eigenverantwortlich dort wohnen bleiben kann, was er Zuhause nennt: »Im Durchschnitt um einundzwanzig Komma vier Monate.«
Nur an seinem Geburtstag hatten wir unseren Vater zu besuchen gewagt. Es war Sommer, wir nahmen einen Mietwagen, wohnten im Hotel und trafen uns mit dem Vater auf seiner Terrasse. Durch das Küchenfenster beobachtete ich, wie er seine Tabletten ordnete, zählte, schluckte. Er brauchte sehr lange. Es beunruhigte mich.
Danach reiste ich alle zwei Monate für eine Nacht an, betrat das Haus mit Schutzmaske, wir aßen an getrennten Tischen; Kontrollbesuche, kaum soziale Ereignisse.
Der Vater trat aus Angst vor Ansteckung kaum noch auf die Straße. Er ging nicht mehr zur Kirche. Er ging nicht mehr zu seiner Sportgruppe. Er ging nicht mehr in den Supermarkt. Wie viele ältere Menschen hatte ihn die Pandemie isoliert. Damit er nicht einkaufen musste, bestellte ich Essen auf Rädern. Auf diese Idee kamen in jenen Ausnahmemonaten viele, massenhaft schienen Menschen jetzt zu bemerken, dass sie mehr Hilfe brauchten, als sie sich eingestanden. Die Kapazitäten der Unternehmen waren begrenzt, erst nach einigen Anläufen hatte ich Glück. Jeden Mittag wurde meinem Vater nun ein warmes Essen in einer Styroporkiste vor die Haustür gestellt. Es wurde gestellt, im Passiv, denn ein handelnder Mensch trat für meinen Vater nicht in Erscheinung. Manchmal klingelte der Bote, manchmal vergaß er es. Er fuhr weg, bevor mein Vater öffnete. Persönlicher Kontakt war aus Sicherheitsgründen zu vermeiden. Mein Vater blieb allein.
Die Isolation wirkte. An manchen Tagen legte sie sich auf seine Fähigkeiten wie ein böser Zauber. Es kam nun vor, dass ich bei meinen Kontrollbesuchen den Rasierapparat im Kühlschrank fand. Es kam nun vor, dass er alle Brillen im Haus zusammentrug, die aktuelle Brille, alte Brillen, Ersatzbrillen, sie nebeneinanderlegte und fragte: »Was mache ich damit?« Es kam nun vor, dass er mir die Fernbedienung zeigte und fragte: »Wozu ist das da?« Es kam nun vor, dass das Telefon klingelte und er ein Brillenetui ans Ohr hielt und hineinsprach.
Was sich bei meinem Blick durchs Fenster angekündigt hatte, trat ein: Er saß vor den Medikamentenschachteln und einem Glas Wasser, rief uns an: »Was mache ich mit den Tabletten?« Noch einige Zeit versuchten mein Bruder und ich, unseren Vater über das Telefon durch die Handgriffe zu führen: morgens sieben Tabletten, abends vier. An manchen Tagen brauchten wir zwei Stunden. Ich fragte den Arzt nach einem ambulanten Pflegedienst; wir könnten damit anfangen, sagte er, doch es gebe kein Zurück. Morgens und abends fuhr nun ein kleines Auto vors Haus. Beim Betreten streiften sich die Pflegerinnen und Pfleger einen Schutzanzug über, sie sahen gespenstisch aus, wie Wesen,...
| Erscheint lt. Verlag | 15.8.2024 |
|---|---|
| Verlagsort | Köln |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Geschichte / Politik ► Politik / Gesellschaft |
| Sozialwissenschaften ► Politik / Verwaltung | |
| Schlagworte | Abschied • Abschied Eltern • alte Eltern • Alzheimer • Autobiographisch • Bericht • Buch über Vater • Demenz • Eltern pflegen • Erfahrungsbericht • Erinnerung • Erinnerungen • Essay • familiäre Verantwortung • literarisch • Marianne Koch • persönlich • Pflege • Pflegeheim • Tod • Tod der Eltern • Trauer • Umgang mit alten Eltern • Vater • Verlust |
| ISBN-10 | 3-462-31137-9 / 3462311379 |
| ISBN-13 | 978-3-462-31137-2 / 9783462311372 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 1,5 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich