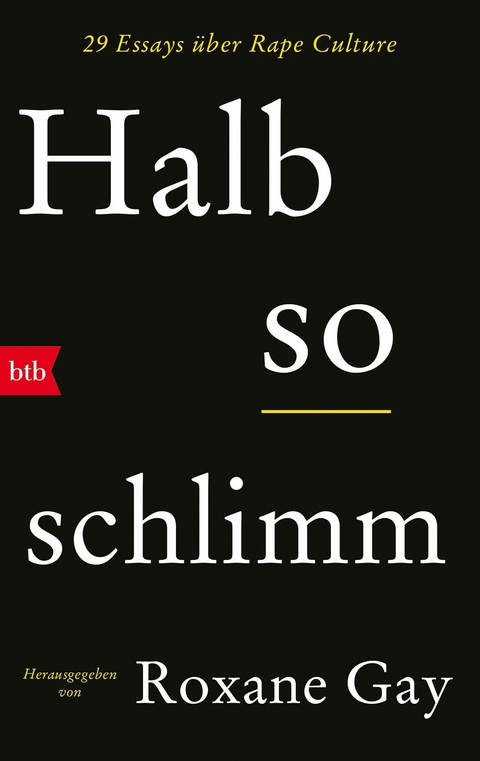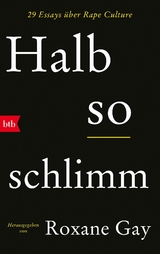»Alles daran war schrecklich, aber es war halb so schlimm.« 29 Beitragende schreiben über eine Welt, in der man als Betroffene*r von sexueller Gewalt und Aggression die Folgen oft allein ertragen muss und sich einredet, dass es ganz so schlimm nicht gewesen sein kann. Eine Welt, in der Überlebende von Missbrauch - falls sie sich doch trauen, ihre Stimme zu erheben - routinemäßig diskreditiert, verunglimpft, verleumdet, herablassend behandelt, verspottet, beschämt, beleidigt und schikaniert werden. Eine Welt, in der es normal zu sein scheint, in einer Rape Culture zu leben, Kindesmissbrauch zu dulden und auf der Straße belästigt zu werden. »Halb so schlimm« versammelt Essays, die sich oft sehr persönlich und immer unerschrocken ehrlich zeigen, die unsere Welt spiegeln, wie sie ist, und gleichzeitig endlich klarstellen wollen, dass halb so schlimm nicht mehr gut genug sein darf.
Ausgewählt von Kulturkritikerin und Bestsellerautorin Roxane Gay.
Mit Beiträgen von: Aubrey Hirsch, Jill Christman, Claire Schwartz, Lynn Melnick, Brandon Taylor, Emma Smith-Stevens, AJ McKenna, Lisa Mecham, Vanessa Mártir, Ally Sheedy, xTx, So mayer, Nora Salem, Lyz Lenz, Amy Jo Burns, V.L. Seek, Michelle Chen, Gabrielle Union, Liz Rosema, Anthony Frame, Samitha Mukhopadhyay, Miriam Zoila Pérez, Zoë Medeiros, Sharisse Tracey, Stacey May Fowles, Elisabeth Fairfield Stokes, Meredith Talusan, Nicole Boyce, Elissa Bassist
Roxane Gay, geboren 1974, ist Autorin, Professorin für Literatur und eine der wichtigsten gesellschaftspolitischen und literarischen Stimmen ihrer Zeit. Sie schreibt u.a. für die New York Times und den Guardian, sie ist Mitautorin des Marvel-Comics »World of Wakanda«, Vorlage für den hochgelobten Actionfilm »Black Panther« (2018), dem dritterfolgreichsten Film aller Zeiten in den USA. Roxane Gay ist Gewinnerin des PEN Center USA Freedom to Write Award. Sie lebt in Indiana und Los Angeles.
JILL CHRISTMAN
Slaughterhouse Island
Die Schwierigkeit, diese Geschichte zu erzählen, liegt darin, dass es mir sogar dreißig Jahre später noch schwerfällt, die hartnäckigen Überreste der Scham abzulegen, und das, obwohl ich – zweifelsfrei – weiß, wo die Schuld liegt. Ich kratze die letzten klebrigen Reste mit dem Daumennagel ab.
Ja, ich habe einige Dummheiten gemacht. Wie wir alle. Aber heute weiß ich, dass wir ein Recht darauf haben, Kinder zu sein, die ihre tief sitzenden Unsicherheiten hinter Eitelkeit verstecken. Wir tragen bauchfreie Tops und enge Jeans mit Spitzengürtel und dazu hochhackige Stiefel. Wir betrachten uns zehnmal in dem großen Spiegel im Wohnheimzimmer und recken den Hals, um zu sehen, wie fett unser dürrer kleiner Hintern von hinten aussieht, wir kippen sogar zuckrig süße Drinks und schlucken harmlos aussehende Pillen, von denen wir hoffen, dass wir uns davon besser fühlen oder schneller tanzen oder hübscher aussehen oder einfach nur vergessen. Wir wollen, dass zur Abwechslung mal irgendetwas einfach ist. Wir treffen jede Entscheidung auf einer alltäglichen Skala zwischen Voraussicht und purer Selbstsabotage.
Und trotzdem verdienen wir es nicht, vergewaltigt zu werden. Niemals.
Wie konnte es sich überhaupt so tief in unseren Köpfen verankern, die Schuld bei den Opfern zu suchen? Dreh es doch mal um, sage ich mir, mit dem Daumennagel kratzend. Stell es dir umgekehrt vor. Was hätte Kurt tun müssen, damit ich geglaubt hätte, ich hätte das Recht, ihn zu vergewaltigen?
Es gibt keine Antwort auf diese Frage.
Ich will die Zeit zurückdrehen. Ich will in dieses italienische Restaurant in Eugene, Oregon, gehen, wo mein achtzehnjähriges Ich sein erstes, unbehagliches Date mit Kurt hat. Ich will die Hand der jungen Frau nehmen und sie bitten, mit mir auf die Toilette zu kommen. Statt zuzulassen, dass sie die vier Bissen Pasta in Sahnesauce wieder auskotzt, die sie zu Abend gegessen hat – und ich weiß, dass sie an nichts anderes denken kann, während sie Kurts spitze Zähne im Kerzenlicht blitzen sieht –, will ich sie in die entgegengesetzte Richtung zum Ausgang ziehen.
Wir würden das Restaurant zusammen verlassen, ich würde sie ins Wohnheim zurückbringen, und wir würden uns unterhalten. Irgendwie würde ich sie vor dem bewahren, was uns als Nächstes passieren wird, obwohl ich weiß, Süße, dass es nicht deine Schuld ist. Nichts davon ist deine Schuld. Hörst du mich?
Nicht. Deine. Schuld.
Aber von hier aus der Zukunft kann ich bloß zusehen.
»Du fährst einen Porsche«, sagte ich – mit kaum hörbarem e, wie Borscht, nur ohne das t am Ende. Ich ließ mich in die weichen Ledersitze von Kurts elegantem silbernem Auto sinken und hoffte, dass meine Freund*innen im zweiten Stock des Erstsemesterwohnheims uns hinter den Vorhängen beobachteten. Er beugte sich zu mir. Sein Atem roch zu stark nach Pfefferminz, das bereits schütter werdende Haar glänzte in der Frühlingssonne vor Gel, und er ließ die Hand vom Schalthebel auf mein Bein rutschen. Ich glaube, er wollte sexy aussehen, aber es wirkte nur irre.
»Por-schäh«, sagte er. »Menschen, die keinen Por-schäh haben, sagen Porsche. Leute, die Por-schähs fahren, sagen Porschäh.«
Ich zog mein Knie einen Millimeter zur Seite, ein minimaler Einwand, und sagte: »Na ja, ich habe ja keinen Porsche, also nenne ich ihn lieber Porsche.«
»Du bist ja jetzt mit mir zusammen«, sagte er, die Lippen zu einem Lächeln verzogen. »Jetzt kannst du dieses Auto Por-schäh nennen.«
Ich hatte noch nie vorher ein solches Date gehabt – wie ich mir ein echtes College-Date vorstellte, bei dem Kurt alles öffnete, zurechtrückte, festhielt oder übernahm, was es zu öffnen, zurechtzurücken, festzuhalten oder zu übernehmen gab: die Tür des Por-schäh, meinen Stuhl am Tisch, mich am Arm, als mir ein anderer Mann zu nahe kam, und natürlich die Rechnung. Wir gingen in ein schickes italienisches Restaurant mit weißen Leinentischtüchern, Kerzen und gedämpftem Licht, wo wir uns darüber unterhielten, wie viel Zeit wir im Fitnessstudio am Rande des Campus verbrachten: ich, die in den Aerobic-Kursen alle Kalorien verbrannte, die ich in schwachen Momenten zu mir genommen hatte, und er, der in der Testosteronbrühe des großen Fitnessraums riesige Eisenscheiben hochstemmte und runterknallen ließ.
Wir waren beide zu stark gebräunt. Damals bekam man in den überheizten Kabinen im Einkaufszentrum nahe dem Campus zehnmal Solarium für 20 Dollar. Ich war im ersten Jahr am Honors College, las Darwin und Shakespeare und Austen, war schwer beeindruckt von Mary Shelleys Frankenstein, von Theorien über sexuelle Auslese und den Ursprung des Universums. Kurt studierte Wirtschaft und drehte im letzten Jahr eine Ehrenrunde – ich hörte den Ausdruck zum ersten Mal, kam aber schnell dahinter, dass diese »Ehre« nichts Positives war.
Da wir sonst nicht viele Gesprächsthemen hatten, redeten wir übers Solarium. Ich erzählte, dass ich unter dem Gerät immer einschlief, wenn der summende blaue Uterus mir eine Atempause vom grauen Winter in Eugene schenkte – obwohl ich sicher bin, dass ich an dem Abend nicht »Uterus« gesagt habe –, und Kurts Zähne schimmerten im Kerzenlicht wie in einem Horrorfilm.
Nach dem Essen brachte Kurt mich in ein Apartment, das nicht so aussah, als würde dort jemand wohnen. Er gab mir etwas zu trinken und führte mich durch das Wohnzimmer, in dem eine schwarze Ledercouch und ein gläserner Couchtisch standen, ins Schlafzimmer. Dort schloss er die Tür und zeigte mir seine Hanteln, an der Wand aufgereiht wie Schuhe, dann schob er mich zum Schreibtisch. Ich weiß noch, dass er die Hände ständig auf meinem Körper hatte, und noch bevor er den Spiegel und die Rasierklinge aus der Schreibtischschublade holte, dachte ich: Das ist nicht gut.
Kurt holte ein gefaltetes Papierbriefchen aus der Manteltasche – Junkie-Origami – und kippte zwei schneeweiße Häufchen auf das Glas. Ich sah zu, wie er teilte und schabte. Von dem Geräusch zuckte ich leicht zusammen, eine Gabel auf Porzellan, Fingernägel auf der Tafel, ein Alarmsignal, das ich ignorieren würde. Ich spürte bis in die tiefsten Fasern meines Körpers, dass ich verschwinden sollte, aber dies war ein Abend der ersten Male meines Collegelebens: erstes Date im Restaurant, erste Porschefahrt, erste Line. Kurt rollte einen frischen Geldschein aus seinem Portemonnaie zusammen und zeigte mir, was ich tun musste.
Es brannte. Und dann? Nicht viel. Das Koks bewirkte nicht mehr als das Gefühl, dass meine Augen weit aufgerissen waren. Ich sollte übergenau wahrnehmen, was danach geschah.
Was ebenfalls fast nichts war. Er küsste mich und zog mich dabei aufs Bett. Er war der schlechteste Küsser der Welt, seine bohrende Zunge kam mir vor wie eine Nacktschnecke, die in meinen Hals kriechen wollte. Ich war abgestoßen, wurde aber (wie ich heute weiß) vom Koks gerettet: Er kriegte keinen hoch. Er rieb sich an mir. Durch den dünnen Anzugstoff seiner Kakihose spürte ich ihn weich wie ein Milchbrötchen an meinem Oberschenkel.
Aus den Lautsprechern sang George Michael. Statt sich weiter dieser, wie er wohl aus Erfahrung wusste, vergeblichen Liebesmüh zu widmen, sprang Kurt vom Bett auf, als hätte er das alles so geplant, und drehte die Stereoanlage auf. I will be your father figure. Als ich ihn eine halbe Stunde später bat, mich ins Wohnheim zurückzufahren, tat er das ohne große Widerrede. Im Por-schäh.
Offenbar hatte Kurt sich besser amüsiert als ich, denn am nächsten Tag rief er an, um zu fragen, ob ich mit ihm zum Shasta-See fahren wolle. Dort veranstalteten die Studentenverbindungen der Universität von Oregon jedes Jahr zum Memorial Day eine traditionelle Feier: mindestens hundert gemietete Hausboote, darauf jeweils acht Pärchen und reichlich Bier, das aus kleinen Fässern strömte. Rote Plastikbecher schaukelten auf dem Wasser wie Bojen.
Man stelle sich vor: Alkohol und Drogen. Schlafmangel und jugendlicher Leichtsinn. Die Hitze, die Dehydrierung und das Essen, zubereitet von den Halbstarken, die diesen Albtraum veranstalteten. Man stelle sich vor: Niemand auf dem ganzen Boot hatte an Sonnencreme gedacht. Die Untiefen brennender, unerfüllter Leidenschaft – und dann die gefährlichen Untiefen des Wassers.
Man stelle sich außerdem vor: Ich hatte bereits geplant, mit einem Freund aus meinem Wohnheim dort hinzugehen, mit einem Jungen namens Jeff, der im letzten Herbst einer Verbindung beigetreten war. Jeff reichte mir gerade mal bis zur Nase, wenn er sich streckte, aber er war klug und brachte mich zum Lachen, also hatte ich zugesagt, als er fast beiläufig vorgeschlagen hatte, mich zum Shasta mitzunehmen.
Aber eine richtige Einladung von einem richtigen Date mit einem richtigen Auto und einem richtigen Apartment und richtigen Möbeln schien mir genau der richtige Statuskick zu sein, um vom Vollstipendiums-Hippiemädchen mit Beatles-Postern und Batiktüchern an den Wänden ihres Wohnheimzimmers aufzusteigen zur … zur was eigentlich?
Was wollte ich sein? Ein Teil des Systems, das meine liberalen Künstlereltern immer abgelehnt hatten? Wollte ich gesehen werden? Akzeptiert? Begehrt?
Ich mochte Kurt nicht mal. Er stand für alles, dem ich in dieser Welt zu misstrauen gelernt hatte: privilegierte Vorortschnösel, die glaubten, mit genug Geld könnten sie alles haben, einschließlich mir.
Also tat ich zuerst das Richtige: Ich lehnte Kurts Einladung ab. Aber meine beste Freundin D. hatte kein Date für den Trip auf dem See, und ich hatte das Gefühl, sie im...
| Erscheint lt. Verlag | 11.9.2024 |
|---|---|
| Übersetzer | Cornelia Röser |
| Sprache | deutsch |
| Original-Titel | Not that Bad. Dispatches from Rape Culture |
| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Geschichte / Politik ► Politik / Gesellschaft |
| Sozialwissenschaften ► Politik / Verwaltung | |
| Schlagworte | 2024 • 29 essays • Aufarbeitung • Brandon Taylor • claire schwartz • eBooks • Neuerscheinung • not that bad • pesönliche berichte • Rape Culture • Roxane Gay • Sexueller Missbrauch • stacey may fowles • Vergewaltigung |
| ISBN-10 | 3-641-25851-0 / 3641258510 |
| ISBN-13 | 978-3-641-25851-1 / 9783641258511 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 3,5 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich