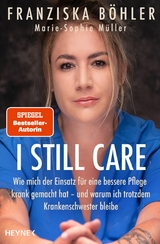I still care (eBook)

256 Seiten
Heyne (Verlag)
978-3-641-31401-9 (ISBN)
Sehr persönlich und gnadenlos ehrlich schildert Franziska Böhler, was der Einsatz für die Pflege mit ihr gemacht hat, wie sie selbst daran fast zerbrach, krank wurde und wieder heilen konnte. Denn damit man anderen helfen kann, muss es zuerst einem selbst gut gehen. Und sie stellt die Frage, wie wir mit den Menschen umgehen, die sich für andere einsetzen - sei es im Krankenhaus oder im Aktivismus.
Franziska Böhler arbeitete seit 2007 als Krankenschwester auf einer Intensivstation in der Nähe von Frankfurt am Main. Im Mai 2020 wechselte sie von der Intensivmedizin in die Anästhesie. Als @thefabulousfranzi hat die Mutter von zwei Kindern rund 250.000 Follower auf Instagram, wo sie regelmäßig auf den Pflegenotstand aufmerksam macht. Ihr erstes Buch I'm a nurse erreichte Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste und wurde 2020 mit dem LovelyBooks Leserpreis in Silber ausgezeichnet.
Vorwort
Ich bin Krankenschwester. Ich bin Pflegeaktivistin, ich bin Influencerin, ich bin Mutter, ich bin Ehefrau, ich bin Freundin. Ich bin gewissenhaft, kollegial, zuverlässig, spontan, witzig. Ich bin überfordert, dünnhäutig, verletzt. Ich bin Franzi.
Ich bin Krankenschwester. Mit diesem Satz fing mein erstes Buch an, und manchmal wünschte ich, ich hätte es dabei belassen, hätte den Mund gehalten und keinen Instagram-Kanal mit Hunderttausenden Followern ins Leben gerufen. Im März 2023 habe ich mir laut die Frage gestellt, ob das besser gewesen wäre. »Laut« heißt, auf Instagram, wo meine 250000 Follower mein Leben oder das, was ich davon zeige, tagtäglich verfolgen. Ich habe das Foto von mir hochgeladen, mit dem es fünf Jahre zuvor angefangen hat. Damals stand ich nach einem Arbeitstag im Klinikum Aschaffenburg im Pathologieaufzug und fotografierte mich im Spiegel. Rechte Hand in der Kitteltasche, linke am iPhone, die blonden Haare zu einem praktischen Knäuel zurückgebunden, Augen mit Kajal umrandet, die kurzen Ärmel des Kittels umgekrempelt – so viel Fashion muss sein. Arme noch untätowiert. Vorsichtiges Lächeln. Ein Foto, wie man es seinem Freund nach der Schicht zuschicken würde, kurz bevor man nach Hause fährt. Darunter stand ein Text, der nicht so ganz zu dem lieblichen Bild passte.
Damals habe ich begonnen, von unserem Arbeitsalltag auf der Intensivstation zu berichten. Von der Frustration, in einem systemrelevanten Beruf in chronisch unterbesetzten Teams zu arbeiten, von der pausenlosen Hetze, der Sorge, den Patienten nicht gerecht werden oder ihnen sogar schaden zu können, von beträchtlichen Systemproblemen, die dazu führten, dass erfahrene und sonst unerschütterliche Kolleginnen plötzlich weinend im Flur hockten.
Wenn eine Intensivkrankenschwester nach der Schicht nach Hause fährt, hat sie in viele Hilfe suchende Augen geblickt, hat Menschen um ihr Leben bangen oder sogar sterben sehen, das gehört zum Alltag. Ein Alltag, dem gegenüber ich gewappnet bin. So nah mir jedes einzelne Schicksal geht, es ist nach so vielen Jahren im Dienst zur Routine geworden. Eine Überlebensstrategie, die sich jeder Arzt, jede Ärztin, jeder Pfleger und jede Krankenschwester aneignet. Woran sich keiner gewöhnen kann, ist die Überforderung auf einer dauerhaft unterbesetzten Station. Keine Arbeit kann liegen bleiben, weil das im schlimmsten Fall ein Leben kosten kann.
Zu Hause erwartet dich dann die andere Realität. Hausaufgabenbetreuung, Wäsche waschen, Katzen füttern oder ein krankes Elternteil versorgen. Mein Leben als Krankenschwester hatte schon immer zwei Gesichter. Mit meinem Leben als öffentliche Person sind noch andere dazugekommen.
Seit diesen ersten Beiträgen vor fünf Jahren ist die Zahl der Menschen, die mir folgen wollten, sprungartig gewachsen. Seit der Coronapandemie gibt es zum Glück viele Menschen, die sich auf Social Media zum Pflegenotstand äußern, damals war ich eine von wenigen. Die sich äußerten, waren hauptsächlich Männer. Obwohl der Pflegeberuf vor allem von Frauen getragen wird, waren die öffentlich beinah unsichtbar. Ich wollte diejenige sein, die das ändert.
Ich war jemand, die stellvertretend für viele sprach. Eine junge Frau aus dem Dorf, wie so viele; eine Krankenschwester, die unter dem akuten Personalmangel leidet, wie so viele, eine Mutter von zwei Kindern, wie so viele. Ich bin kein Popstar, keine Fußballerehefrau, keine Berlin-Mitte-Fashionmutti, sondern eine Krankenschwester vom Land. Eine mit Dekofimmel, die gern Cola light trinkt, manchmal auch Underberg, und abends im Bett Grey’s Anatomy guckt. Eine, der gern egal wäre, was andere von ihr denken.
Mir war immer wichtig, dass ich mich nicht nur aktivistisch zeige, sondern dass man mich kennenlernt. Darum gebe ich vieles aus meinem Leben preis, zeige, wie mein Hund den Staubsauger attackiert, wie ich zwanzig Ballons für den Kindergeburtstag aufpuste oder Möhren für die Bolognesesoße schnipple. Ich will, dass die Menschen, die mich lesen, sehen oder hören, wissen, dass ich eine von ihnen bin, eine mit stinknormalen Problemen (ja, auch mit Pool im Garten ist das möglich). Ich muss putzen, Wäsche waschen, Hund oder Katze zum Tierarzt bringen, habe Kinderbetreuungsprobleme, telefoniere mir für einen Arzttermin die Finger wund oder muss Kaugummis aus dem Teppich knibbeln, so wie andere eben auch. Daneben kämpfe ich für bessere Zustände in der Pflege, setze mich dafür ein, dass Jugendliche einen Einblick in den Beruf bekommen, wirke daran mit, dass Long Covid ernst genommen wird, bereite Lesungen oder Podcast-Folgen vor oder arbeite an diesem Buch. Nicht weil ich etwas Besonderes bin, sondern weil ich ganz normal bin. Ich will damit zeigen, dass auch andere in meiner Position sich für Veränderung, Träume und Ideale starkmachen können. Ich bin wie so viele andere Frauen in Deutschland – dafür werde ich geliebt, und dafür werde ich gehasst.
Den Hass kann man sich nicht vorstellen, bis man ihn abkriegt. Er kommt als spitzer Kommentar, als Nörgelei, als abschätziger Blick, als dicker, glänzender Spuckehaufen vor meinen Füßen auf dem Supermarktparkplatz, als tiefer Kratzer im Kotflügel meines Autos, als Morddrohung. Ich dachte immer, dass ich hartgesotten sei, dass mich nichts so leicht umhaut, aber es kam anders. Es kam schlimmer. Ich hatte immer den Anspruch, für andere da zu sein. Anlaufpunkt, Vertrauensmensch, Fels in der Brandung. Die, die Probleme löst, die Gutes will, die heilt oder zumindest Zuversicht gibt. So arbeite ich als Krankenschwester, so versuche ich als Freundin, Kollegin, Frau und Mutter zu sein, und so bin ich auch meinen Zuhörern, Lesern und Followern gegenüber.
Ich war stolz darauf, diejenige zu sein, die fast alle Direktnachrichten beantwortet, und das waren zu Stoßzeiten 3000 am Tag. Wie schafft man das, neben Job, Buch, Leben? Eigentlich ist es unmöglich, es sei denn, man hört auf zu schlafen. Und das habe ich, mehr oder weniger, getan. Erst weil ich nicht aufhören, nicht abschalten konnte, später weil ich Angst hatte, die Kontrolle zu verlieren. Bloß nicht einschlafen, bloß keine Schwäche zeigen.
Ich hatte und habe ein extremes Verantwortungsbewusstsein. Wenn mir am Anfang der Coronapandemie eine Frau schrieb, dass der Mann keine Luft mehr bekommt, und mich fragte, was jetzt zu tun sei, wusste ich natürlich, dass nicht ich, sondern der Notruf der richtige Ansprechpartner war. Trotzdem hat es mich fertiggemacht, wenn ich eine solche Nachricht erst Stunden später las und mir ausmalte, was inzwischen passiert sein könnte, weil ich nicht direkt geantwortet und an den Notruf verwiesen hatte. Ich bin die Art Frau, die sagt: »Lass mal, ich mach das schon«, »Ich kümmere mich drum«, »Ich schaffe das«. Ihr alle kennt diese Menschen. Sie machen das nicht aus reiner Hilfsbereitschaft, sondern auch, weil sie glauben, es sei einfacher so. Und weil sie vermeintlich die Kontrolle bewahren. Das ist auch überheblich, dessen bin ich mir bewusst. Ich bin so ein Mensch, mir fällt es schwer, Hilfe anzunehmen, ich bin Einzelkämpferin, und so gehe ich auch an die Probleme anderer heran: »Schieb mal rüber, ich bieg das hin«. Am Ende hilft diese Einstellung niemandem, dass musste ich schmerzlich erfahren, ganz abstellen, kann ich sie noch immer nicht.
Unter den Nachrichten waren natürlich viel banalere Dinge als medizinische Notrufe, trotzdem dachte ich, wenn ich mich auf diese Bühne stelle und gleichzeitig ich bleiben will, dann muss ich erreichbar sein und antworten. Ich muss dem Bild gerecht werden, das die Welt da draußen von mir hat. Aber irgendwann war ich mir selbst nicht mehr sicher, wer ich überhaupt bin. Die Franzi vom Dorf, Krankenschwester Franzi, Fabulous Franzi, TV-Franzi, Autorin Franzi, die alte Franzi, von der meine Freunde sagten, dass sie sie vermissen würden, die neue – aber wer sollte das überhaupt sein? Ich wusste nicht mehr, welche Gefühle mir zustehen, welche Schmerzen echt sind und welche Anstrengung mein öffentliches Leben wert ist. Was muss ich aushalten? Auf welche Liebe, auf welche Freundschaften kann ich mich verlassen? Wem kann ich vertrauen? Wer liebt mich?
Ich wurde von der Helfenden zur Hilfesuchenden. Ich bin zusammengebrochen und habe dabei die Fassade bewahrt. Ja, das geht! Es ist gewissermaßen Alltag auf Social Media.
Unter dem Bild von 2018, das ich fast fünf Jahre später noch einmal veröffentlichte, schrieb ich:
»Vielleicht hätte ich das alles hier nie anfangen dürfen. Vielleicht hätte das, was ich erreicht habe, nie mehr Wert gehabt als das, was es aus mir gemacht hat. (…) Ich war so naiv, zu glauben, hier gäbe es etwas Echtes und ich wäre stark genug, dem standzuhalten. Vielleicht hätte ich es am 4. August 2018 bei diesem Bild belassen sollen.«
16190 Likes und 373 Kommentare prasselten in den nächsten Stunden auf mich ein. 178 Direktnachrichten. Nur Liebe, Zuspruch, Dankbarkeit, Verständnis.
»Du hast schon so viel erreicht, so häufig aufgeklärt und Missstände und Realität in eurem Berufszweig und der Pflege für uns Laien sichtbar gemacht. Du warst und bist für mich eines der Gesichter, wenn es um diese Themen geht. Für alles, was du getan hast und tust, bin ich und so viele dir so dankbar!«, schreibt eine Elisabeth.
»Nix da, dann hätten wir uns nicht kennengelernt, und das wäre so eine Schande gewesen. So«, schreibt der Fernsehmoderator Daniel Bröckerhoff, mit dem zusammen ich den Podcast »Böhler & Bröckerhoff« ins Leben gerufen habe.
»Du bist echt«, schreibt Mascha.
»Franzi, Du bist und bleibst eine...
| Erscheint lt. Verlag | 14.8.2024 |
|---|---|
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Geschichte / Politik ► Politik / Gesellschaft |
| Sozialwissenschaften ► Politik / Verwaltung | |
| Schlagworte | 2024 • Aktivismus • Bestseller-Autorin • eBooks • eine für alle • Feminismus • Gesundheitssystem • Hass • Hass im Netz • I'm a nurse • influencerin • Instagram • Krankenschwester • Medizin • mentale Gesundheit • Mental Health • Neuerscheinung • Panikattacken • Pflege • Pflegenotstand • Spiegel Bestsellerliste aktuell • thefabulousfranzi |
| ISBN-10 | 3-641-31401-1 / 3641314011 |
| ISBN-13 | 978-3-641-31401-9 / 9783641314019 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 2,3 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich