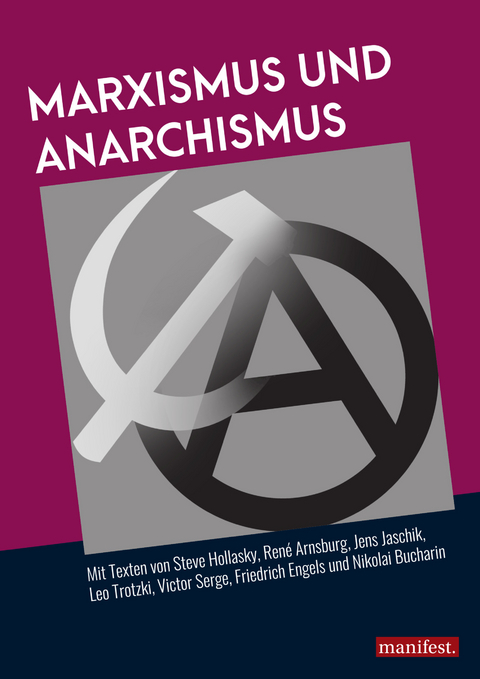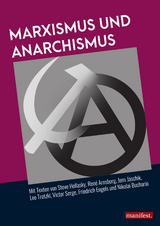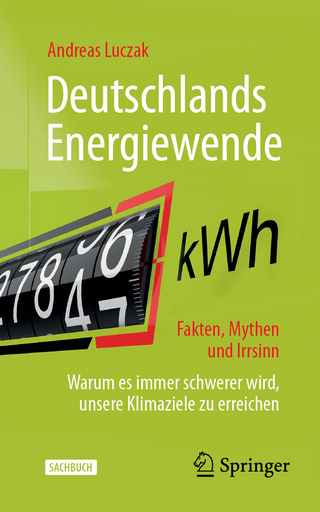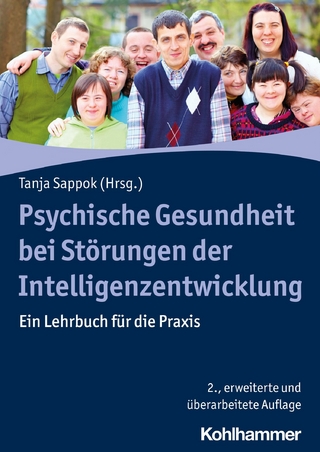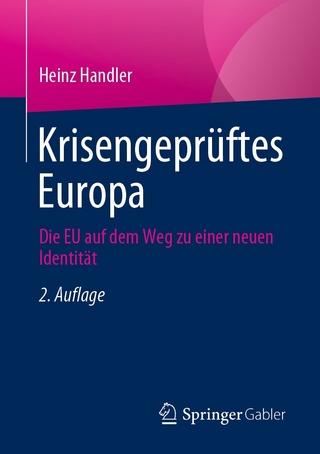Marxismus und Anarchismus (eBook)
264 Seiten
Manifest Verlag
978-3-7546-4142-2 (ISBN)
René Arnsburg ist Mitglied des Bundesvorstands der Sozialistischen Organisation Solidarität und in verschiedenen Gremien der Gewerkschaft ver.di aktiv. Bei Manifest erschien 2017 sein erstes Buch »Maschinen ohne Menschen.«
René Arnsburg ist Mitglied des Bundesvorstands der Sozialistischen Organisation Solidarität und in verschiedenen Gremien der Gewerkschaft ver.di aktiv. Bei Manifest erschien 2017 sein erstes Buch »Maschinen ohne Menschen.«
Steve Hollasky: Die Russische Revolution und der Anarchismus
Die Oktoberrevolution 1917 war ein Ereignis von welthistorischem Ausmaß – mit großer Sicherheit sogar das wichtigste des 20. Jahrhunderts. Die Bewertung der stürmischen Ereignisse im Russland des vierten Kriegsjahres brachte viele Gegner*innen des Kapitalismus an ihre Grenzen und in nicht wenigen Fällen offenbarte sie wo genau die politischen Strömungen innerhalb der Arbeiter*innenbewegung standen.
Karl Kautsky, der Cheftheoretiker der Zweiten Sozialistischen Internationale, in der die Arbeiter*innenparteien weltweit organisiert waren, mauserte sich zu einem der Chefankläger gegen Lenin, Trotzki und die Bolschewiki allgemein. Noch im Ersten Weltkrieg verfasste er Schmähschriften gegen die Oktoberrevolution. Der linke Flügel der Sozialistischen Internationale spaltete sich daher von dieser ab. Im Angesicht der revolutionären Ereignisse in Russland musste man Farbe bekennen.
Das zählte auch für die anarchistischen Organisationen. Ob nun große Gruppen oder kleine Grüppchen, sie alle mussten sich positionieren. Augustin Souchys Glaubenssatz mag hier symptomatisch sein. Geht es nach ihm, hätten die Anarchist*innen weltweit 1917 gehofft, dass »im Osten« endlich »die Sonne der Freiheit« aufgehe. Doch innerhalb von zwei Jahren nach dem Sieg der Revolution hätten die Ereignisse in Russland eine Wendung genommen, die die Anarchist*innen weltweit beunruhigt hätten. Denn Lenin hätte als die entscheidende Führungsperson an der Spitze der Bolschewiki die Diktatur des Proletariats »nicht nur gegen Feinde der Revolution« ausgerichtet, »sondern auch gegen ihre Freunde und Vorkämpfer«, wie der österreichische Anarchist in seiner Autobiografie festhält.
Noch deutlicher wurde Emma Goldmann. Die US-amerikanische Anarchistin hatte im Sowjetrussland nach der Revolution mitsamt ihres zeitweisen Lebensgefährten Alexander Berkman Zuflucht gefunden, nachdem beide aufgrund ihrer politischen Tätigkeit aus den USA ausgewiesen worden waren. Sie hatte das revolutionäre Land inmitten des Kampfes der Revolution um ihr Überleben mit einem Ticket der Bolschewiki durchreist. Ihre Bilanz war wenig freundlich: Während »das russische Volk, das allein die Revolution gemacht hatte, und das entschlossen war, sie um jeden Preis gegen die Eindringlinge zu verteidigen«, an »unzähligen Fronten« gekämpft habe, hätte »es dem Feinde der Revolution im Innern« keine Beachtung »schenken können.« Die Antwort auf die Frage, wer dieser »Feind im Innern« war, lässt in ihrem 1922 erschienen Büchlein zur »Niederlage der russischen Revolution« nicht lange auf sich warten. Es seien »die Bolschewiki« und ihr »zentralistischer Staat« gewesen.
So oder so ähnlich schildern viele Anarchist*innen die Oktoberrevolution bis heute. Sie seien für die Revolution, aber gegen die Machteroberung durch die Bolschewiki: Sie würden freie Sowjets bejahen, aber deren Zentralisierung ablehnen; sie würden den Kapitalismus abschaffen, jedoch ohne Unternehmen verstaatlichen zu wollen. Die Wahrheit war bei Weitem komplizierter und die Haltung der anarchistischen Bewegung, die man aufgrund ihrer organisatorischen und auch programmatischen Zersplitterung nur schwer so nennen kann, lange nicht so eindeutig wie im Nachhinein gern dargestellt. Selbst einzelne, einflussreiche Vertreter*innen des Anarchismus wechselten periodisch ihre Haltung zur Revolution in Russland.
Anarchismus in Russland
Der russische Anarchismus zerfiel in wenigstens vier Richtungen, von denen drei weitgehend typisch für den Anarchismus des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts sind. Die in den inneranarchistischen Machtkämpfen wahrscheinlich am meisten attackierte Strömung war die des Anarcho-Individualismus. Dessen Kritik am Staat und Betonung der vollkommenen Ungebundenheit des Individuums ging so weit, dass auch von anarchistischer Seite Parallelen zum klassischen Liberalismus gezogen wurden. Friedrich Nietzsches kurioser philosophischer Eklektizismus galten den Anarcho-Individualist*innen ebenso als Blaupause wie die Lehren Bakunins. Als sich individualistische Anarchist*innen verstärkt der »Propaganda der Tat« zuwendeten, also Anschläge auf Aushängeschilder des Staates verübten, war es insbesondere einer der weiteren Väter des russischen Anarchismus, Pjotr Kropotkin, der diese Strömung dafür ins Visier nahm.
Der Aderlass sei zu groß, die Erfolge zu gering und eine Revolution mittels dieser Methode schlicht nicht auszulösen, so Kropotkins vernichtendes Urteil über die weltweit von Anarchist*innen verschiedener Strömungen angewandte »Propaganda der Tat.«
Sein »kommunistischer Anarchismus«, war der zahlenmäßig wahrscheinlich stärkste anarchistische Flügel in Russland vor Beginn des Ersten Weltkriegs und betonte das Kollektiv, statt des Individuums. Kropotkins Weg war alles andere als vorgezeichnet. Als Angehöriger des russischen Adels wurde seine Abwendung vom Zarenreich selbst im engsten Familienkreis als Verrat gesehen. Seine Autobiografie skizziert das Psychogramm einer untergehenden Klasse, wie sie Kropotkin als Kind und Jugendlicher erleben musste. Sein Ekel über die brutalen Prügelstrafen für Bäuerinnen und Bauern und die enorme Armut werden ihn den russischen Adel hassen lehren, ebenso wie den zaristischen Staat. In dem er fortan einen seiner Hauptgegner erkennt.
Vielleicht ist es dieser durchaus begründete Hass, der ihn den Blick für die wirkliche Rolle des Staates verstellen wird. Selbst Lenins proletarischer Staat, mitsamt der jederzeitigen Wähl- und Abwählbarkeit aller Funktionsträger*innen, die lediglich einen durchschnittlichen Arbeiter*innenlohn erhalten sollen und deren Rechenschaftspflicht, ist Kropotkin ein Graus. Lenins marxistische Sicht auf den Staat, der ein Kind der Klassengegensätze ist und auch nur verschwinden kann, wenn die Klassen verschwinden, verschließt sich Kropotkin. Die von Lenin in »Staat und Revolution« im Revolutionsjahr 1917 niedergeschriebene Idee, man müsse die bürgerliche Staatsmaschinerie brechen, den Arbeiter*innenstaat errichten und dieser werde mit Verschwinden der Klassen aufgehoben, ist für Kropotkin nicht verständlich.
Kropotkins Haltung zum Ersten Weltkrieg entspringt einer verhängnisvollen Fehleinschätzung. Für ihn ist ausgerechnet der Waffengang der deutschen Herrschenden ein Befreiungskrieg der deutschen Arbeiter*innen gegen den Zarismus. Insofern befürwortet Kropotkin den Krieg, obgleich er nicht auf der Seite des russischen Zaren steht. Etwa 1,8 Millionen russischer Soldaten und hunderttausende russische Zivilist*innen mussten mit ihrem Leben bezeugen, dass Kropotkins Auffassungen zum Krieg grundfalsch waren. Das Ende des Zarismus kam nicht etwa durch starke deutsche Bajonette, sondern durch die Kraft der Schwachen.
Kropotkins Begeisterung für die Französische Revolution ließ ihn unter anderem ein zweibändiges Grundsatzwerk über die revolutionären Erschütterungen in Frankreich zwischen 1789 und 1796 verfassen, das Lenin als das wahrscheinlich beste jemals geschriebene Werk über dieses Thema lobte.
Die Lehren, die Kropotkin für seine eigene politische Praxis aus der Französischen Revolution zog, waren leider weniger weitblickend. Das Vorbild für die Organisation der postkapitalistischen Gesellschaft waren für ihn die großen Eisenbahnunternehmen in den USA, die dort ganz selbstständig die bestmöglichen Linienführungen der zu bauenden Strecken miteinander vereinbarten. Für ihn ein Beweis, dass es eines Staates zu keiner Zeit bedurfte. Dass der Antrieb dieser Unternehmen nicht die Verbesserung der Lebensverhältnisse, sondern der größtmögliche Profit war und dass sie dafür jeden Vertrag brechend Schienen auch durch Ureinwohner*innen zugesprochenes Land legten – all das kürzte der Geograf einstweilen aus seinen Überlegungen heraus.
Das Zusammenleben der Menschen stellte sich Kropotkin als ein Miteinander weitgehend autonomer Kommunen vor. Vorbild hier war der teilweise noch immer bestehende bäuerliche Gemeinschaftsbesitz, der »Mir«, und die mittelalterliche Stadt, die Kropotkin immer wieder gern hervorhob. Dass das Zusammenleben dort durch Über- und Unterordnung, durch Reichtum für Wenige und Armut für Viele und durch restriktive staatliche Herrschaftsmethoden gekennzeichnet war, wollte Kropotkin, so scheint es, nicht sehen.
Abgrenzung zu den anarchistischen Kommunist*innen suchten die Anarcho-Syndikalist*innen, die versuchten gewerkschaftliche Organisationen aufzubauen. Geprägt waren sie von den Ideen Volins, der mit bürgerlichem Namen Wsewolod Michailowitsch Eichenbaum hieß. Dessen Vorstellung war, dass die Arbeiter*innen ihre Betriebe selbst übernehmen sollten. Genossenschaften sollten miteinander in Austausch treten. Dabei würde jedoch weder das Wertgesetz im Austausch außer Kraft gesetzt, noch die Konkurrenz der Betriebe untereinander, was Volin nicht erkannte. Wie genau die dann übernommenen Betriebe und ihre Produktion zu organisieren seien, blieb Volins Geheimnis.
Die vierte und für den Rest der Welt sehr untypische, somit also grundsätzlich russische, Version des Anarchismus war eine Strömung, die sich auf den Schriftsteller Leo Tolstoi bezog. Deren Anhänger*innen waren stark pazifistisch geprägt.
Der Streit zwischen und innerhalb dieser Strömungen war kein besonders fruchtbarer. Am Vorabend des Revolutionsjahres 1917 war von einer in sich logischen und anwendbaren anarchistischen Theorie wenig zu spüren. Folgerichtig lösten die Ereignisse ab Februar 1917 im russischen, letzten Endes sogar im weltweiten Anarchismus eine tiefe Krise...
| Erscheint lt. Verlag | 21.2.2022 |
|---|---|
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sozialwissenschaften ► Politik / Verwaltung |
| Schlagworte | Anarchismus • Anarchosyndikalismus • Russische Revolution • Russland • Spanien • Spanischer Bürgerkrieg |
| ISBN-10 | 3-7546-4142-5 / 3754641425 |
| ISBN-13 | 978-3-7546-4142-2 / 9783754641422 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 262 KB
Digital Rights Management: ohne DRM
Dieses eBook enthält kein DRM oder Kopierschutz. Eine Weitergabe an Dritte ist jedoch rechtlich nicht zulässig, weil Sie beim Kauf nur die Rechte an der persönlichen Nutzung erwerben.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich